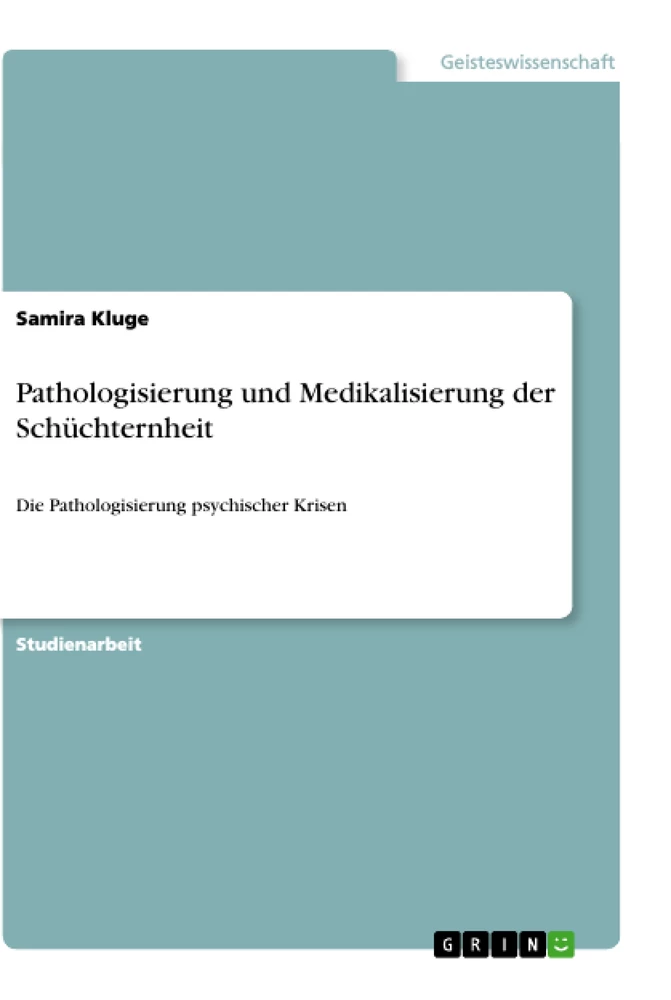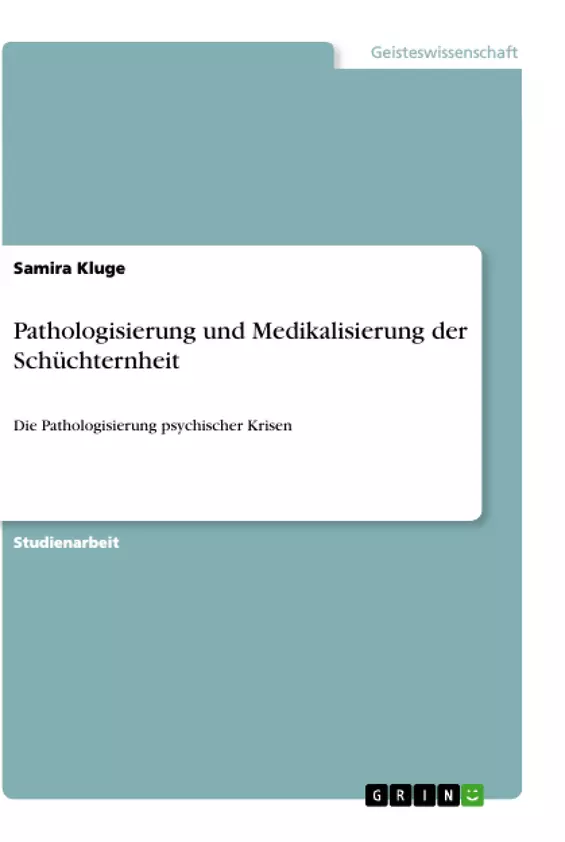Diese Arbeit analysiert Peter Wehlings Beitrag. "Schüchternheit – Die Entdeckung und Bekämpfung einer Volkskrankheit" und versucht diesen zusammenzufassen.
"Schüchternheit – Die Entdeckung und Bekämpfung einer Volkskrankheit" ist ein von Peter Wehlings verfasster Beitrag, der im Jahr 2016 im "Handbuch Therapeutisierung und Soziale Arbeit, Perspektiven kritischer Sozialer Arbeit" veröffentlicht wurde.
Wehling, der Philosophie, Politikwissenschaft und Geschichte studiert hat, doziert nun seit 2001 Soziologie an der Universität Augsburg. Was seine Arbeitsgebiete betrifft, so beschäftigt er sich mit einer Vielzahl an Thematiken, wie beispielsweise der Gesellschaftstheorie und der Medizintheorie, die auch für diese Arbeit relevant sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Schüchternheit im gesellschaftlichen Problematisierungsprozess
- Der Problemcharakter der Schüchternheit
- Motive des Wandels
- Der DSM-III bis V
- Ratgeber-Bücher
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text „Schüchternheit – Die Entdeckung und Bekämpfung einer >>Volkskrankheit<<“ von Peter Wehling untersucht den Wandel der Schüchternheit von einer alltäglichen Verhaltensweise hin zu einer behandelungsbedürftigen Sozialphobie. Wehling analysiert die gesellschaftlichen Einflüsse, die zu dieser Pathologisierung beigetragen haben und hinterfragt kritisch diese Entwicklung.
- Die historische Entwicklung des Konzepts von Schüchternheit
- Die Rolle des DSM-III bis V bei der Definition von Sozialphobie
- Der Einfluss von Ratgeber-Büchern auf den Diskurs über Schüchternheit
- Die gesellschaftlichen Veränderungen, die zur Pathologisierung von Schüchternheit geführt haben
- Die kritische Betrachtung der Pathologisierung und die Frage nach den Folgen für Betroffene
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet den Wandel der Schüchternheit von einer akzeptierten Verhaltensweise zu einem Problem, das als Vorbote für eine psychische Störung angesehen wird. Hierbei werden die gesellschaftlichen Umbrüche der 1970er Jahre und die Rolle von Philip G. Zimbardos Ratgeber „Shyness: What It Is - What to Do About It“ analysiert.
Im zweiten Kapitel wird die Problematik der Schüchternheit näher untersucht, indem zwischen der Diagnose und dem Grund für ihre Problematisierung unterschieden wird. Wehling kritisiert dabei die zunehmende Verbreitung von Selbstdiagnosen und hinterfragt die Notwendigkeit einer Behandlung von Schüchternheit.
Das dritte Kapitel beleuchtet die Motive für den gesellschaftlichen Wandel, die zu einer pathologischen Sichtweise auf Schüchternheit geführt haben. Hierbei werden Faktoren wie die Frauenbewegung, die verstärkte mediale Selbstdarstellung und der neue Geist des Kapitalismus analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Schüchternheit, Sozialphobie, Pathologisierung, gesellschaftlicher Wandel, Frauenbewegung, mediale Selbstdarstellung, Kapitalismus, Ratgeber-Bücher, DSM-III bis V, Selbstdiagnose.
Häufig gestellte Fragen
Wie wurde Schüchternheit zur „Volkskrankheit“?
Die Arbeit analysiert, wie eine normale Verhaltensweise durch gesellschaftliche Prozesse und diagnostische Manuale (DSM) zur behandelbaren Sozialphobie umgedeutet wurde.
Welche Rolle spielt das DSM bei der Pathologisierung?
Die Versionen III bis V des DSM haben die Kriterien für Sozialphobie so erweitert, dass immer mehr schüchterne Verhaltensweisen als psychische Störung gelten.
Warum begünstigt der Kapitalismus die Bekämpfung von Schüchternheit?
In einer Leistungsgesellschaft, die auf medialer Selbstdarstellung und Extrovertiertheit basiert, wird Schüchternheit zunehmend als ökonomisches und soziales Hindernis wahrgenommen.
Welchen Einfluss haben Ratgeber-Bücher?
Ratgeber wie der von Philip Zimbardo trugen dazu bei, Schüchternheit als Problem zu definieren, das durch Selbstoptimierung überwunden werden muss.
Was kritisiert Peter Wehling an dieser Entwicklung?
Er hinterfragt die zunehmende Medikalisierung des Alltags und die Tendenz, soziale Probleme in individuelle psychische Störungen umzuwandeln.
- Arbeit zitieren
- Samira Kluge (Autor:in), 2019, Pathologisierung und Medikalisierung der Schüchternheit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1152626