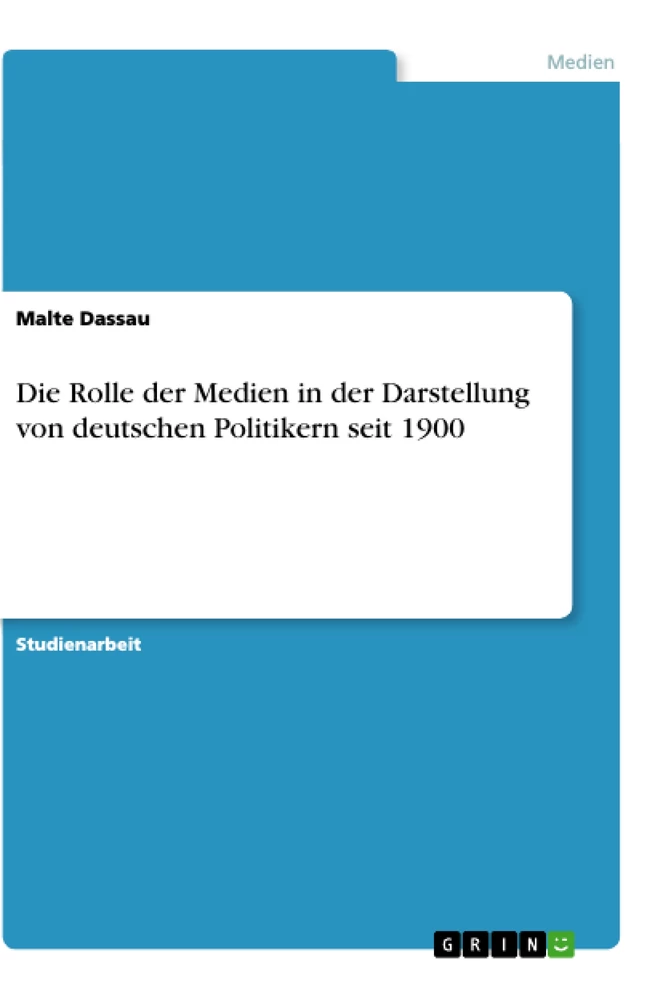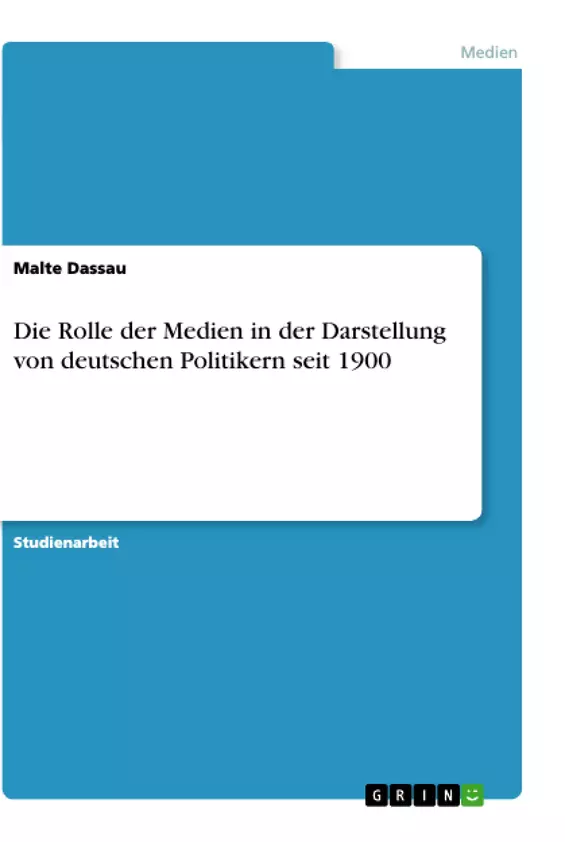Diese Arbeit beschäftigt sich mit der medialen Darstellung von Politikern seit dem neunzehnten Jahrhundert und beantwortet die Frage, welche Rolle die Entwicklung der Medien in diesem Prozess einnimmt.
Wie nutzten diese Politiker aus differenten Staatssystemen die Medien für ihre Darstellung? Welche Strategien verfolgten sie mit ihrer politischen Visualisierung, um politische Macht zu erhalten oder zu sichern? Dies sind Fragen, die im Kontext der technologischen Entwicklung der Medien in dieser Arbeit beantwortet werden sollen. Erst durch die Verbindung aller Kapitel werden Kontinuitäten beziehungsweise Diskontinuitäten in den Politikerdarstellungen deutlich. Die Verknüpfung ermöglicht einzelne Faktoren zu erkennen, die erstmals bei einer Politikerdarstellung auftreten und kontinuierlich bei nachkommenden Politikern weiterentwickelt und genutzt werden. Beispielhaft sollen die Politikerdarstellungen Wilhelm II., Hindenburgs, Hitlers, Adenauers, Schröders und schließlich Merkels Antwort auf die Fragen geben.
Politik und mediale Darstellung sind heutzutage nicht mehr voneinander zu trennen. Tagtäglich inszenieren sich die Politiker für ihre politischen Wähler in den Medien. Ohne politische Inszenierung können Politiker heute keine Wahl mehr gewinnen. Diese Tatsache des späten zwanzigsten Jahrhunderts ist Resultat eines langen Prozesses, der sich an verschiedenen Politikerdarstellungen im zwanzigsten Jahrhundert in Deutschland abzeichnete. Die Macht der Medien scheint stetig zugenommen zu haben und am Ende dieses Prozesses maßgeblicher Faktor für den Machtgewinn bzw. –erhalt geworden zu sein. Gleichzeitig zeigt sich ein stetiger Prozess, in dem sich die politischen Inhalte immer mehr von der Person ablösen und in den Hintergrund zu treten scheinen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wilhelm II. und Gerhard Schröder - Medienkaiser und Medienkanzler
- Die Kraft des „Rettermythos“
- Der „Rettermythos“ in der Weimarer Republik
- Der „Marschall“ und der „Gefreite“
- „Der Führer“ als erstes politisches Markenprodukt
- Politiker der Werbeindustrie. Der Weg in die Mediengesellschaft
- Konrad Adenauer als erstes Produkt der Werbeindustrie
- Mit Gerhard Schröder zum deutschen „Politainment“
- Angela Merkel: Die mediale Antiheldin?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die mediale Darstellung deutscher Politiker im 20. Jahrhundert und analysiert, wie sie die Medien für ihre Selbstdarstellung und den Machterhalt nutzten. Der Fokus liegt auf den Strategien der politischen Visualisierung im Kontext des technologischen Fortschritts der Medien. Die Arbeit beleuchtet Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der medialen Inszenierung verschiedener Politiker, um Kontinuitäten und Diskontinuitäten aufzuzeigen.
- Die Entwicklung der medialen Darstellung von Politikern im 20. Jahrhundert
- Vergleichende Analyse der medialen Strategien verschiedener Politiker
- Der Einfluss des technologischen Fortschritts der Medien auf die politische Inszenierung
- Die Rolle des „Politainments“ in der politischen Kommunikation
- Die Auswirkungen der medialen Inszenierung auf das politische Image und den Machterhalt
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Nutzung der Medien durch Politiker zur Selbstdarstellung und Machtsicherung im 20. Jahrhundert. Sie betont die untrennbare Verbindung von Politik und medialer Darstellung und beschreibt den langen Prozess der zunehmenden Medienmacht. Die Arbeit analysiert die medialen Darstellungen verschiedener Politiker aus unterschiedlichen Staatsformen und untersucht die Entwicklung von Strategien der politischen Visualisierung. Die einzelnen Kapitel werden als in sich geschlossene Einheiten vorgestellt, deren Zusammenführung Kontinuitäten und Diskontinuitäten aufzeigt. Die Analyse soll Aufschluss über die Entwicklung und den Einfluss von medialen Strategien geben.
Wilhelm II. und Gerhard Schröder - Medienkaiser und Medienkanzler: Dieses Kapitel vergleicht die mediale Inszenierung von Kaiser Wilhelm II. und Bundeskanzler Gerhard Schröder. Es hebt die Unterschiede in den medialen Technologien und politischen Systemen hervor, wobei Wilhelm II. in einer konstitutionellen Monarchie agierte und Schröder in einer Demokratie. Trotz der unterschiedlichen Abhängigkeiten vom Volk nutzten beide die Medien zur Selbstdarstellung und zur Schaffung einer positiven öffentlichen Stimmung. Wilhelm II. nutzte vor allem statische Bilder, während Schröder das Fernsehen und andere moderne Medien einsetzte. Trotz der Unterschiede in den Methoden verfolgten beide eine personenbezogene Darstellungsform, die das politische Amt in den Schatten stellte. Beide nutzten ihre mediale Inszenierung, um von politischen Konflikten abzulenken, was letztendlich zum Scheitern beider führte; Wilhelm II. durch den Ersten Weltkrieg, Schröder durch zunehmende innenpolitische Schwierigkeiten. Während Wilhelm II. zur Ikone wurde, deren Image später gezielt angegriffen wurde, wurde Schröders "Politainment"-Stil eher karikiert und kritisiert.
Schlüsselwörter
Mediale Darstellung, Politiker, Selbstdarstellung, Machterhalt, Medien, Technologie, Wilhelm II., Gerhard Schröder, Politainment, politische Inszenierung, öffentliche Meinung, Image, Propaganda, Weimarer Republik, Mediengesellschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Mediale Inszenierung deutscher Politiker im 20. Jahrhundert
Was ist der Gegenstand der Untersuchung?
Die Arbeit untersucht die mediale Darstellung deutscher Politiker im 20. Jahrhundert und analysiert, wie diese die Medien für ihre Selbstdarstellung und den Machterhalt nutzten. Der Fokus liegt auf den Strategien der politischen Visualisierung im Kontext des technologischen Fortschritts der Medien.
Welche Politiker werden im Einzelnen betrachtet?
Die Arbeit vergleicht die medialen Strategien verschiedener Politiker, darunter Kaiser Wilhelm II. und Bundeskanzler Gerhard Schröder, Konrad Adenauer und Angela Merkel. Der Vergleich soll Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der medialen Inszenierung aufzeigen und Kontinuitäten und Diskontinuitäten verdeutlichen.
Welche Aspekte der medialen Darstellung werden analysiert?
Die Analyse umfasst die Entwicklung der medialen Darstellung von Politikern im 20. Jahrhundert, vergleicht die medialen Strategien verschiedener Politiker, untersucht den Einfluss des technologischen Fortschritts der Medien auf die politische Inszenierung, betrachtet die Rolle des „Politainments“ in der politischen Kommunikation und analysiert die Auswirkungen der medialen Inszenierung auf das politische Image und den Machterhalt.
Wie wird der Vergleich zwischen Wilhelm II. und Gerhard Schröder durchgeführt?
Das Kapitel zu Wilhelm II. und Gerhard Schröder vergleicht die mediale Inszenierung beider Politiker, wobei die Unterschiede in den medialen Technologien und politischen Systemen (konstitutionelle Monarchie vs. Demokratie) hervorgehoben werden. Trotz unterschiedlicher Methoden verfolgten beide eine personenbezogene Darstellungsform, um von politischen Konflikten abzulenken, was letztendlich zum Scheitern beider führte.
Welche Rolle spielt der "Rettermythos"?
Die Arbeit untersucht die Kraft des „Rettermythos“ und dessen Anwendung in der medialen Darstellung von Politikern, insbesondere im Kontext der Weimarer Republik und im Vergleich zwischen dem Image von „Marschall“ und „Gefreiten“.
Welche Bedeutung hat der Begriff "Politainment"?
Der Begriff „Politainment“ beschreibt die Vermischung von Politik und Unterhaltung in der medialen Darstellung, insbesondere im Kontext der medialen Strategie von Gerhard Schröder. Die Arbeit analysiert die Rolle des Politainments in der politischen Kommunikation und dessen Auswirkungen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Mediale Darstellung, Politiker, Selbstdarstellung, Machterhalt, Medien, Technologie, Wilhelm II., Gerhard Schröder, Politainment, politische Inszenierung, öffentliche Meinung, Image, Propaganda, Weimarer Republik, Mediengesellschaft.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie nutzten deutsche Politiker im 20. Jahrhundert die Medien zur Selbstdarstellung und Machtsicherung?
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zu Wilhelm II. und Gerhard Schröder, ein Kapitel zum „Rettermythos“, ein Kapitel zum „Führer“ als politisches Markenprodukt, ein Kapitel zu Politikern der Werbeindustrie (Adenauer, Schröder, Merkel) und ein Fazit.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Entwicklung und den Einfluss von medialen Strategien auf die politische Karriere und den Machterhalt deutscher Politiker im 20. Jahrhundert. Die Zusammenfassung der Kapitel bietet einen detaillierten Überblick über die einzelnen Analysen und deren Zusammenführung.
- Citation du texte
- Malte Dassau (Auteur), 2010, Die Rolle der Medien in der Darstellung von deutschen Politikern seit 1900, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1152736