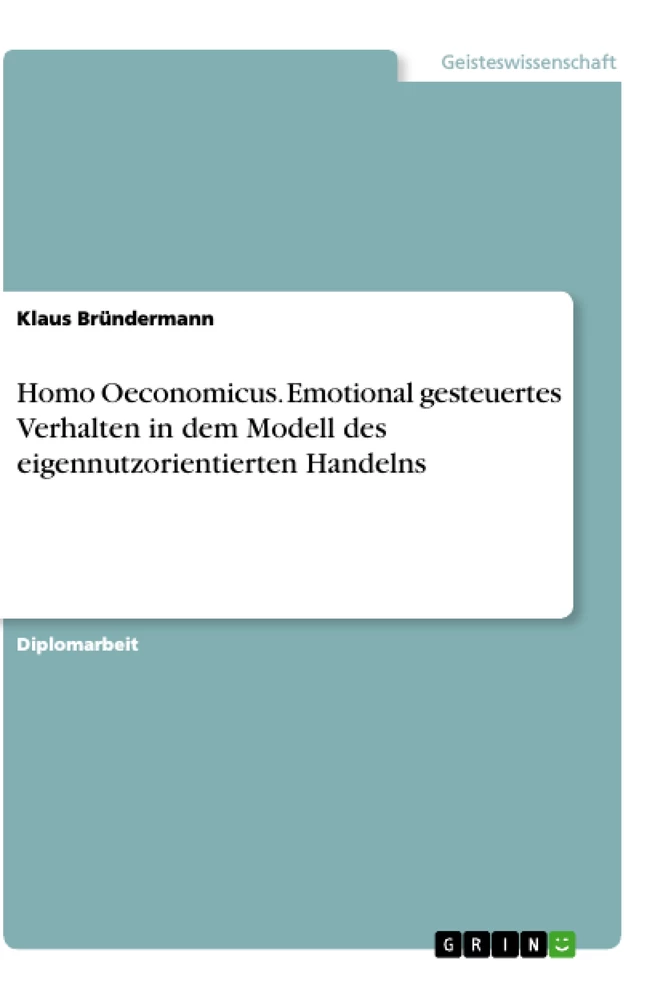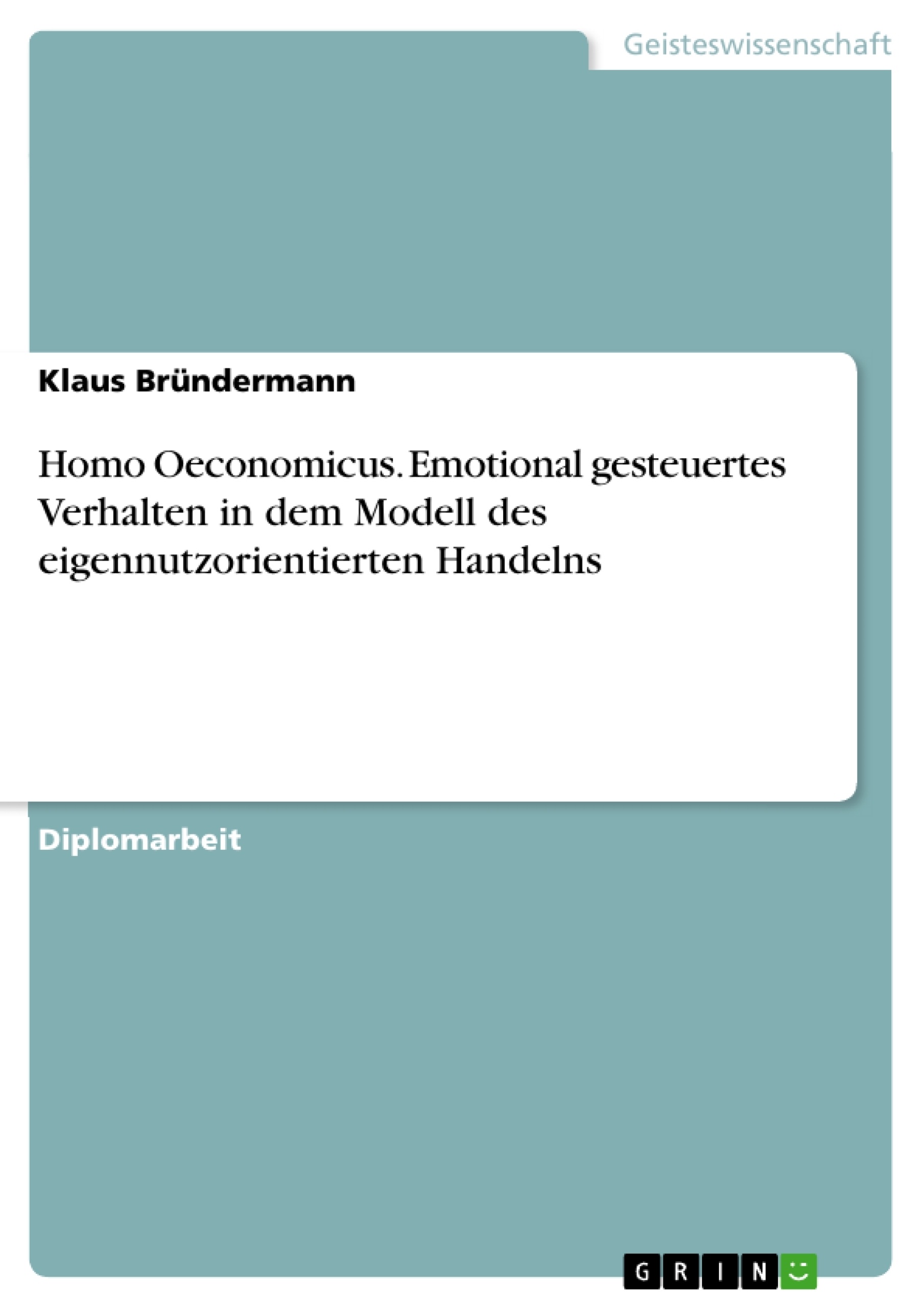Diese Arbeit entstand im Rahmen der Erlangung des Grades eines Diplom-Kaufmanns am Fachbereich Wirtschafts- und Organisationswissenschaften, Institut für Wirtschaftspolitik, der Universität der Bundeswehr Hamburg.
In der ökonomischen Theorie begegnet man zwangsläufig einem Menschen mit Namen Homo oeconomicus. Dieser Mensch ist vollständig informiert, egoistisch, rational kalkulierend und besitzt weitere Eigenschaften, die jedem Studenten, der sich mit der Ökonomik beschäftigt, vermittelt werden.
Dieses Bild stimmt offensichtlich nicht mit der Realität überein. Ist damit die Ökonomik realitätsfern, oder haben wir es hier nur mit einer speziellen Sichtweise eines Menschen zu tun, der für bestimmte Analysen mit diesen Eigenschaften ausgestattet wurde?
Diese Frage zu klären und gleichzeitig die Universalität das ökonomischen Ansatzes zur Erklärung menschlichen Verhaltens zu erläutern, ist Aufgabe dieser Arbeit. In ihrem Mittelpunkt steht die Analyse des ökonomischen Menschenbildes.
Besondere Beachtung findet dabei emotionsgesteuertes Verhalten und seine Implementierung im Modell des Homo oeconomicus.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Problemstellung
- 2. Grundlegende Abgrenzungen
- 2.1. Einführung
- 2.2. Standort der Wirtschaftswissenschaften
- 2.3. Zur Definition der Ökonomik
- 2.4. Ökonomik als normative oder positive Theorie
- 2.5. Geschichte der Ökonomik
- 2.6. Zusammenfassung
- 3. Ökonomik und Menschenbild
- 3.1. Einführung
- 3.2. Der Homo oeconomicus in der Ökonomik
- 3.2.1. Das individuelle Verhaltensmodell der Ökonomik
- 3.2.2. Anwendungen des ökonomischen Verhaltensmodells
- 3.2.2.1. Einführung
- 3.2.2.2. Der Mensch der Mikroökonomik
- 3.2.2.3. Der Mensch der Makroökonomik
- 3.2.2.4. Zusammenfassung
- 3.2.3. Der Mensch in der Ökonomik
- 3.2.3.1. Einführung
- 3.2.3.2. Individuum
- 3.2.3.3. Komplexität und Abstraktion
- 3.2.3.4. Realitätsnähe
- 3.2.3.5 Eigenschaften
- 3.2.3.6. Interdisziplinarität
- 3.2.3.7. Der Homo oeconomicus als Erkenntnisobjekt
- 3.2.3.8. Zusammenfassung
- 3.2.4. Homo oeconomicus in der Diskussion
- 3.2.4.1. Einführung
- 3.2.4.2. Rationalität
- 3.2.4.3. Maximierung
- 3.2.4.4. Information
- 3.2.4.5. Restriktionen
- 3.2.4.6. Präferenzstruktur
- 3.2.4.7. Konstanz der Präferenzstruktur
- 3.2.4.8. Eigennutz oder Altruismus
- 3.2.4.9. Nutzen und Nutzenfunktion
- 3.2.4.10. Zielgerichtetes Verhalten
- 3.2.4.11. Zusammenfassung
- 3.2.5. Entwicklungen in der modernen Ökonomik
- 3.2.6. Grenzen des ökonomischen Verhaltensmodells?
- 3.3. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Frage, inwiefern das ökonomische Modell des Homo oeconomicus, der als rational, eigennutzorientiert und vollständig informiert dargestellt wird, mit der Realität menschlichen Verhaltens, insbesondere emotional gesteuertem Verhalten, vereinbar ist. Der Fokus liegt auf der Integration von Emotionen, speziell der Liebe, in das ökonomische Modell.
- Das ökonomische Menschenbild des Homo oeconomicus
- Emotionen und ihr Einfluss auf menschliches Handeln
- Die Integration von Emotionen (Liebe) in das Modell des Homo oeconomicus
- Die Grenzen und die Realitätsnähe des ökonomischen Verhaltensmodells
- Die Diskussion um Rationalität und Eigennutz in der Ökonomik
Zusammenfassung der Kapitel
1. Problemstellung: Dieses Kapitel führt in die zentrale Fragestellung der Arbeit ein: die Vereinbarkeit des ökonomischen Menschenbildes mit der Realität emotional gesteuerten Verhaltens. Es wird die Diskrepanz zwischen dem theoretischen Homo oeconomicus und dem realen Menschen hervorgehoben und die Notwendigkeit einer umfassenderen Betrachtungsweise des menschlichen Verhaltens betont. Die Arbeit zielt darauf ab, die Universalität des ökonomischen Ansatzes zu hinterfragen und die Integration von Emotionen in das Modell des Homo oeconomicus zu erforschen.
2. Grundlegende Abgrenzungen: Dieses Kapitel liefert grundlegende Definitionen und Abgrenzungen der verwendeten Begriffe und Konzepte. Es klärt den Standpunkt der Wirtschaftswissenschaften, die Definition der Ökonomik als normative oder positive Theorie und skizziert deren historische Entwicklung. Es dient der Präzisierung der methodischen Grundlage der Arbeit und bildet somit die Basis für die folgenden Kapitel. Die Abgrenzung der Ökonomik von anderen Disziplinen und die Erläuterung ihrer verschiedenen Betrachtungsweisen sind essenziell für das Verständnis der darauffolgenden Analyse des Homo oeconomicus.
3. Ökonomik und Menschenbild: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit dem zentralen Begriff des Homo oeconomicus. Es beschreibt das individuelle Verhaltensmodell der Ökonomik und seine Anwendungen in der Mikro- und Makroökonomik. Es analysiert kritisch die Eigenschaften des Homo oeconomicus, seine Realitätsnähe und die Grenzen des Modells. Die Diskussion über Rationalität, Maximierung, Information, Restriktionen und Präferenzstrukturen steht im Mittelpunkt, um die Anwendbarkeit und die Grenzen des Modells im Hinblick auf reale menschliche Verhaltensweisen zu beleuchten. Es wird untersucht, inwieweit der Homo oeconomicus als Erkenntnisobjekt geeignet ist und die Integration von Aspekten wie Altruismus in Betracht gezogen werden muss.
Schlüsselwörter
Homo oeconomicus, Emotionen, Liebe, Verhaltensmodell, Ökonomik, Rationalität, Eigennutz, Altruismus, Realitätsnähe, Mikroökonomik, Makroökonomik, Modellgrenzen.
Häufig gestellte Fragen zu: [Titel des Textes einfügen]
Was ist der Gegenstand des Textes?
Der Text untersucht die Vereinbarkeit des ökonomischen Modells des Homo oeconomicus mit der Realität menschlichen Verhaltens, insbesondere mit emotional gesteuertem Verhalten. Der Fokus liegt dabei auf der Integration von Emotionen, speziell der Liebe, in das ökonomische Modell und der kritischen Auseinandersetzung mit den Grenzen und der Realitätsnähe dieses Modells.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt folgende zentrale Themen: das ökonomische Menschenbild des Homo oeconomicus, den Einfluss von Emotionen auf menschliches Handeln, die Integration von Emotionen (insbesondere Liebe) in das Modell des Homo oeconomicus, die Grenzen und die Realitätsnähe des ökonomischen Verhaltensmodells sowie die Diskussion um Rationalität und Eigennutz in der Ökonomik.
Wie ist der Text strukturiert?
Der Text ist in Kapitel gegliedert. Kapitel 1 stellt die Problemstellung vor. Kapitel 2 befasst sich mit grundlegenden Abgrenzungen und Definitionen der Ökonomik und des Homo oeconomicus. Kapitel 3 analysiert ausführlich das ökonomische Menschenbild und seine Grenzen im Hinblick auf reale Verhaltensweisen unter Berücksichtigung von Emotionen.
Was versteht der Text unter dem Homo oeconomicus?
Der Text beschreibt den Homo oeconomicus als ein rationales, eigennutzorientiertes und vollständig informiertes Individuum – ein Modell, das in der Ökonomik verwendet wird. Der Text hinterfragt jedoch die Universalität und die Realitätsnähe dieses Modells und diskutiert kritisch seine Anwendbarkeit auf reales, emotional beeinflusstes menschliches Verhalten.
Welche Rolle spielen Emotionen im Text?
Emotionen, insbesondere die Liebe, spielen eine zentrale Rolle, da der Text die Grenzen des traditionellen Homo oeconomicus-Modells aufzeigt, welches Emotionen vernachlässigt. Die Integration von Emotionen in das ökonomische Modell wird als entscheidend für eine realistischere Abbildung menschlichen Verhaltens angesehen.
Welche Kritikpunkte werden am Homo oeconomicus-Modell geäußert?
Der Text kritisiert die Vereinfachung des menschlichen Verhaltens im Homo oeconomicus-Modell, insbesondere die Vernachlässigung von Emotionen, Altruismus und unvollständiger Information. Die Frage nach der Realitätsnähe und den Grenzen des Modells wird eingehend diskutiert.
Welche Schlüsselbegriffe sind im Text relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Homo oeconomicus, Emotionen (insbesondere Liebe), Verhaltensmodell, Ökonomik, Rationalität, Eigennutz, Altruismus, Realitätsnähe, Mikroökonomik, Makroökonomik und Modellgrenzen.
Für wen ist dieser Text geeignet?
Dieser Text ist für Leser geeignet, die sich für die Wirtschaftswissenschaften, insbesondere für das ökonomische Menschenbild und die Integration von Emotionen in ökonomische Modelle interessieren. Ein grundlegendes Verständnis ökonomischer Konzepte ist hilfreich.
- Arbeit zitieren
- Klaus Bründermann (Autor:in), 1994, Homo Oeconomicus. Emotional gesteuertes Verhalten in dem Modell des eigennutzorientierten Handelns, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1152741