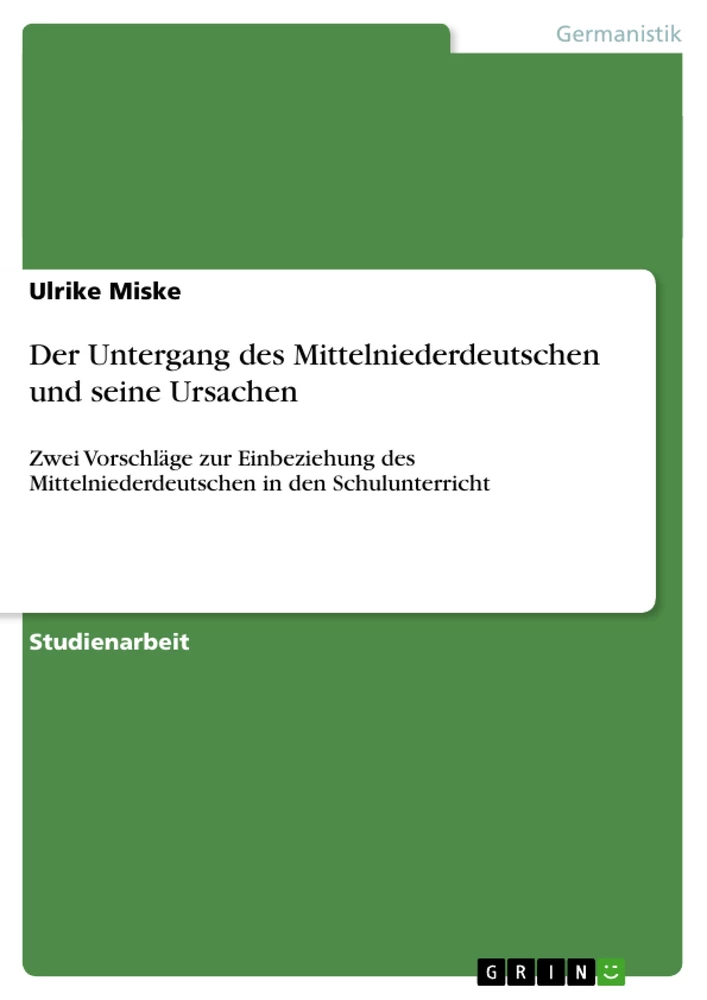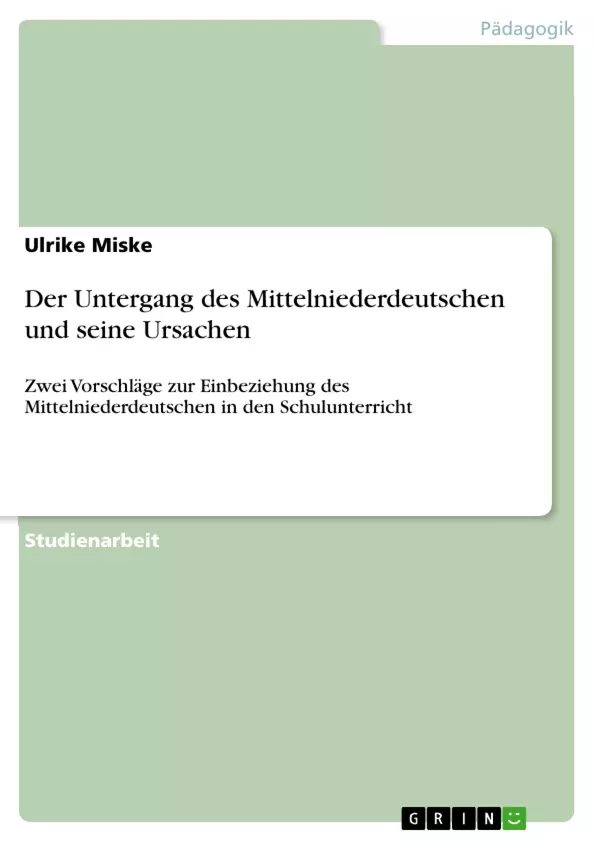Der Schreibsprachenwechsel vom Mittelniederdeutschen zum Neuhochdeutschen im 16. und 17. Jahrhundert war eine der bedeutendsten sprachlichen Veränderungen in Deutschland. Das Mittelniederdeutsche, welches über Jahrhunderte als etablierte ‚internationale’ Handelssprache fungierte, verschwand nun nahezu vollständig aus allen öffentlichen, kirchlichen und wirtschaftlichen Bereichen Norddeutschlands. Das Eindringen des Neuhochdeutschen hob somit die Zweigliederung der deutschen Sprache auf standardsprachlicher Ebene gänzlich auf und selbst im privaten Gebrauch wurde das Niederdeutsche oftmals als zweitklassige Sprache angesehen.
Die Ursachen dieses sprachlichen Wandels liegen vor allem in der engen Verknüpfung von schreibsprachlichen mit ökonomischen, politischen sowie kulturellen Entwicklungen. Die erheblichen Änderungen in der wirtschaftlichen und politischen Struktur Nordeuropas im 15. und 16. Jahrhundert führten zum Schwund der hansischen Macht und zu einer Neuorientierung der bürgerlichen Kultur Norddeutschlands. Des Weiteren hatten sich die Humanisten kulturell nach Oberdeutschland und Italien orientiert und auch die Fürsten waren auf Grund ihrer dynastischen Verbindungen kulturell mit dem süddeutschen Raum verbunden, so dass die hochdeutsche Kultur und damit auch die Sprache in jenen Kreisen schnell an Prestige gewann. Der Übergang vom Niederdeutschen zum Hochdeutschen fand zunächst in den Kanzleien, später auch in Schulen und Universitäten sowie Kirchen statt.
Im Folgenden soll auf einige der ökonomischen, politischen und kulturellen Ursachen des Eindringens der frühneuhochdeutschen Sprache eingegangen werden. Zuvor soll aber auch das Mitteniederdeutsche und dessen zeitliche und räumliche Abgrenzung betrachtet werden. Abschließend wird sich der Frage gewidmet, in wiefern sich diese Thematik in den Deutschunterricht der Mittel- und Oberstufe eingliedern lässt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Mittelniederdeutsche
- 2.1. Definition
- 2.2. Die zeitliche Abgrenzung des Mittelniederdeutschen
- 2.3. Die räumliche Abgrenzung des Mittelniederdeutschen
- 3. Die Gründe für den Niedergang der mittelniederdeutschen Sprache
- 3.2. Die Kanzleien
- 3.3. Die Bildungseinrichtungen
- 3.4. Die Kirche
- 3.5. Der Buchdruck
- 4. Die deutsche Sprachgeschichte im Schulunterricht
- 4.1. Reynke de Vos im fächerübergreifenden Unterricht
- 4.2. Das Narrenschiff im Deutschunterricht
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Untergang des Mittelniederdeutschen im 16. und 17. Jahrhundert und dessen Ursachen. Sie beleuchtet die sprachlichen, ökonomischen, politischen und kulturellen Faktoren, die zum Niedergang dieser einst wichtigen Handelssprache führten. Zusätzlich werden Vorschläge zur Integration mittelniederdeutscher Texte in den Schulunterricht präsentiert.
- Der Niedergang des Mittelniederdeutschen als etablierte Sprache
- Die ökonomischen und politischen Ursachen des Sprachwechsels
- Der Einfluss von Kanzleien, Bildungseinrichtungen und Kirche auf die Sprachentwicklung
- Die Rolle des Buchdrucks im sprachlichen Wandel
- Möglichkeiten der Integration mittelniederdeutscher Texte im Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den bedeutenden Sprachwandel vom Mittelniederdeutschen zum Neuhochdeutschen im 16. und 17. Jahrhundert. Sie hebt die ehemalige Bedeutung des Mittelniederdeutschen als Handelssprache hervor und skizziert die Aufhebung der sprachlichen Zweigliederung auf standardsprachlicher Ebene. Die Einleitung führt die wichtigsten Forschungsfragen ein und gibt einen Überblick über den Aufbau der Arbeit, der sich mit den ökonomischen, politischen und kulturellen Ursachen des Sprachwandels auseinandersetzt und schließlich didaktische Überlegungen zur Einbeziehung des Mittelniederdeutschen in den Schulunterricht anstellt.
2. Das Mittelniederdeutsche: Dieses Kapitel definiert das Mittelniederdeutsche (ca. 1300-1600) als Periode der niederdeutschen Sprachgeschichte, die auf das Altniederdeutsche folgt und vom NeuNiederdeutschen abgelöst wird. Es erläutert die zeitliche und räumliche Abgrenzung des Mittelniederdeutschen, einschließlich der verschiedenen Bezeichnungen für die Sprache in unterschiedlichen Kontexten. Die räumliche Ausdehnung wird durch die Ostsiedlung und die Rolle als Lingua Franca im Hansegebiet begründet. Die Kapitel beschreibt die allmähliche Verdrängung des Mittelniederdeutschen durch das Hochdeutsche in verschiedenen schriftlichen Kontexten, unterstreicht aber auch dessen Fortleben in der gesprochenen Sprache sowie in literarischen Genres wie Zwischenspielen und Spottgedichten.
3. Die Gründe für den Niedergang der mittelniederdeutschen Sprache: Dieses Kapitel analysiert die Ursachen für den Rückgang des Mittelniederdeutschen. Es untersucht detailliert den Einfluss von Kanzleien, Bildungseinrichtungen, der Kirche und dem Buchdruck auf den Sprachwandel. Die Kapitel beleuchtet die Verknüpfung von sprachlichen und gesellschaftlichen Veränderungen, die zur Präferenz des Hochdeutschen insbesondere in administrativen und Bildungseinrichtungen führten. Die Analyse zeigt, wie ökonomische und politische Entwicklungen, verbunden mit kulturellen Orientierungen nach Oberdeutschland und Italien, den Niedergang des Mittelniederdeutschen beeinflussten.
4. Die deutsche Sprachgeschichte im Schulunterricht: Dieses Kapitel befasst sich mit der didaktischen Frage, wie die Thematik des Mittelniederdeutschen in den Deutschunterricht integriert werden kann. Es werden zwei konkrete Vorschläge unterbreitet: die Einbeziehung des "Reynke de Vos" in den fächerübergreifenden Unterricht und die Verwendung des "Narrenschiffs" im Deutschunterricht. Die Kapitel diskutiert mögliche didaktische Ansätze und betont den Wert des Mittelniederdeutschen für das Verständnis der deutschen Sprachgeschichte.
Schlüsselwörter
Mittelniederdeutsch, Neuhochdeutsch, Sprachwandel, Sprachgeschichte, Hanse, Ostsiedlung, Kanzleien, Bildungseinrichtungen, Kirche, Buchdruck, Deutschunterricht, Reynke de Vos, Narrenschiff.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Mittelniederdeutsch - Untergang und didaktische Relevanz
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Untergang des Mittelniederdeutschen im 16. und 17. Jahrhundert und die Ursachen hierfür. Sie beleuchtet sprachliche, ökonomische, politische und kulturelle Faktoren, die zum Niedergang dieser einst wichtigen Handelssprache führten. Zusätzlich werden Vorschläge zur Integration mittelniederdeutscher Texte in den Schulunterricht präsentiert.
Was sind die zentralen Themen der Arbeit?
Die Arbeit behandelt den Niedergang des Mittelniederdeutschen als etablierte Sprache, die ökonomischen und politischen Ursachen des Sprachwechsels, den Einfluss von Kanzleien, Bildungseinrichtungen und der Kirche auf die Sprachentwicklung, die Rolle des Buchdrucks im sprachlichen Wandel und Möglichkeiten der Integration mittelniederdeutscher Texte im Unterricht.
Wie wird das Mittelniederdeutsch in der Arbeit definiert?
Das Mittelniederdeutsch wird als Periode der niederdeutschen Sprachgeschichte (ca. 1300-1600) definiert, die auf das Altniederdeutsche folgt und vom NeuNiederdeutschen abgelöst wird. Die Arbeit erläutert die zeitliche und räumliche Abgrenzung, einschließlich der verschiedenen Bezeichnungen für die Sprache in unterschiedlichen Kontexten. Die räumliche Ausdehnung wird durch die Ostsiedlung und die Rolle als Lingua Franca im Hansegebiet begründet.
Welche Ursachen für den Niedergang des Mittelniederdeutschen werden analysiert?
Die Arbeit analysiert detailliert den Einfluss von Kanzleien, Bildungseinrichtungen, der Kirche und dem Buchdruck auf den Sprachwandel. Sie beleuchtet die Verknüpfung von sprachlichen und gesellschaftlichen Veränderungen, die zur Präferenz des Hochdeutschen insbesondere in administrativen und Bildungseinrichtungen führten. Die Analyse zeigt, wie ökonomische und politische Entwicklungen, verbunden mit kulturellen Orientierungen nach Oberdeutschland und Italien, den Niedergang des Mittelniederdeutschen beeinflussten.
Welche didaktischen Vorschläge zur Integration mittelniederdeutscher Texte im Unterricht werden gemacht?
Die Arbeit unterbreitet zwei konkrete Vorschläge: die Einbeziehung des "Reynke de Vos" in den fächerübergreifenden Unterricht und die Verwendung des "Narrenschiffs" im Deutschunterricht. Mögliche didaktische Ansätze werden diskutiert, und der Wert des Mittelniederdeutschen für das Verständnis der deutschen Sprachgeschichte wird betont.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Das Mittelniederdeutsche, Die Gründe für den Niedergang der mittelniederdeutschen Sprache, Die deutsche Sprachgeschichte im Schulunterricht und Zusammenfassung. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Mittelniederdeutsch, Neuhochdeutsch, Sprachwandel, Sprachgeschichte, Hanse, Ostsiedlung, Kanzleien, Bildungseinrichtungen, Kirche, Buchdruck, Deutschunterricht, Reynke de Vos, Narrenschiff.
- Arbeit zitieren
- Ulrike Miske (Autor:in), 2006, Der Untergang des Mittelniederdeutschen und seine Ursachen , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/115283