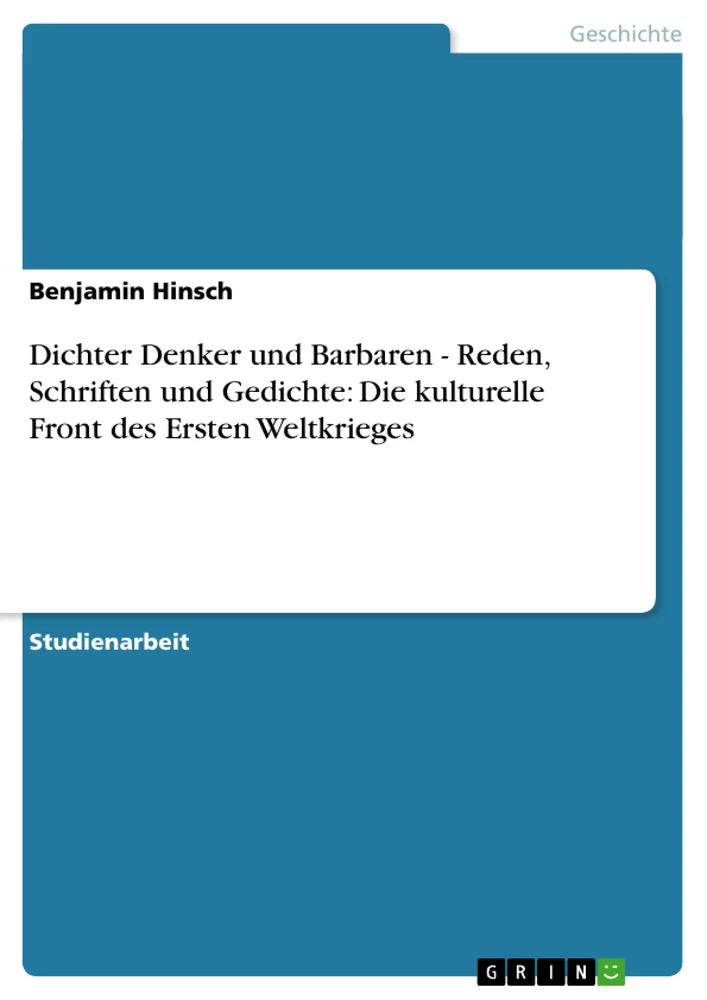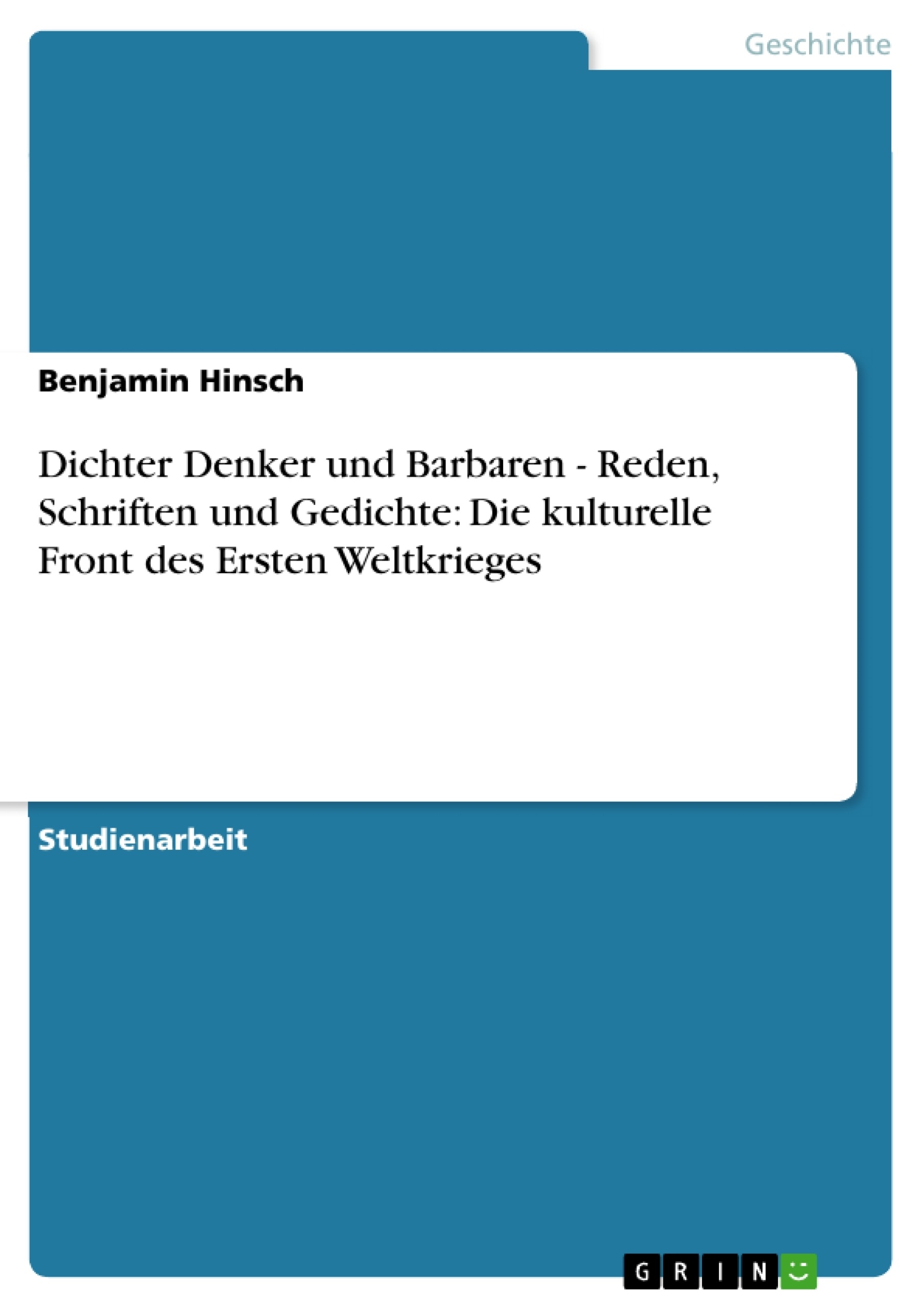„…Seid Ihr die Enkel Goethes oder die Attilas?“ So lautete die Frage des französischen Schriftstellers Rolland Romain an seinen deutschen Kollegen Gerhart Hauptmann, welche in einem offen Brief in der französischen Presse zu lesen war, nachdem die Deutschen zu Beginn des Ersten Weltkrieges das neutrale Belgien überfallen hatten. Die Frage und ihre implizierte Provokation zeigen, dass der Erste Weltkrieg nicht nur an der militärischen, sondern auch an einer geistigen und kulturellen Front geführt wurde. Schon am Tag des Kriegsausbruches wurden auf Seiten aller Kriegsparteien zahlreiche Schriften, Reden und Gedichte veröffentlicht, welche dem Krieg positiv gesinnt waren und deren Menge mit jedem weitern Kriegstag anstieg. Ihre Inhalte und Autoren, sowie deren Beweggründe bilden die Basis dieser Arbeit, welche aus deutscher Perspektive einen Einblick in die Thematik der kulturellen Auseinandersetzung geben soll. In diesem Zusammenhang wird das deutsche Bildungsbürgertum eine zentrale Rolle einnehmen, da hier ein wesentlicher Anteil der beteiligten Autoren vermutet wird.
Strukturell scheint es angebracht zunächst eine Definition dessen zu geben, was der Begriff deutsches Bildungsbürgertum meint beziehungsweise was er nicht meint. Anschließend wird die These des Bildungsbürgertums als Hauptproduzent geprüft. Unter Einbeziehung der damaligen Ereignisse werden dann Motivationen sowie Werke und Reaktionen damaliger Autoren exemplarisch untersucht, um schließlich eine Bewertung der damaligen Situation geben zu können. Die literarische Grundlage liegt zum einen in den Arbeiten zum Bildungsbürgertum des Arbeitskreises der modernen Sozialgeschichte von 1980 bis 1987, sowie auf den Untersuchungen von Helmut Fries in seinem Werk „Die Große Katharsis“ und den Ausführungen Jürgens und Wolfgangs von Ungern-Starnberg bezüglich des Aufrufs an die Kulturwelt.
Die Ausweitung der Untersuchung auf alle teilnehmenden Kriegsparteien muss formatbedingt ebenso geschuldet bleiben, wie eine stark detaillierte Erforschung der folgenden Sachverhalte. Die hier angestellten Überlegungen können deswegen nur einen eingeschränkten Zugang leisten.
Inhaltverzeichnis
1. Einleitung
2. Das deutsche Bildungsbürgertum
3. Der Kulturelle Krieg
3.1 Die geistige Mobilmachung
3.2. Ursache und Motivation
4. Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
„…Seid Ihr die Enkel Goethes oder die Attilas?“[1] So lautete die Frage des französischen Schriftstellers Rolland Romain an seinen deutschen Kollegen Gerhart Hauptmann, welche in einem offen Brief in der französischen Presse zu lesen war, nachdem die Deutschen zu Beginn des Ersten Weltkrieges das neutrale Belgien überfallen hatten. Die Frage und ihre implizierte Provokation zeigen, dass der Erste Weltkrieg nicht nur an der militärischen, sondern auch an einer geistigen und kulturellen Front geführt wurde. Schon am Tag des Kriegsausbruches wurden auf Seiten aller Kriegsparteien zahlreiche Schriften, Reden und Gedichte veröffentlicht, welche dem Krieg positiv gesinnt waren und deren Menge mit jedem weitern Kriegstag anstieg. Ihre Inhalte und Autoren, sowie deren Beweggründe bilden die Basis dieser Arbeit, welche aus deutscher Perspektive einen Einblick in die Thematik der kulturellen Auseinandersetzung geben soll. In diesem Zusammenhang wird das deutsche Bildungsbürgertum eine zentrale Rolle einnehmen, da hier ein wesentlicher Anteil der beteiligten Autoren vermutet wird.
Strukturell scheint es angebracht zunächst eine Definition dessen zu geben, was der Begriff deutsches Bildungsbürgertum meint beziehungsweise was er nicht meint. Anschließend wird die These des Bildungsbürgertums als Hauptproduzent geprüft. Unter Einbeziehung der damaligen Ereignisse werden dann Motivationen sowie Werke und Reaktionen damaliger Autoren exemplarisch untersucht, um schließlich eine Bewertung der damaligen Situation geben zu können. Die literarische Grundlage liegt zum einen in den Arbeiten zum Bildungsbürgertum des Arbeitskreises der modernen Sozialgeschichte von 1980 bis 1987, sowie auf den Untersuchungen von Helmut Fries in seinem Werk „Die Große Katharsis“ und den Ausführungen Jürgens und Wolfgangs von Ungern-Starnberg bezüglich des Aufrufs an die Kulturwelt.
Die Ausweitung der Untersuchung auf alle teilnehmenden Kriegsparteien muss formatbedingt ebenso geschuldet bleiben, wie eine stark detaillierte Erforschung der folgenden Sachverhalte. Die hier angestellten Überlegungen können deswegen nur einen eingeschränkten Zugang leisten.
2. Das deutsche Bildungsbürgertum
Soll das deutsche Bildungsbürgertum als Akteur bezeichnet werden, so muss es als erstes näher spezifiziert werden. Dies liegt nicht zu letzt daran, dass dieser Begriff keineswegs so eindeutig allgemein gültig ist, wie es zunächst erscheinen mag. Es geht hierbei nicht darum die Existenz beziehungsweise das Handeln der Leute in Frage zu stellen, die dieser Gruppe angehören sollen, sondern um die Nennung und Überprüfung der Zuordnungskriterien. Eine solche Überprüfung wurde in den achtziger Jahren von dem Arbeitskreis moderne Sozialgeschichte unternommen. Dieser Stellte die Hypothese in den Vordergrund, dass es sich bei dem deutschen Bildungsbürgertum um eine soziale Gruppierung handle, welche auf deutscher Seite seit Beginn des 18. Jahrhunderts in Erscheinung getreten sei. Diese Gruppierung zeichne sich dadurch aus, dass sie aus Menschen verschiedener Klassen mit unterschiedlichen Berufen zusammengesetzt sei, weshalb auch unterschiedliche Besitz, Finanz und Lohnverhältnisse innerhalb der Gruppierung existierten. Der Schlüssel zur Gemeinsamkeit sei die anerkannte Bildung und deren Gebrauch. Hierbei seien diejenigen gebildeten Bürger ausgeschlossen, welche die Bildung und ihre Verwertung nicht als Lebensziel beziehungsweise Lebensgrundlage nutzten. Leute, die als Bildungsbürger bezeichnet werden können seien demnach zum Beispiel: akademische Beamte, Richter, Pfarrer, Professoren, Lehrer, Ingenieure etc.[2]. Diese Hypothese konnte von den Teilnehmern des Arbeitskreises mit Hilfe einer Klassenanalyse der damaligen Gesellschaft von den Anfängen des 18. Jahrhunderts bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts empirisch bestätigt werden.[3] Es konnte demnach bewiesen werden, dass die vermuteten Zusammenhänge existieren, was hier genügen soll, um den Begriff als für diese Arbeit ausreichend definiert zu betrachten. Die internationale Unterscheidung ergibt sich nicht aus der Definition, welche in dieser allgemeinen Haltung größten Teils auch auf Bildungsbürger aus Frankreich oder England zutrifft, sondern durch die staatsspezifischen Unterschiede der Definierten selbst. Ein Beispiel wären hier die Unterschiede in Ausbildung und Ausübung der akademischen Beamtenlaufbahn zwischen Frankreich und dem Kaiserreich.[4]
Zeitlich relevant für diese Untersuchung ist die Situation des späten wilhelminischen Bürgertums bis zum Ende des Ersten Weltkrieges. Der Sozialhistoriker Konrad H. Jarausch sieht das Bildungsbürgertum zu Beginn des 20. Jahrhunderts in einer Krise bedingt durch sein rasches Wachstum in jenen Jahren.[5] Diese Krise wog besonders schwer auf Seiten der Geisteswissenschaften, da die späte aber dafür umso rasantere Wandlung in einen Industriestaat die neunen Naturwissenschaften stärker denn je in den Vordergrund rückte.[6] Diese Krise führte laut Jarausch zu einem Zersetzen in die eigentlichen Berufsgruppen. Dieses endete abrupt mit dem Beginn des Krieges, welcher sie wieder näher zusammenrücken lässt.[7]
[...]
[1] Roman, Rolland, Frankreich 29.08.1914, zitiert nach: http://images.zeit.de/text/2001/36/Ich_moechte_tot_sein; zuletzt gesehen: 28.06.08.
[2] Kocka, Jürgen, Bildungsbürgertum. Gesellschaftliche Formation oder Historikerkonstruckt? In: Kocka J. (Hrsg): Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert Teil IV, Band 48, Stuttgart 1989, S. 9.
[3] Die ausführliche Begründung findet sich bei Kocka s.o.
[4] Für eine vertiefende Diskussion der Definition siehe: Vondung, Klaus (Hrsg.), Das wilhelminische Bildungsbürgertum. Zur Sozialgeschichte seiner Ideen, Göttingen 1976.
[5] Jarausch, Konrad H., Die Kriese des deutschen Bildungsbürgertums im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts, in: Kocka J. (Hrsg): Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert Teil IV, Band 48, Stuttgart 1989, S. 180-205, hier: S. 180ff.
[6] Vgl. Fries, Helmut, die große Katharsis. Der Erste Weltkrieg in der Sicht deutscher Dichter und Gelehrter, Konstanz 1994, Band1, S. 31.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der zentrale Fokus dieses Textes?
Der Text untersucht die Rolle des deutschen Bildungsbürgertums im Ersten Weltkrieg, insbesondere im Hinblick auf die geistige und kulturelle Auseinandersetzung. Er analysiert die Motivationen und Werke von Autoren aus dieser Schicht, die den Krieg befürworteten oder unterstützten.
Wer war Rolland Romain und was war seine Frage?
Rolland Romain war ein französischer Schriftsteller, der seinen deutschen Kollegen Gerhart Hauptmann fragte: „…Seid Ihr die Enkel Goethes oder die Attilas?“ Diese Frage, die in einem offenen Brief veröffentlicht wurde, deutete auf die kulturelle und intellektuelle Auseinandersetzung während des Ersten Weltkriegs hin.
Was wird unter dem Begriff "deutsches Bildungsbürgertum" verstanden?
Der Text definiert das deutsche Bildungsbürgertum als eine soziale Gruppierung, die seit dem 18. Jahrhundert in Erscheinung trat. Diese Gruppierung setzt sich aus Menschen verschiedener Klassen und Berufe zusammen, deren Gemeinsamkeit in ihrer anerkannten Bildung und deren Gebrauch liegt. Akademische Beamte, Richter, Pfarrer, Professoren, Lehrer und Ingenieure sind Beispiele für Personen, die dem Bildungsbürgertum zugerechnet werden können.
Welche Krise erlebte das Bildungsbürgertum zu Beginn des 20. Jahrhunderts?
Laut dem Sozialhistoriker Konrad H. Jarausch erlebte das Bildungsbürgertum zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Krise, die durch sein rasches Wachstum und die zunehmende Bedeutung der Naturwissenschaften im Zuge der Industrialisierung bedingt war. Dies führte zu einer Zersetzung in die eigentlichen Berufsgruppen, welche durch den Ersten Weltkrieg unterbrochen wurde.
Welche Werke und Autoren werden als Grundlage für die Analyse herangezogen?
Die Analyse stützt sich auf Arbeiten des Arbeitskreises moderne Sozialgeschichte, die Untersuchungen von Helmut Fries in „Die Große Katharsis“ sowie die Ausführungen von Jürgen und Wolfgang von Ungern-Starnberg bezüglich des Aufrufs an die Kulturwelt.
Welche Einschränkungen hat die Untersuchung?
Die Untersuchung beschränkt sich aufgrund des Formats auf eine deutsche Perspektive und eine eingeschränkte Erforschung der Sachverhalte. Eine Ausweitung auf alle teilnehmenden Kriegsparteien und eine detaillierte Analyse sind nicht möglich.
- Quote paper
- Benjamin Hinsch (Author), 2008, Dichter Denker und Barbaren - Reden, Schriften und Gedichte: Die kulturelle Front des Ersten Weltkrieges, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/115350