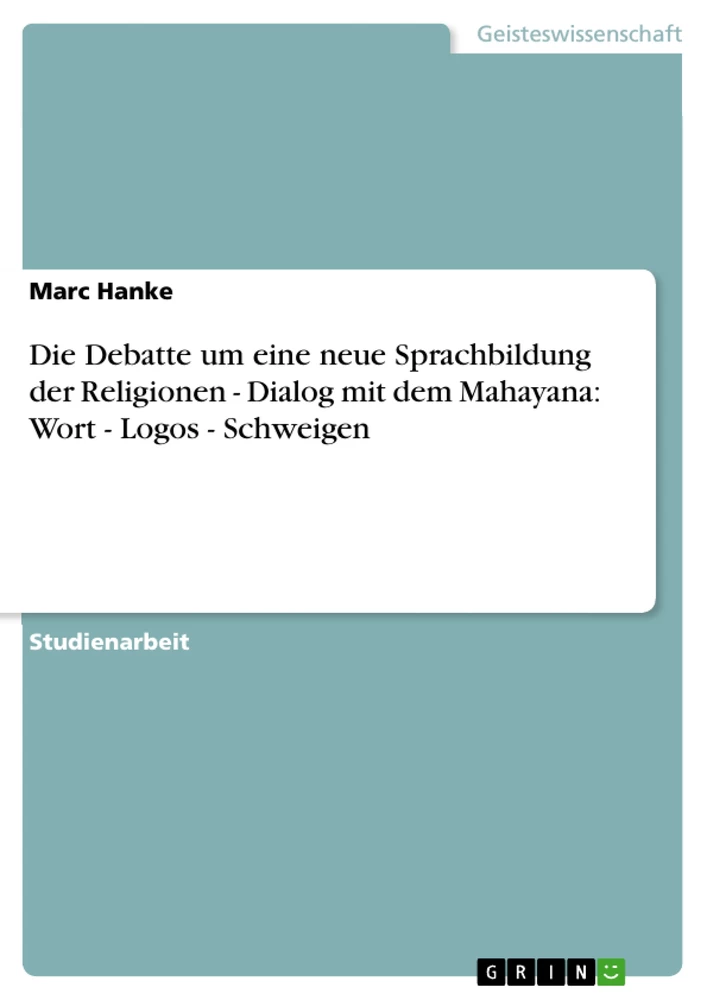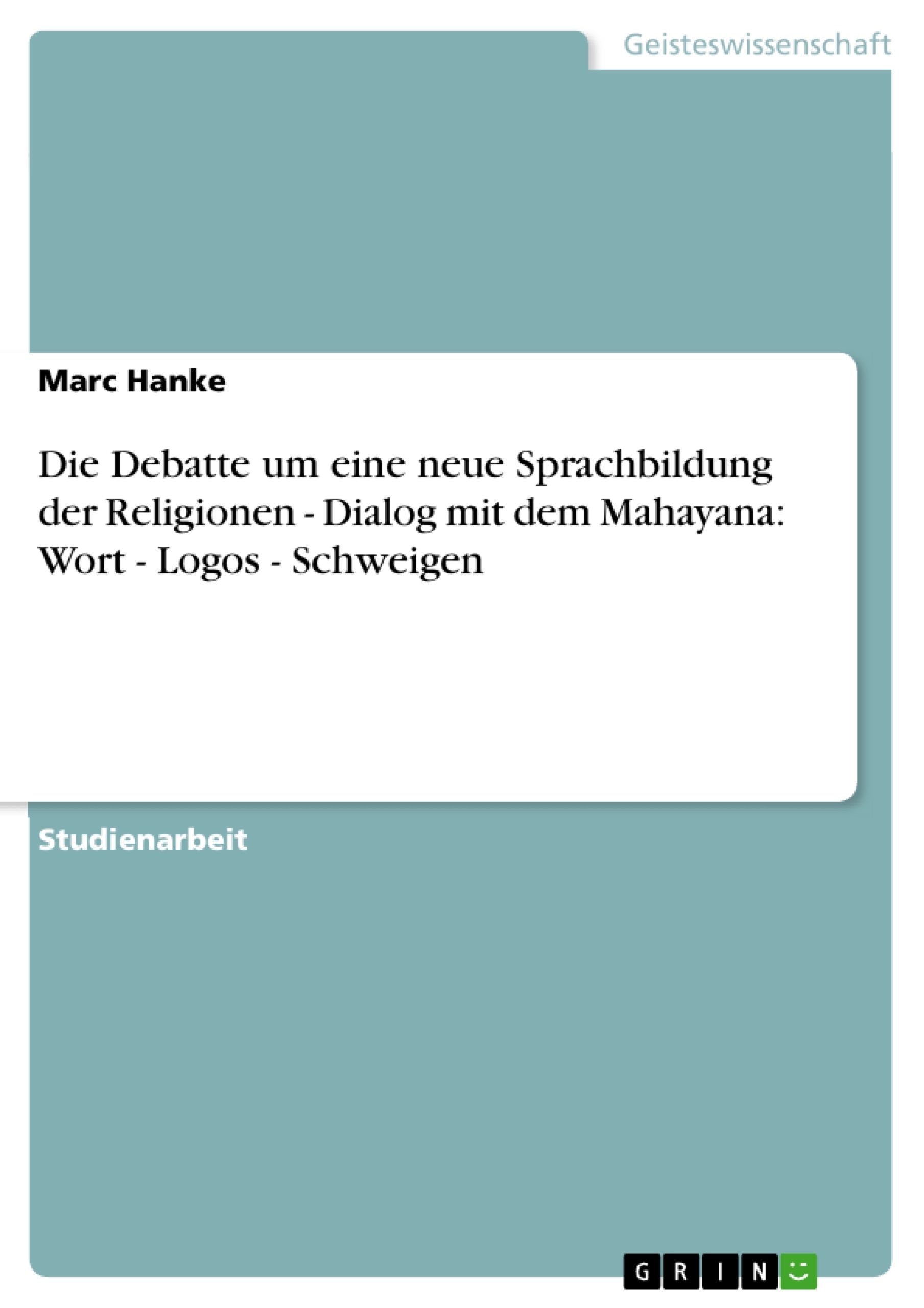1. Einleitung
In der vorliegenden Arbeit werde ich einen Abschnitt aus von Brücks und Whalens Werk „Buddhismus und Christentum“ bearbeiten. Das Buch als Ganzes gilt als ein äußerst wertvoller Beitrag zur gegenwärtigen Begegnung zwischen den beiden Weltreligionen.
Zur Bearbeitung habe ich einen Teil aus „Die Debatte um eine neue Sprachbildung der Religionen – Dialog mit dem Mahayana“ gewählt, namentlich „Wort – Logos – Schweigen“.
Nach einer Zusammenfassung der wichtigsten Aussagen des Textes, denen naturgemäß der größere Umfang zuteil werden wird und bei der ich die Gliederung des Kapitels nicht direkt übernehmen, sondern das Kapitel als einen, zusammenhängenden Text behandeln werde, folgt der letzte Teil, der meinen Kommentar beinhaltet.
Manche Diagramme sowie einige zentrale Aussagen des Textes habe ich unverändert übernommen, da ihr Inhalt stark komprimiert ist und Wesentliches gut veranschaulicht.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zusammenfassung des Textes
- Kommentar
- Quellen- und Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert einen Abschnitt aus dem Werk „Buddhismus und Christentum“ von von Brück und Whalen. Sie befasst sich mit der Debatte um eine neue Sprachbildung der Religionen im Dialog mit dem Mahayana, speziell mit dem Thema „Wort – Logos – Schweigen“. Der Text untersucht die Frage, wie das Wort-zentrierte Christentum und der auf die Unaussprechlichkeit des Nirvana fokussierte Buddhismus miteinander in Dialog treten können.
- Verhältnis von Sprache und Wirklichkeit im buddhistisch-christlichen Dialog
- Der Zen-Buddhismus als „Lehre außerhalb von Worten“
- Die Frage, ob Sprache überhaupt Wahrheit ausdrücken kann
- Schwierigkeiten im christlich-buddhistischen Dialog und deren Ursachen
- Versuche zur Vereinigung der Sprachen der Bibel und des mondo
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Arbeit befasst sich mit einem Abschnitt aus von Brücks und Whalens Werk „Buddhismus und Christentum“. Der Fokus liegt auf dem Kapitel „Wort – Logos – Schweigen“ aus dem Teil „Die Debatte um eine neue Sprachbildung der Religionen - Dialog mit dem Mahayana“. Nach einer Zusammenfassung der wichtigsten Aussagen des Kapitels folgt ein Kommentar des Autors.
2. Zusammenfassung des Textes
Der Text analysiert das Verhältnis von Sprache und Wirklichkeit im buddhistisch-christlichen Dialog. Die Autoren betrachten den Zen-Buddhismus als exemplarisch für den Buddhismus im Allgemeinen, da er als „Lehre außerhalb von Worten“ gilt. Sie stellen fest, dass der Buddha das Nirvana als unaussprechlich lehrte, da Sprache die Wirklichkeit aufgrund ihrer Bewegung und gegenseitigen Abhängigkeit nicht adäquat beschreiben kann. Im Gegensatz dazu betont das Christentum das Wort (Logos) als zentrales Element. Die Autoren beleuchten die unterschiedlichen Ansätze des Dialogs zwischen Christen und Buddhisten und die Schwierigkeiten, die durch diese Unterschiede entstehen.
3. Kommentar
Dieser Abschnitt enthält den persönlichen Kommentar des Autors zur behandelten Thematik. Er analysiert die Argumentation des Textes und stellt eigene Gedanken und Interpretationen dar.
Schlüsselwörter
Buddhismus, Christentum, Dialog, Sprache, Wirklichkeit, Nirvana, Zen-Buddhismus, Wort, Logos, Schweigen, mondo, Kadowaki, Meister Eckhart, mystisches Christentum.
Häufig gestellte Fragen
Wie unterscheidet sich das Sprachverständnis im Buddhismus und Christentum?
Das Christentum ist wortzentriert (Logos), während der Buddhismus, besonders der Zen-Buddhismus, die Unaussprechlichkeit der Wahrheit (Nirvana) betont.
Was ist der Zen-Buddhismus als „Lehre außerhalb von Worten“?
Er lehrt, dass die höchste Wirklichkeit nicht durch Sprache, sondern nur durch unmittelbare Erfahrung und Schweigen erfasst werden kann.
Können Worte die absolute Wahrheit ausdrücken?
Die Arbeit untersucht die buddhistische Skepsis gegenüber der Sprache, da diese die Wirklichkeit aufgrund ihrer ständigen Veränderung nur unzureichend abbilden kann.
Wer sind wichtige Denker in diesem interreligiösen Dialog?
Genannt werden unter anderem Meister Eckhart für die christliche Mystik sowie Kadowaki für den Brückenschlag zum Zen.
Was bedeutet das Thema „Wort – Logos – Schweigen“?
Es beschreibt das Spannungsfeld zwischen der biblischen Offenbarung durch das Wort und der meditativen Erfahrung der Stille im Mahayana-Buddhismus.
- Quote paper
- Marc Hanke (Author), 2002, Die Debatte um eine neue Sprachbildung der Religionen - Dialog mit dem Mahayana: Wort - Logos - Schweigen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11536