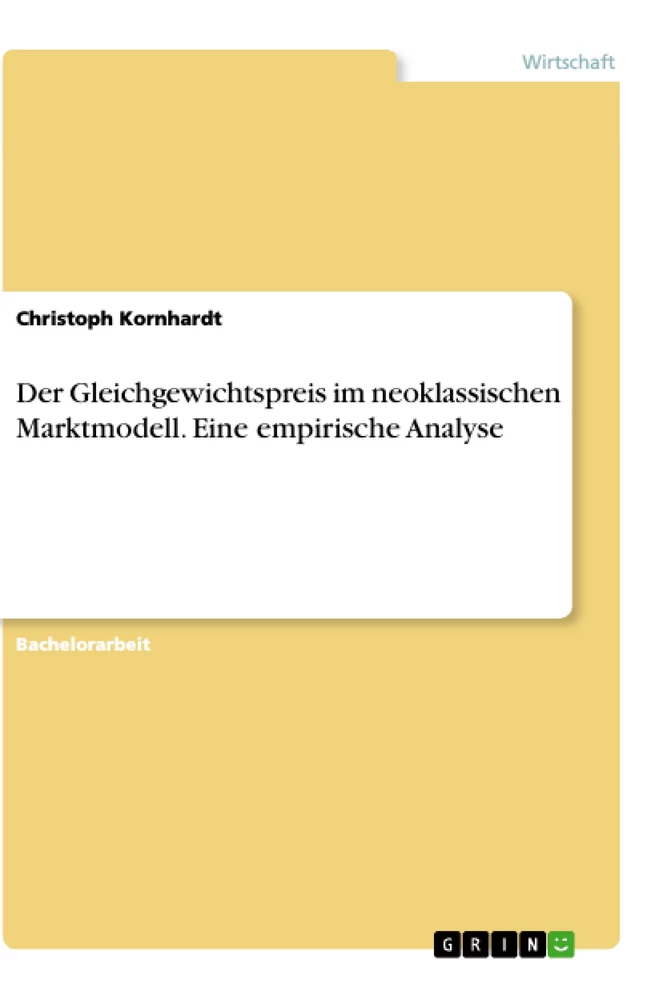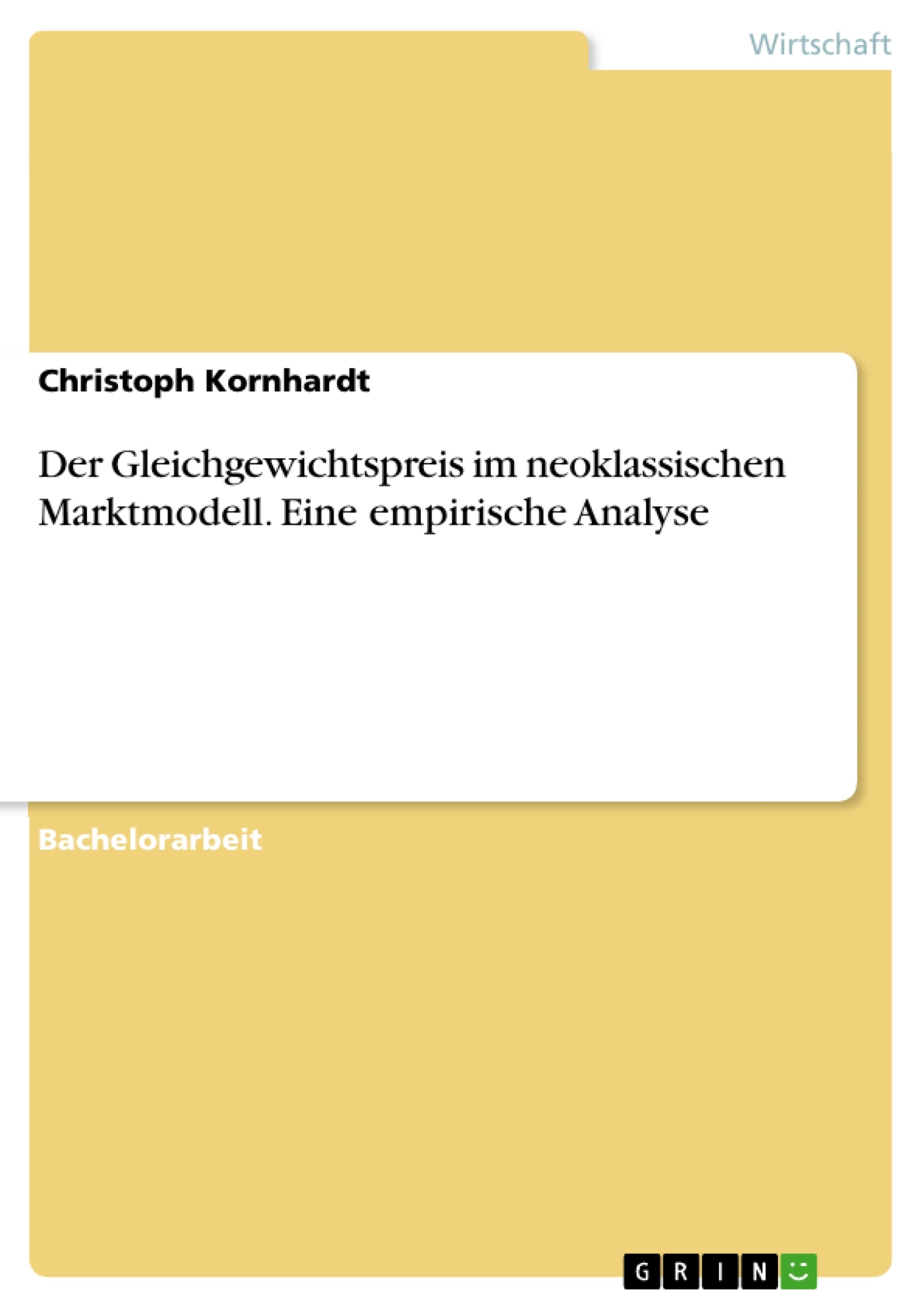In dieser Arbeit wird versucht, die Theorie eines Gleichgewichtspreises mittels einer empirischen Untersuchung zu analysieren. Laut der neoklassischen Markttheorie in Verbindung mit dem Gleichgewichtspreis, sollten alle Anbieter eines homogenen Gutes in einem Wirtschaftsraum denselben Preis auf einem vollkommenen Markt verlangen. Sobald ein Anbieter einen höheren Preis inseriert, müssten sich alle Konsumenten an dem günstigsten Preis orientieren. Aus den bereits genannten Stichworten "empirische Untersuchung", "neoklassische Markttheorie" und "Gleichgewichtspreis" lässt sich die relevante Forschungsfrage für diese wissenschaftliche Arbeit formulieren. Ist der in der Neoklassik postulierte Gleichgewichtspreis in der empirischen Wirklichkeit tatsächlich zu beobachten?
Um diesen Sachverhalt genauer zu beleuchten, wird das Beobachtungsverfahren für diese Arbeit angewandt, um primäre Daten zu gewinnen. Es finden Preisvergleiche in den örtlichen Einzelhandelsgeschäften zu verschiedenen homogenen Produkten statt. Als Wirtschaftsraum dieser Untersuchung wurde die Stadt Einbeck in Niedersachen gewählt. Nachdem alle Preise aus diesem Wirtschaftsraum für ein bestimmtes Produkt gesammelt wurden, findet ein digitaler Preisvergleich statt. Hierbei wird im Internet über die Preisvergleichsseite idealo.de nach Anbietern für das entsprechende Produkt gesucht. Die Preise werden per Bildschirmfoto gespeichert und anschließend mit den Daten der örtlichen Händler ergänzt. Dementsprechend wird die Methodik des Beobachtungsverfahrens angewandt. Nachdem alle Daten zu einem homogenen Produkt gesammelt wurden, wird der eigentliche Preisvergleich durchgeführt. Hierbei werden die einzelnen Preise miteinander verglichen und in Folge darauf analysiert. Alle Daten für ein Produkt werden in demselben Zeitraum erhoben. Dies bedeutet, dass alle Daten an einem Stichtag gesammelt werden, damit keine nachträglichen Preisänderungen die Ergebnisse verfälschen können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Gegenstand
- 1.2. Fragestellung
- 1.3. Methodik
- 1.4. Aufbau
- 2. Literaturkapitel
- 3. Das Marktgleichgewicht
- 3.1. Kernelemente eines Marktes
- 3.2. Angebot und Nachfrage
- 3.2.1. Angebot
- 3.2.2. Nachfrage
- 3.2.3. Zusammenfassung
- 3.3. Gleichgewichtspreis
- 3.4. Zusammenfassung
- 4. Von der Klassik zur Neoklassik
- 4.1. Klassik
- 4.2. Neoklassik
- 4.3. Zusammenfassung
- 5. Empirische Studie
- 5.1. Empirische Wirtschaftsforschung
- 5.2. Forschungsfrage
- 5.3. Beobachtungsplan
- 5.3.1. Beobachtungsgegenstand
- 5.3.2. Beobachtungsdurchführung
- 5.3.3. Zusammenfassung
- 5.4. Zusammenfassung
- 6. Produkte
- 6.1. funny-frisch
- 6.2. Pringles
- 6.3. Géramont
- 6.4. Heineken
- 6.5. Milka Haselnuss
- 6.6. Red Bull
- 6.7. Nintendo Switch
- 6.8. JBL Flip 5
- 6.9. PlayStation 4 Controller
- 6.10. Fifa 21
- 6.11. Analyse der gesammelten Daten
- 6.12. Zusammenfassung
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht empirisch die Gültigkeit des neoklassischen Marktmodells und dessen Vorhersage eines eindeutigen Gleichgewichtspreises für homogene Güter im Wirtschaftsraum Einbeck. Die Arbeit analysiert Preisunterschiede verschiedener Produkte und deren Beziehung zur Anzahl digitaler Einzelhändler.
- Überprüfung der neoklassischen Marktmodell-Theorie in der Praxis.
- Analyse von Preisstreuung bei homogenen Produkten.
- Der Einfluss digitaler Einzelhändler auf die Preisbildung.
- Empirische Wirtschaftsforschung und Methoden der Datenanalyse.
- Vergleich der Ergebnisse mit bestehenden Theorien der Preisdispersion.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Bachelorarbeit ein. Es wird der Gegenstand der Untersuchung, die Forschungsfrage, die angewandte Methodik und der Aufbau der Arbeit erläutert. Der Fokus liegt auf der Überprüfung der neoklassischen Theorie des Gleichgewichtspreises anhand einer empirischen Studie in Einbeck. Die Fragestellung zielt darauf ab, zu untersuchen, ob in der Realität ein eindeutiger Gleichgewichtspreis für homogene Produkte existiert.
2. Literaturkapitel: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über relevante wissenschaftliche Literatur zum Thema Preisdispersion und Marktgleichgewicht. Es werden verschiedene Studien und Theorien vorgestellt, die sich mit Preisunterschieden bei scheinbar identischen Produkten auseinandersetzen und die theoretischen Grundlagen für die empirische Untersuchung legen. Die analysierten Studien untersuchen den Einfluss von Faktoren wie Suchkosten, Marktstruktur und Internet auf die Preisbildung.
3. Das Marktgleichgewicht: Dieses Kapitel beschreibt die Kernelemente eines Marktes, Angebot und Nachfrage, und erklärt das Konzept des Gleichgewichtspreises im neoklassischen Modell. Es wird detailliert auf die Zusammenhänge zwischen Angebot, Nachfrage und Preis eingegangen. Die Zusammenfassung fasst die theoretischen Grundlagen des neoklassischen Marktmodells zusammen, auf denen die empirische Untersuchung aufbaut.
4. Von der Klassik zur Neoklassik: Dieses Kapitel vergleicht die klassische und neoklassische Wirtschaftstheorie im Hinblick auf das Verständnis von Marktgleichgewicht und Preisbildung. Es werden die Unterschiede in den Annahmen und Modellen herausgearbeitet, um den Kontext der neoklassischen Theorie, die im Mittelpunkt der Arbeit steht, zu verdeutlichen. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung des Konzepts des Marktgleichgewichts über die Zeit.
5. Empirische Studie: Dieses Kapitel beschreibt die empirische Untersuchung, die durchgeführt wurde, um die Forschungsfrage zu beantworten. Es erläutert die Forschungsmethodik, den Beobachtungsplan, die Auswahl der Produkte und die Durchführung der Datenerhebung. Die Zusammenfassung dieses Kapitels fasst die methodischen Ansätze der empirischen Studie zusammen und bereitet den Weg zur Präsentation der Ergebnisse.
6. Produkte: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung für zehn verschiedene Produkte. Für jedes Produkt werden die beobachteten Preise und die daraus berechnete Standardabweichung dargestellt und analysiert. Die detaillierte Analyse der einzelnen Produkte dient der Überprüfung der Hypothese eines eindeutigen Gleichgewichtspreises und der Erörterung des Einflusses der Digitalisierung auf die Preisstreuung.
Schlüsselwörter
Neoklassisches Marktmodell, Gleichgewichtspreis, Preisdispersion, Empirische Wirtschaftsforschung, Homogene Güter, Digitale Einzelhändler, Suchkosten, Einbeck, Preisstreuung, Marktgleichgewicht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Empirische Überprüfung des neoklassischen Marktmodells in Einbeck
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht empirisch die Gültigkeit des neoklassischen Marktmodells und dessen Vorhersage eines eindeutigen Gleichgewichtspreises für homogene Güter im Wirtschaftsraum Einbeck. Die Arbeit analysiert Preisunterschiede verschiedener Produkte und deren Beziehung zur Anzahl digitaler Einzelhändler.
Welche Forschungsfrage wird in der Arbeit behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Existiert in der Realität ein eindeutiger Gleichgewichtspreis für homogene Produkte, wie vom neoklassischen Marktmodell vorhergesagt?
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine empirische Forschungsmethodik. Es werden Preisdaten verschiedener Produkte in Einbeck erhoben und analysiert, um die Gültigkeit des neoklassischen Marktmodells zu überprüfen. Die Analyse umfasst die Betrachtung der Preisstreuung und den Einfluss digitaler Einzelhändler.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Überprüfung der neoklassischen Marktmodell-Theorie in der Praxis; Analyse von Preisstreuung bei homogenen Produkten; Der Einfluss digitaler Einzelhändler auf die Preisbildung; Empirische Wirtschaftsforschung und Methoden der Datenanalyse; Vergleich der Ergebnisse mit bestehenden Theorien der Preisdispersion.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Literaturkapitel, Das Marktgleichgewicht, Von der Klassik zur Neoklassik, Empirische Studie, Produkte und Fazit. Die Einleitung beschreibt den Gegenstand, die Fragestellung, die Methodik und den Aufbau der Arbeit. Das Literaturkapitel gibt einen Überblick über relevante wissenschaftliche Literatur. Das Kapitel "Das Marktgleichgewicht" erklärt das neoklassische Marktmodell. "Von der Klassik zur Neoklassik" vergleicht beide Theorien. Das Kapitel "Empirische Studie" beschreibt die Methodik der empirischen Untersuchung. Das Kapitel "Produkte" präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung für zehn verschiedene Produkte. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Produkte wurden in der empirischen Studie untersucht?
Die empirische Studie untersucht zehn verschiedene Produkte: funny-frisch, Pringles, Géramont, Heineken, Milka Haselnuss, Red Bull, Nintendo Switch, JBL Flip 5, PlayStation 4 Controller und Fifa 21.
Wie werden die Ergebnisse der empirischen Studie präsentiert?
Die Ergebnisse der empirischen Studie werden im Kapitel "Produkte" präsentiert. Für jedes Produkt werden die beobachteten Preise und die daraus berechnete Standardabweichung dargestellt und analysiert. Die Analyse dient der Überprüfung der Hypothese eines eindeutigen Gleichgewichtspreises und der Erörterung des Einflusses der Digitalisierung auf die Preisstreuung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Neoklassisches Marktmodell, Gleichgewichtspreis, Preisdispersion, Empirische Wirtschaftsforschung, Homogene Güter, Digitale Einzelhändler, Suchkosten, Einbeck, Preisstreuung, Marktgleichgewicht.
Wo findet man die detaillierte Beschreibung der Methodik?
Die detaillierte Beschreibung der Methodik der empirischen Studie findet sich im Kapitel 5 ("Empirische Studie") der Bachelorarbeit. Dieses Kapitel erläutert die Forschungsmethodik, den Beobachtungsplan, die Auswahl der Produkte und die Durchführung der Datenerhebung.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit der Arbeit (Kapitel 7) fasst die Ergebnisse der empirischen Untersuchung zusammen und bewertet die Gültigkeit des neoklassischen Marktmodells im untersuchten Kontext. Es wird diskutiert, inwieweit die Ergebnisse die Hypothese eines eindeutigen Gleichgewichtspreises bestätigen oder widerlegen und der Einfluss digitaler Einzelhändler auf die Preisbildung bewertet.
- Citar trabajo
- Christoph Kornhardt (Autor), 2021, Der Gleichgewichtspreis im neoklassischen Marktmodell. Eine empirische Analyse, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1153709