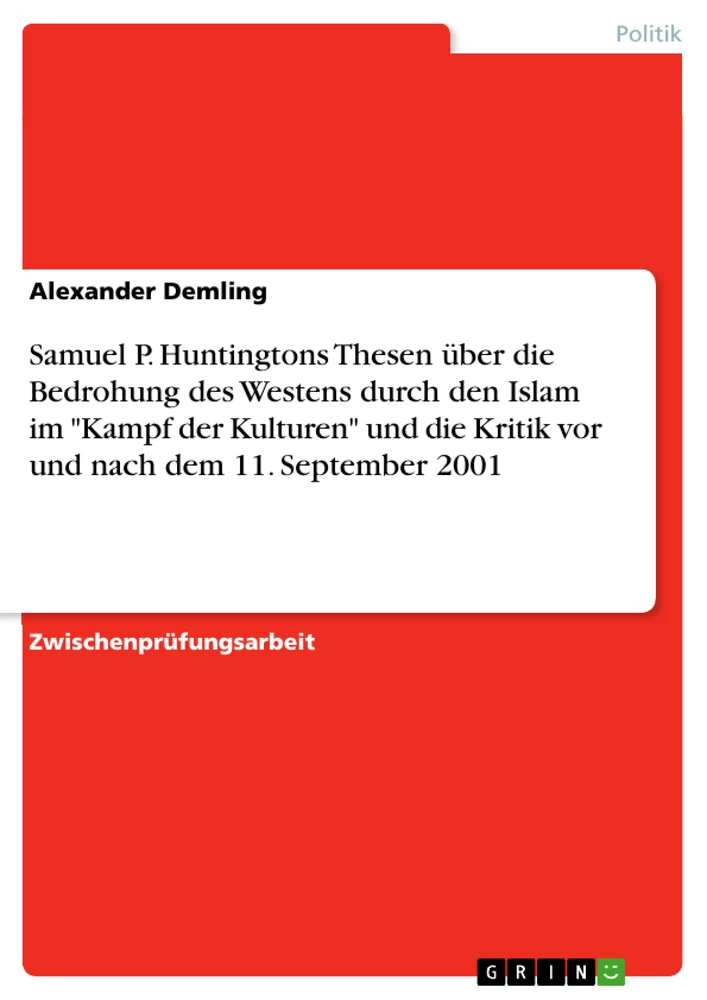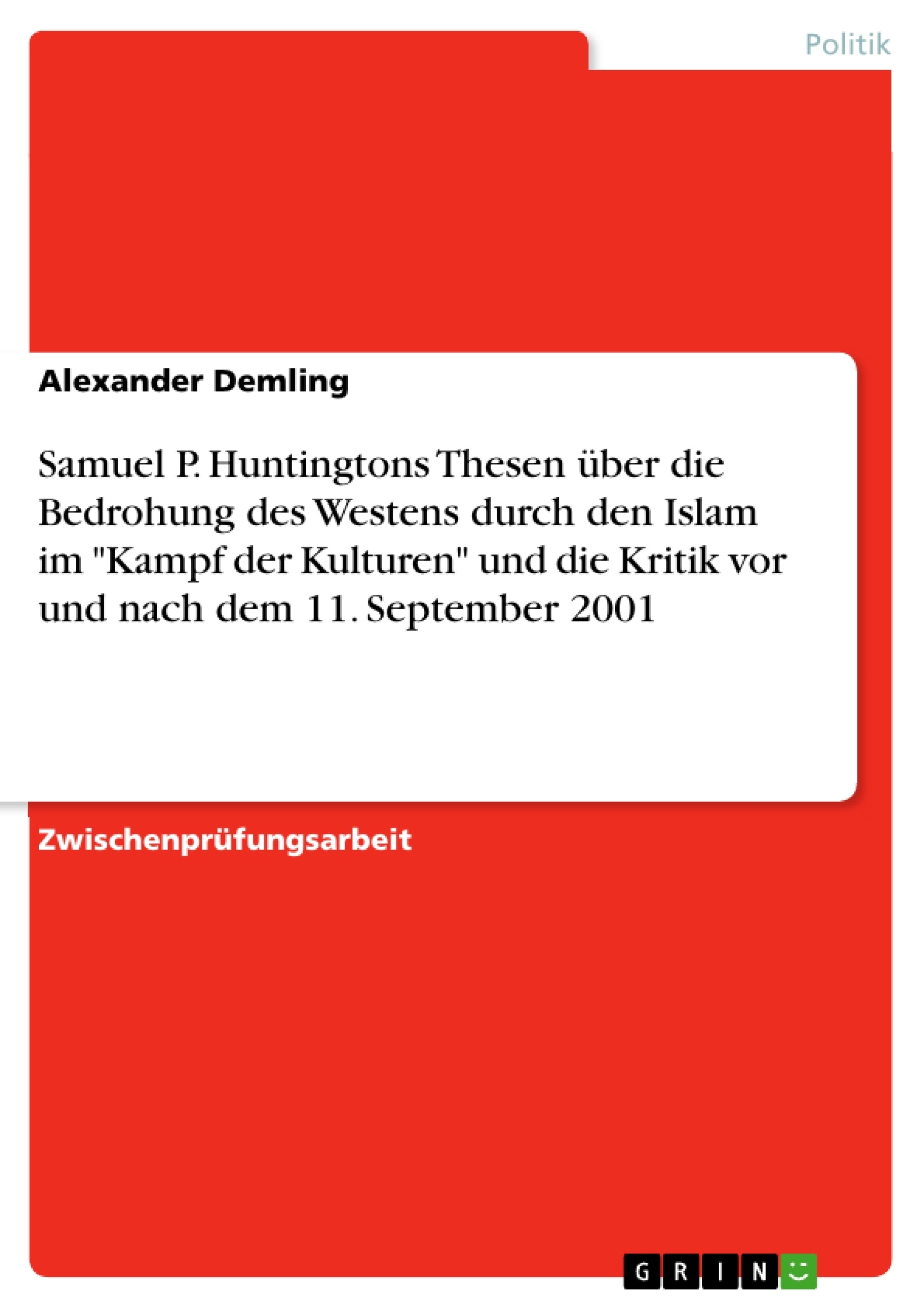Seit dem fünften Jahrhundert vor Christus, als Herodot in seinen "Historien" unter dem Eindruck der persischen Niederlage in den Perserkriegen die These vom zyklischen Auf- und Abstieg von Großmächten entwickelte, haben bedeutende historische Ereignisse immer wieder die Forschung im Bereich der Internationalen Beziehungen angeregt und veränderte weltpolitische Konstellationen zur Entwicklung neuer Theorien geführt. So war nach dem Ende des Kalten Krieges abzusehen, dass Politikwissenschaftler neue Prognosen darüber aufstellen würden, wie die Welt nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion aussehen könnte. Die Aufsehen erregendste und bis heute am häufigsten rezipierte These dieser Zeit ist die vom "Kampf der Kulturen", die Samuel Huntington, Politologe an der Harvard University, 1993 in einem Artikel in der Zeitschrift "Foreign Affairs" und drei Jahre später in dem Buch "Kampf der Kulturen - Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert" formulierte. Huntingtons Befund, dass kulturelle Gegensätze die Weltpolitik nach Ende der Ost-West-Konfrontation bestimmen und den Westen in blutige Konfrontationen mit anderen Kulturen, allen voran dem Islam, verwickeln würde, führte zu einer über Jahre engagiert geführten Debatte in der wissenschaftlichen Welt und spaltete sie in Befürworter und entschiedene Kritiker des Paradigmas.
Inhaltsverzeichnis
- Zur Bedeutung von Samuel Huntingtons "Kampf der Kulturen"
- Huntingtons Thesen im Bezug auf die Bedrohung des Westens durch den Islam
- "Zusammenprall" von Islam und Westen
- Handlungsanweisungen an die Politik
- Die Kritik an Huntingtons Thesen
- Die Ungenauigkeit des Kulturbegriffes
- Der Islam als einheitlicher Akteur
- Der "Kampf der Kulturen" als sich selbst erfüllende Prophezeihung
- Gegenargumente zum "Kampf der Kulturen" auf Basis empirischer Untersuchungen
- Huntingtons Antwort auf die Kritik
- Der 11. September 2001 als Testfall des "Kampfes der Kulturen"?
- Huntingtons Bewertung der Terroranschläge
- Die wissenschaftliche Reaktion auf die Einschätzung des 11. Septembers als "Kampf der Kulturen"
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit Samuel Huntingtons Thesen zum "Kampf der Kulturen" und der Kritik, die an diesen geäußert wurde. Ziel ist es, die wesentlichen Argumente Huntingtons im Bezug auf die Bedrohung des Westens durch den Islam darzulegen und diese mit der Kritik zu konfrontieren, um so eine Reflexion über die Gültigkeit der bis heute heiß diskutierten Thesen zu ermöglichen.
- Die Bedeutung von Samuel Huntingtons These des "Kampfes der Kulturen"
- Huntingtons Analyse der Bedrohung des Westens durch den Islam
- Kritik an Huntingtons Kulturbegriff und der Vorstellung des Islam als einheitlichem Akteur
- Die Rolle des 11. Septembers 2001 im Kontext von Huntingtons Thesen
- Die wissenschaftliche Debatte um Huntingtons These und die Auswirkungen auf die amerikanische Außenpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Relevanz von Huntingtons These des "Kampfes der Kulturen" im Kontext der Geschichte der Internationalen Beziehungen und stellt die These im Detail dar. Das zweite Kapitel behandelt die Kritik an Huntingtons Thesen, die sich insbesondere auf den Kulturbegriff, die Darstellung des Islam und die These einer sich selbst erfüllenden Prophezeihung bezieht. Das dritte Kapitel analysiert den 11. September 2001 als vermeintlichen Testfall für den "Kampf der Kulturen".
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit zentralen Themen wie Kultur, Identität, Macht, Konflikt, Globalisierung, Islam, Westen, Terrorismus, amerikanische Außenpolitik und der wissenschaftlichen Debatte um Samuel Huntingtons "Kampf der Kulturen".
Häufig gestellte Fragen
Was besagt Samuel Huntingtons These vom "Kampf der Kulturen"?
Huntington behauptet, dass nach dem Kalten Krieg Konflikte nicht mehr ideologisch, sondern entlang kultureller Grenzen (Zivilisationen) ausbrechen werden.
Warum wird Huntingtons Kulturbegriff kritisiert?
Kritiker werfen ihm vor, Kulturen (wie "den Islam") als einheitliche, starre Blöcke darzustellen und interne Unterschiede sowie historischen Wandel zu ignorieren.
Gilt der 11. September 2001 als Beweis für seine Thesen?
Obwohl Huntington selbst die Anschläge als Bestätigung sah, warnen viele Wissenschaftler davor, Terrorismus als zwangsläufigen "Zusammenprall" von Religionen zu interpretieren.
Was ist das Risiko einer "sich selbst erfüllenden Prophezeiung"?
Wenn Politiker nach Huntingtons Paradigma handeln und andere Kulturen als Feinde betrachten, provozieren sie genau die Konflikte, die er vorhergesagt hat.
Welche Rolle spielt der Islam in Huntingtons Werk?
Huntington sieht im Islam die größte Herausforderung für den Westen, da er "blutige Grenzen" und unvereinbare Wertevorstellungen postuliert.
- Quote paper
- Alexander Demling (Author), 2008, Samuel P. Huntingtons Thesen über die Bedrohung des Westens durch den Islam im "Kampf der Kulturen" und die Kritik vor und nach dem 11. September 2001, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/115379