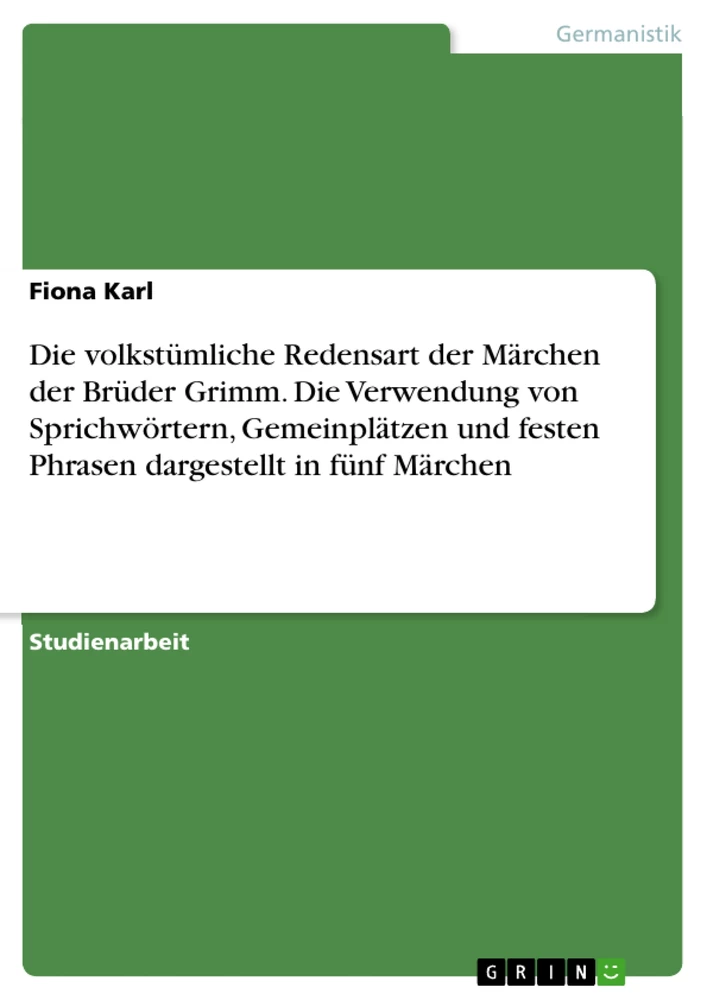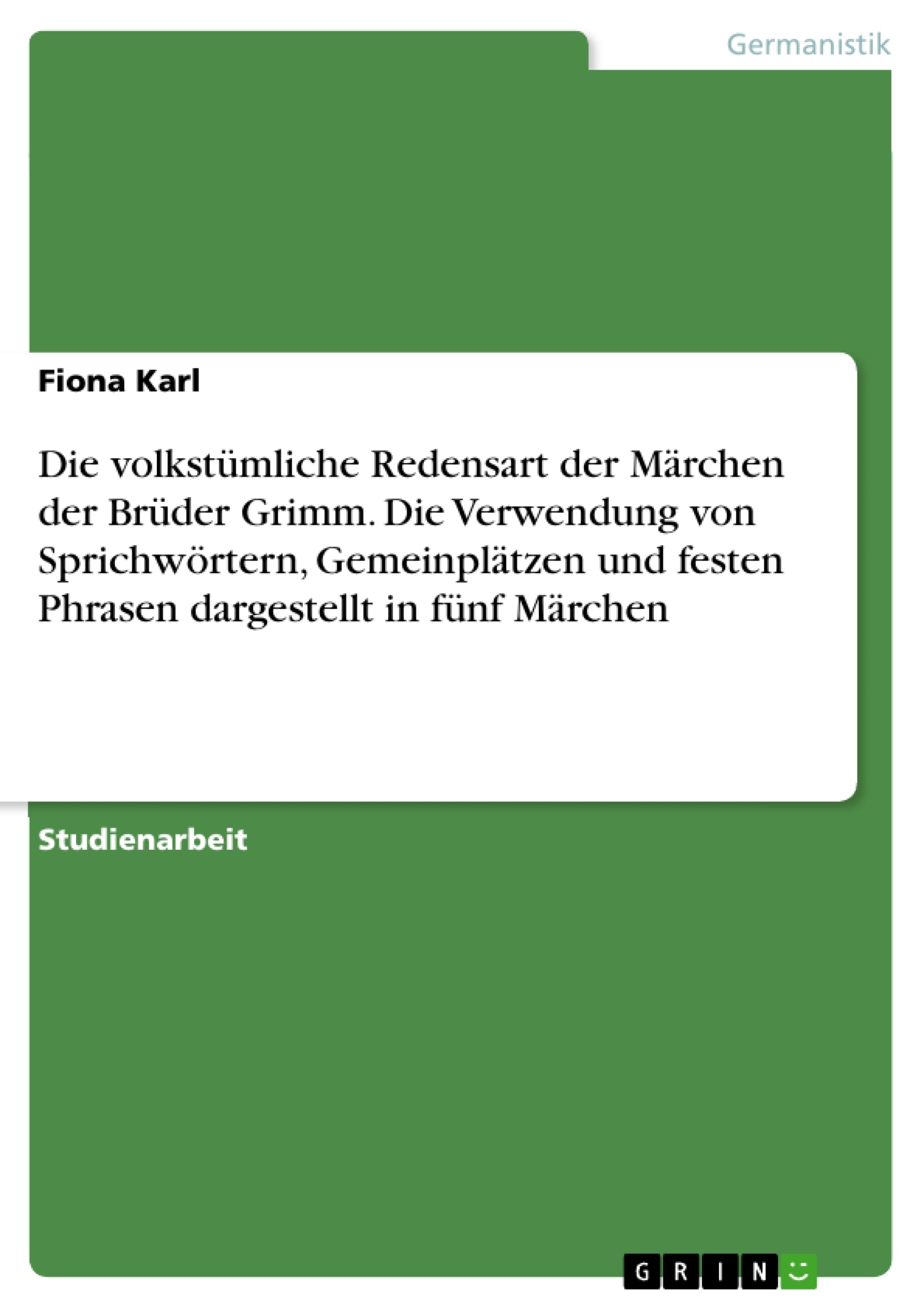Die Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm faszinieren die Menschen seit nunmehr 200 Jahren, nicht zuletzt wegen ihrer unverwechselbaren Form und Sprache. Die Einleitungsformel "Es war einmal" versetzt Leser/innen in eine zauberhafte und alltagsferne Welt und in eine Zeit, zu der das Wünschen noch geholfen hat. Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in ganz Deutschland sind diese einleitenden Formulierungen des Märchens ein Begriff, ebenso wie die Schlussformel "Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute". Doch nicht nur diese Formeln sind charakteristisch für die Grimm’schen Kinder- und Hausmärchen: die Brüder bedienten sich reichlich der deutschen sprichwörtlichen Lexik, den Redensarten des Bürgertums, zusammengefasst der volkstümlichen Redensweise der Menschen des 19. Jahrhunderts.
Die Fragen danach, inwieweit ebendiese volkstümliche Sprechweise in den Märchen der Brüder Grimm auftaucht, welcher Intention die beiden Verfasser gefolgt sind und ob Sprichworte und Phrasen zum volkstümlichen Sprachstil der Volkserzählungen gehören, sollen in dieser Arbeit geklärt werden.
Der erste Teil der vorliegenden Arbeit widmet sich den phraseologischen Typen der topischen Formeln und der festen Phrasen, die im weiteren Verlauf eine wichtige Rolle spielen werden. Hier wird insbesondere auf die Typen "Sprichwörter" und "Gemeinplätze" eingegangen. Im Folgenden werden die Märchen der Brüder Grimm vorgestellt, indem ein Überblick über die Entstehung und die Sprache gegeben wird. An dieser Stelle wird auch geklärt werden wie topische Formeln und feste Phrasen ihren Weg in die KHM gefunden haben. Beispielhaft aufgezeigt werden diese dann in den Märchen "Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich", "Hänsel und Gretel", "Aschenputtel" , "Frau Holle" und "Schneewittchen" , die nicht nur zu den bekanntesten Märchen der Brüder Grimm zählen, sondern auch zu den beliebtesten. Die dort gefundenen Phraseologismen werden schließlich nach Typen klassifiziert, semantisch analysiert und hinsichtlich ihrer pragmatischen und textuellen Funktion untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Phraseologische Typen
- Topische Formeln
- Das Sprichwort
- Gemeinplätze
- Feste Phrasen
- Das Märchen
- Überblick über Entstehung und Sprache der Märchen der Brüder Grimm
- Topische Formeln und feste Phrasen in den Märchen der Brüder Grimm
- Aufzeigung der Phraseologismen anhand ausgewählter Märchen
- „Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich“ (KHM 1)
- „Hänsel und Gretel“ (KHM 15)
- Aschenputtel (KHM 21)
- Frau Holle (KHM 24)
- Sneewittchen (KHM 53)
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht, inwiefern die Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm die volkstümliche Redensart der damaligen Epoche widerspiegeln. Ziel ist es, die Verwendung von phraseologischen Elementen in den Märchen zu analysieren und deren Funktion im Kontext der volkstümlichen Sprachkultur zu erforschen.
- Phraseologische Typen und ihre Klassifikation
- Analyse von Sprichwörtern und Gemeinplätzen in den Märchen
- Die Rolle von festen Phrasen in der Erzählstruktur
- Untersuchung der pragmatischen und textuellen Funktion von Phraseologismen
- Verbindung von Sprache und volkstümlicher Redensart in den Märchen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und erläutert die Forschungsmethodik. Kapitel 2 widmet sich der Klassifikation von phraseologischen Typen, wobei ein Schwerpunkt auf topischen Formeln, insbesondere Sprichwörtern und Gemeinplätzen, gelegt wird. Kapitel 3 bietet einen Überblick über die Entstehung und Sprache der Märchen der Brüder Grimm und untersucht den Einfluss von topischen Formeln und festen Phrasen auf die sprachliche Gestaltung. Kapitel 4 analysiert anhand ausgewählter Märchen wie „Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich“, „Hänsel und Gretel“, „Aschenputtel“, „Frau Holle“ und „Sneewittchen“ die Verwendung von Phraseologismen und deren Funktion im Kontext der jeweiligen Erzählung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den folgenden Schlüsselbegriffen: Phraseologie, topische Formeln, Sprichwörter, Gemeinplätze, feste Phrasen, Märchen der Brüder Grimm, volkstümliche Redensart, Sprachkultur.
- Quote paper
- Fiona Karl (Author), 2019, Die volkstümliche Redensart der Märchen der Brüder Grimm. Die Verwendung von Sprichwörtern, Gemeinplätzen und festen Phrasen dargestellt in fünf Märchen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1154004