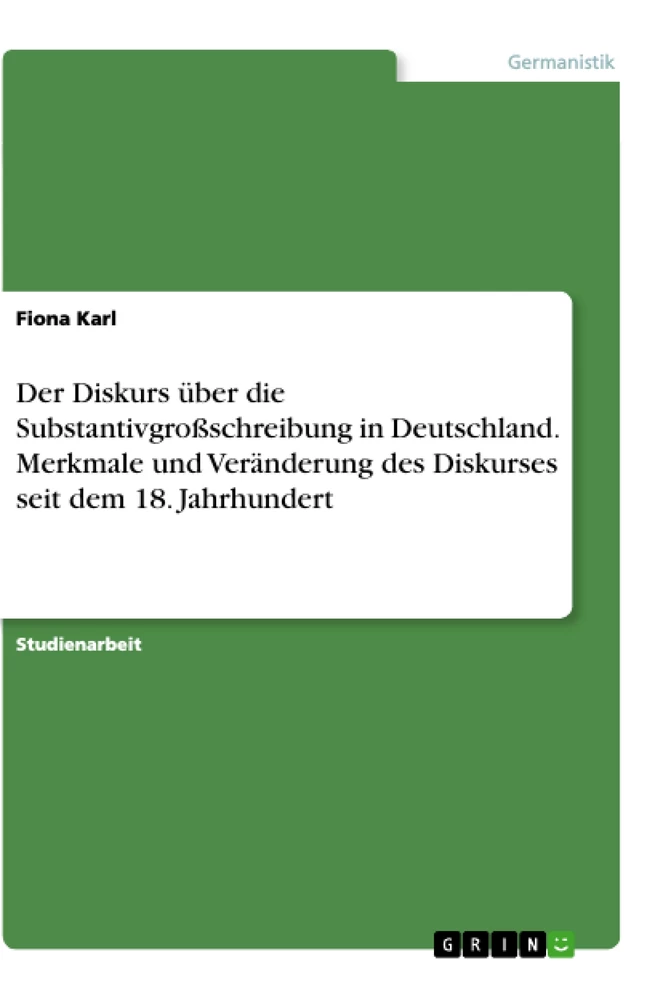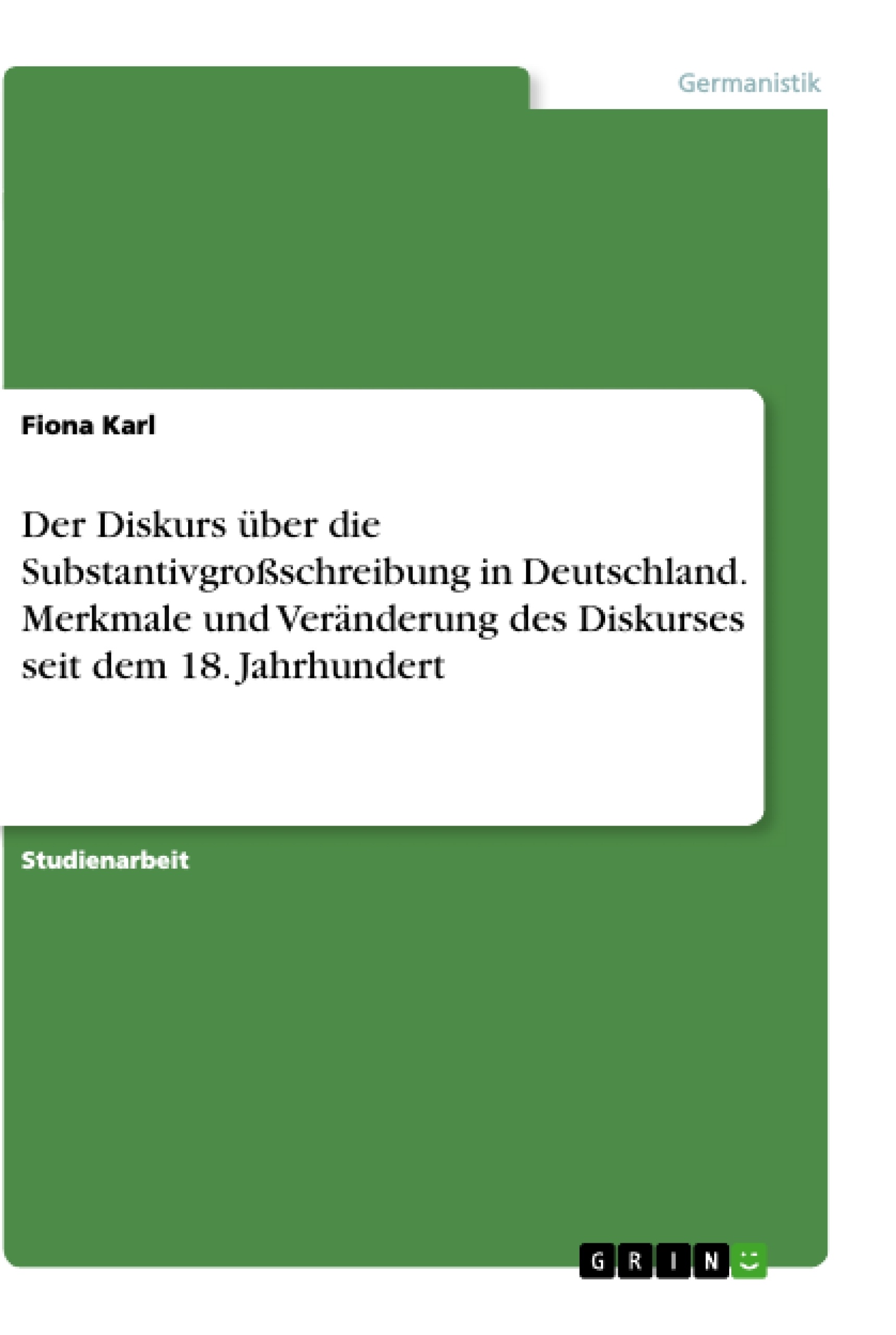Die Großschreibung der Substantive, die typisch für die deutsche Schriftsprache ist, zählt zu den am meisten diskutierten Gegenständen der Orthographie. Der Diskurs darüber ergab sich aus den Problematiken und scheinbaren Willkürlichkeiten der Substantivgroßschreibung, die lange Zeit ihre vollständige Beherrschung schwer bis unmöglich machte. Noch heute tun sich Schüler:innen mit ihrer Meisterung schwer, obwohl in den letzten 120 Jahre einiges für die Vereinheitlichung und bessere Verständlichkeit der deutschen Orthographie getan wurde.
Das Ziel dieser Arbeit ist es, die gängigsten Kritikpunkte an der Substantivgroßschreibung herauszuarbeiten und darzustellen, wie sich der Diskurs und ihre Normierung vom 18. bis zum 21. Jahrhundert entwickelten. Dazu soll im ersten Schritt die historisch gewordenen Systematik der satzinternen Großschreibung dargestellt werden. Dieses Kapitel der Arbeit muss weiter zurückführen als das 18. Jahrhundert, da hier die Entwicklung und Funktion der Substantivgroßschreibung sowie mögliche Gründe für ihre Entstehung und Monopolstellung in der deutschen Sprache erläutert werden sollen. Dieser Schritt muss unweigerlich zur Darstellung der Vereinheitlichung der Regeln für Groß- und Kleinschreibung führen, da die Substantivgroßschreibung sich als unaufhaltbares Phänomen herausstellte, was zwangsläufig einer gewissen Normierung bedurfte.
Im zweiten Schritt soll dementsprechend der Weg zur Vereinheitlichung der deutschen Orthographie dargestellt werden. Dieser soll von den Stimmen der der Substantivgroßschreibung gegenüber kritisch eingestellten Sprachwissenschaftlern untermauert werden und in der Darstellung der offiziellen Normierung, der II. Orthographischen Konferenz, münden. Hier sollen kurz einige Beispiele des Regelwerks zur Substantivgroßschreibung dargestellt und bezüglich ihrer Verständlichkeit analysiert werden.
Es folgt die Darstellung des sich an die II. Orthographische Konferenz anschließenden Diskurses zur Großschreibung von Substantiven, der unmittelbar nach der Konferenz begann und von diversen Reformvorschlägen der deutschen Rechtschreibung insbesondere in Bezug auf die Substantivgroßschreibung gestützt wurde. Hier sollen auch Gründe für das Scheitern der von Reformern geforderten gemäßigten Kleinschreibung aufgezeigt werden, was in der abschließenden Verdeutlichung der Vorzüge der Substantivgroßschreibung, die letztlich auch verantwortlich für ihren Erhalt in der Rechtschreibreform von 1996 waren, münden soll.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Historisch gewordene Systematik der satzinternen Großschreibung
- 3. Der Weg zur Vereinheitlichung
- 3.1 Die Kritik an der Substantivgroßschreibung vor der Vereinheitlichung
- 3.2 Die Orthographischen Konferenzen
- 4. Der Weg zur Reform
- 4.1 Die Kritik an der Substantivgroßschreibung vor der Reform
- 4.2 Das Ende des Ringens um die Substantivkleinschreibung
- 5. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Diskurs über die Substantivgroßschreibung im Deutschen und deren Entwicklung vom 18. Jahrhundert bis zum 21. Jahrhundert. Ziel ist es, die wichtigsten Kritikpunkte an der Substantivgroßschreibung herauszuarbeiten und zu analysieren, wie sich die Normierung und der Diskurs dazu in diesem Zeitraum veränderten.
- Historische Entwicklung der satzinternen Großschreibung
- Kritik an der Substantivgroßschreibung vor der Vereinheitlichung
- Die Orthographischen Konferenzen und ihre Rolle bei der Normierung
- Diskussionen und Reformen der Rechtschreibung im 20. Jahrhundert
- Gründe für den Erhalt der Substantivgroßschreibung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik der Substantivgroßschreibung ein und stellt die Relevanz des Themas im Kontext der deutschen Orthographie dar. Sie skizziert die Zielsetzung der Arbeit, die auf die Analyse der Kritik an der Substantivgroßschreibung und deren Normierungsprozesse ausgerichtet ist. Weiterhin wird der Aufbau der Arbeit vorgestellt.
2. Historisch gewordene Systematik der satzinternen Großschreibung
Dieses Kapitel befasst sich mit der Entstehung und Entwicklung der Substantivgroßschreibung in der deutschen Sprache. Es werden historische Belege für die Verwendung der Großschreibung von Substantiven, angefangen im Althochdeutschen bis hin zum frühen Neuhochdeutschen, dargestellt. Der Einfluss des Schreibgebrauchs und der Anstrengungen von Sprachwissenschaftlern, die Großschreibung zu standardisieren, werden untersucht.
3. Der Weg zur Vereinheitlichung
Dieses Kapitel beleuchtet den Weg zur Vereinheitlichung der deutschen Orthographie, insbesondere im Hinblick auf die Substantivgroßschreibung. Es werden die Kritikpunkte an der Substantivgroßschreibung vor der Vereinheitlichung vorgestellt sowie die Rolle der Orthographischen Konferenzen bei der Normierung der deutschen Rechtschreibung dargestellt. Die Arbeit beleuchtet die Verständlichkeit der Regelwerke zur Substantivgroßschreibung.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit den Schwerpunkten: Substantivgroßschreibung, deutsche Orthographie, Orthographische Konferenzen, Rechtschreibreform, Sprachgeschichte, Entwicklungstendenzen, Sprachwissenschaft, Kritik, Normierung.
Häufig gestellte Fragen
Warum schreiben wir im Deutschen Substantive groß?
Die Arbeit untersucht die historische Entwicklung seit dem 18. Jahrhundert und zeigt auf, dass sich die Großschreibung als unaufhaltbares Phänomen zur Kennzeichnung von Substantiven etablierte.
Was war das Ziel der II. Orthographischen Konferenz?
Ziel war die offizielle Normierung und Vereinheitlichung der deutschen Rechtschreibung, um die bis dahin herrschende Willkür in der Schreibweise zu beenden.
Warum scheiterte die Einführung der Kleinschreibung?
Trotz zahlreicher Reformvorschläge für eine gemäßigte Kleinschreibung überwogen letztlich die Vorzüge der Substantivgroßschreibung für die Lesbarkeit, was auch 1996 zum Erhalt führte.
Welche Kritikpunkte gibt es an der Großschreibung?
Kritiker bemängeln oft die Komplexität der Regeln, die es besonders Schülern erschwert, die Orthographie vollständig zu beherrschen.
Wie weit reicht die Systematik der Großschreibung zurück?
Die Arbeit beleuchtet Belege von der althochdeutschen Zeit bis hin zur Standardisierung im frühen Neuhochdeutschen.
- Arbeit zitieren
- Fiona Karl (Autor:in), 2021, Der Diskurs über die Substantivgroßschreibung in Deutschland. Merkmale und Veränderung des Diskurses seit dem 18. Jahrhundert, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1154009