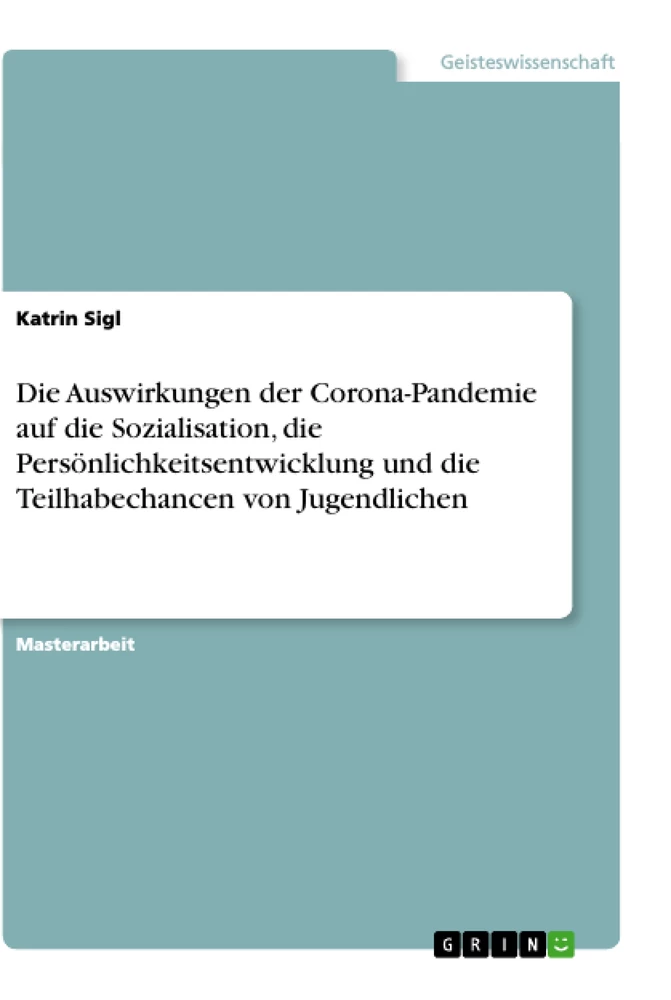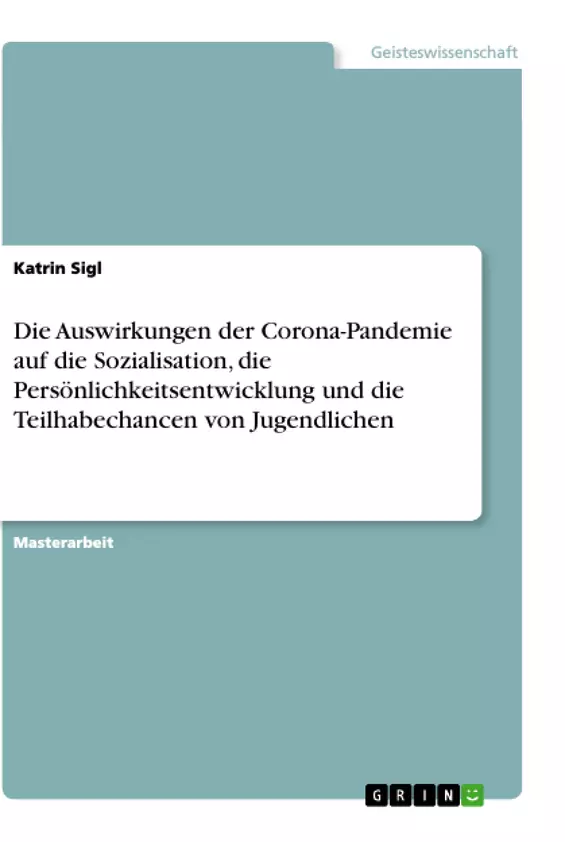Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich grundlegend mit der Frage: Welche Auswirkungen haben die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie auf die Sozialisation und psychosoziale Entwicklung sowie zukünftige Teilhabechancen von Jugendlichen?
Für die Auseinandersetzung mit der Fragestellung wird zunächst das methodische Vorgehen kurz erläutert. Danach findet im 3. Kapitel eine Darstellung der derzeitigen Situation in Bezug auf die Corona-Pandemie statt. Hierbei werden die Infektionsschutzmaßnahmen dargestellt, welche sich insbesondere auf die Lebenswelt der Jugendlichen auswirken. Darüber hinaus wird der soziale Wandel und dessen Auswirkungen näher beleuchtet, um somit die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in die aktuellen Gesellschaftsstrukturen einzubetten.
Im 4. Abschnitt wird ein Überblick über die aktuelle Studienlage gegeben. Die Studienergebnisse sollen als Basis für die weiteren Ausführungen dienen. Das darauffolgende 5. Kapitel setzt sich mit der Sozialisation von Jugendlichen in Zeiten der Corona-Pandemie auseinander. Hierfür werden Sozialisationskontexte wie Familie, Peers, Schule und Medien in Bezug auf die aktuelle Pandemie Situation gesetzt und deren Bedeutung für die Sozialisation von Jugendlichen herausgearbeitet. Innerhalb des 6. Abschnitts werden psychosoziale Entwicklungsprozesse in der Jugendphase näher beleuchtet. Als theoretischer Ansatz wird hierfür das Entwicklungsphasenmodell nach Erikson herangezogen, um anhand dessen Erkenntnissen den möglichen Einfluss der aktuellen Situation auf die Persönlichkeitsentwicklung darzustellen. Danach soll im 7. Kapitel eine ressourcenorientierte Dimension anhand des Resilienzkonzepts und des Salutogeneseansatzes mit einbezogen werden.
Im Anschluss daran werden in den Abschnitten 8 und 9 die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen im Bildungssektor in Bezug zu den daraus resultierenden zukünftigen Teilhabechancen der Jugendlichen gesetzt. Daraufhin findet im 10. Kapitel eine Auseinandersetzung mit dem Handlungsfeld der Sozialen Arbeit in Zeiten der Corona-Pandemie statt. Hierfür soll das Konzept der Lebensbewältigung nach Böhnisch als Grundlage dienen. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung der Ausarbeitung und Schlussbetrachtung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Methodisches Vorgehen
- Situationsbeschreibung
- Infektionsschutzmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie
- Sozialer Wandel in modernen Gesellschaften
- Überblick über die aktuelle Studienlage
- Sozialisation und Sozialisationskontexte im Wandel
- Familie
- Gleichaltrige - Peers
- Schule
- Medien
- Persönlichkeitsentwicklung in der Jugendphase in Corona-Zeiten
- Entwicklungsphasenmodell nach Erikson
- Phase IV: Schulalter
- Herausforderung für das Schulalter in Zeiten der Corona-Pandemie
- Phase V: Adoleszenz
- Herausforderung für die Adoleszenzphase im Zuge der Corona-Pandemie
- Resilienz und Salutogenese in belastenden Situationen
- Resilienzschutz- und Risikofaktoren
- Salutogenese
- Bedeutung von Resilienz und Salutogenese in Sozialisations- und Entwicklungsprozessen
- Exkurs - Teilhabechancen von Jugendlichen durch Bildung
- Soziale Bildungsungleichheit - Herkunftseffekte
- Der Zusammenhang von sozialer Herkunft und Bildungserfolg
- Reproduktion von sozialer Bildungsungleichheit
- Auswirkungen der Corona-Maßnahmen im Bildungssektor auf die Teilhabechancen von Jugendlichen
- Das Handlungsfeld der Sozialen Arbeit in Zeiten von Corona
- Soziale Arbeit als Hilfe zur Lebensbewältigung nach Böhnisch
- Mandat und resultierender Handlungsauftrag für die Soziale Arbeit
- Schulsozialarbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Sozialisation und psychosoziale Entwicklung von Jugendlichen. Dabei werden die Auswirkungen der getroffenen Infektionsschutzmaßnahmen auf die Handlungsspielräume und Autonomieerleben sowie die Erfahrungsmöglichkeiten von Jugendlichen im Kontext von Sozialisation, Entwicklung und Bildung analysiert.
- Einfluss der Corona-Pandemie auf die Sozialisation von Jugendlichen
- Psychosoziale Auswirkungen der Pandemie auf Jugendliche
- Bedeutung von Resilienz und Salutogenese in der Bewältigung der Pandemie-bedingten Herausforderungen
- Teilnahmechancen von Jugendlichen in Bildung und Gesellschaft
- Handlungsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit im Kontext der Corona-Pandemie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Ausgangslage dar und beschreibt die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das gesellschaftliche Leben, insbesondere auf Jugendliche. Kapitel 2 erläutert die methodische Vorgehensweise der Arbeit. In Kapitel 3 werden die Infektionsschutzmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sowie der soziale Wandel in modernen Gesellschaften beschrieben. Kapitel 4 bietet einen Überblick über die aktuelle Studienlage. Kapitel 5 widmet sich der Sozialisation und den Sozialisationskontexten im Wandel, wobei die Familie, Gleichaltrige, Schule und Medien im Fokus stehen. Kapitel 6 befasst sich mit der Persönlichkeitsentwicklung in der Jugendphase in Corona-Zeiten und beleuchtet das Entwicklungsphasenmodell nach Erikson sowie die Herausforderungen für das Schulalter und die Adoleszenzphase. Kapitel 7 untersucht die Bedeutung von Resilienz und Salutogenese in belastenden Situationen. Kapitel 8 stellt die Teilhabechancen von Jugendlichen durch Bildung in den Fokus, mit Schwerpunkt auf die soziale Bildungsungleichheit. In Kapitel 9 werden die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen im Bildungssektor auf die Teilhabechancen von Jugendlichen analysiert. Kapitel 10 widmet sich dem Handlungsfeld der Sozialen Arbeit in Zeiten von Corona und erläutert die Rolle der Sozialen Arbeit als Hilfe zur Lebensbewältigung sowie das Mandat und den Handlungsauftrag für die Soziale Arbeit, insbesondere die Schulsozialarbeit.
Schlüsselwörter
Corona-Pandemie, Jugendliche, Sozialisation, psychosoziale Entwicklung, Teilhabe, Bildung, Resilienz, Salutogenese, Soziale Arbeit, Schulsozialarbeit.
- Citation du texte
- Katrin Sigl (Auteur), 2021, Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Sozialisation, die Persönlichkeitsentwicklung und die Teilhabechancen von Jugendlichen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1154105