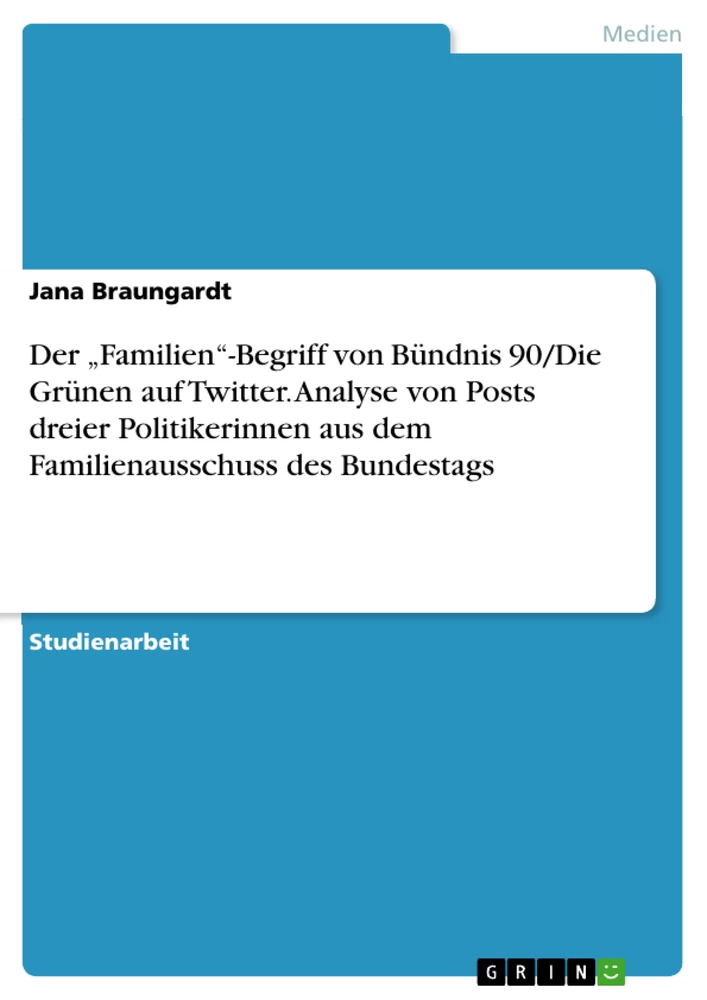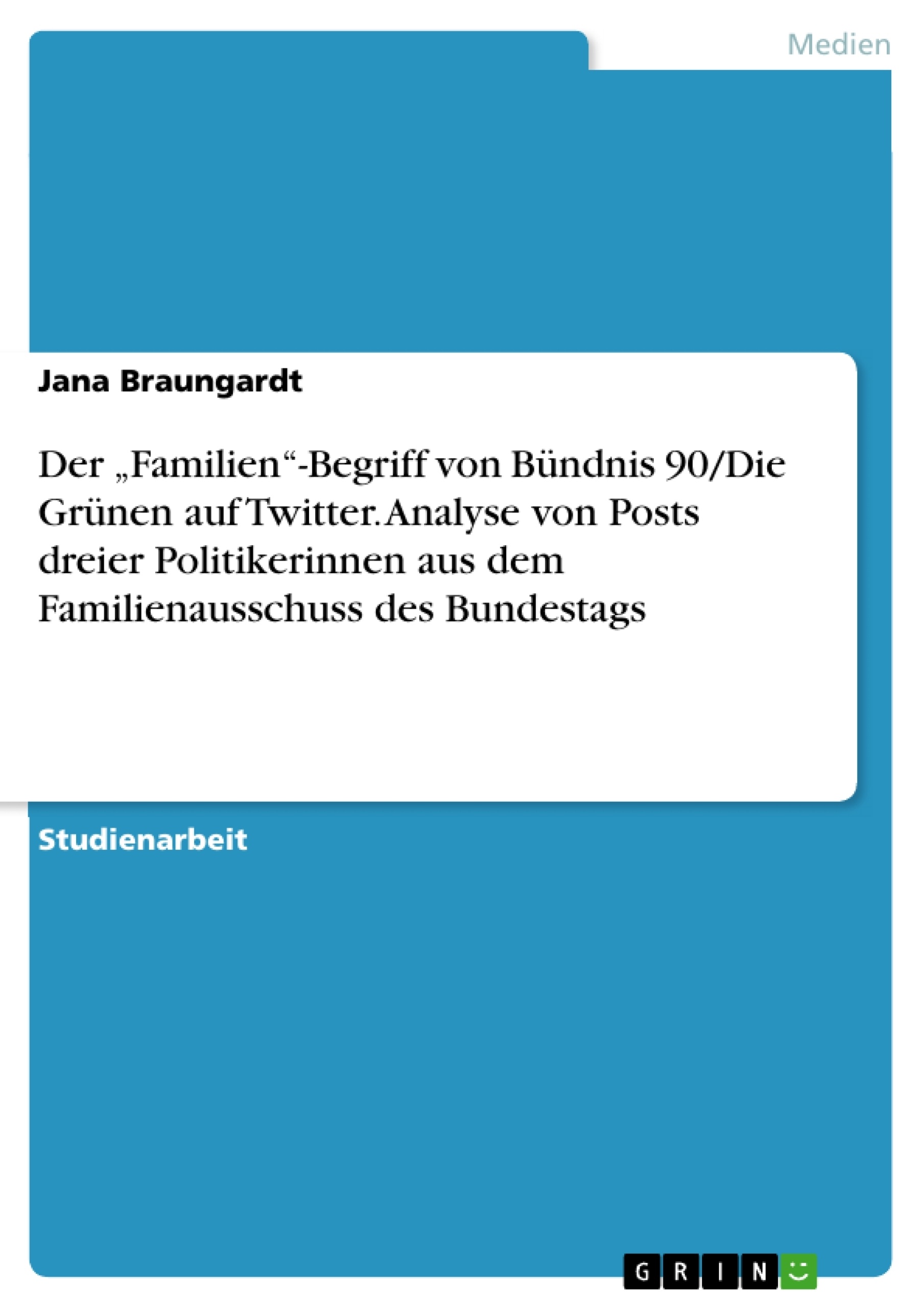Wie der Begriff von „Familie“ der Partei „Bündnis 90/Die Grünen“ aussieht, wie er definiert wird und inwiefern er zum vorherrschenden Wandel der Familie passt, wird anhand von Twitter Posts dreier Politikerinnen aus dem Familienausschuss des Bundestags in dieser Arbeit untersucht. Die Familie und insbesondere der Begriff der „Familie“ befindet sich in einem anhaltenden Wandel. Während früher die Blutsverwandtschaft für eine Familie von Bedeutung war, weicht der Begriff mehr und mehr davon ab.
Stattdessen spielt auch die soziale Elternschaft eine Rolle für das Entstehen einer Familie. Dieser Wandel hängt mit einer allgemeinen Pluralisierung von Lebensformen zusammen, welche sich seit dem „Golden Age of Marriage“ eingestellt hat. Die Ehe erlebt eine Krise, gleichgeschlechtliche Paare haben die Möglichkeit Kinder zu bekommen und die Familiengründung findet in einem zunehmend höheren Alter statt. Aber welchen Einfluss haben diese gesellschaftlichen und strukturellen Veränderungen auf den Begriff von „Familie“?
Um diesen Einfluss zu untersuchen, sind die Sozialen Netzwerke geeignet, da sie einen Wandel zeitgleich und ohne Verzögerungen zeigen können und für die Kommunikation unabdingbar geworden sind. Gleichzeitig sind sie eine beliebte Plattform für Politiker*innen, um mit der Gesellschaft zu kommunizieren und damit ihrerseits einen bestimmten Begriff von „Familie“ zu vermitteln.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Thema und Forschungsfrage
- Aktueller Forschungsstand
- Methode der qualitativen Inhaltsanalyse
- Durchführung
- Kategorienbildung
- Partnerschaft
- Kindschaft
- Elternschaft
- Vorstellung des Untersuchungsmaterials
- Auswertung und Interpretation der Ergebnisse
- Partnerschaft
- Kindschaft
- Elternschaft
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Konzeption des „Familien“-Begriffs bei Politikerinnen der Partei Bündnis 90/Die Grünen, die im Familienausschuss des Bundestags vertreten sind. Ziel ist es, anhand von Twitter-Posts zu analysieren, wie die Grünen Politikerinnen den Begriff „Familie“ im digitalen Raum kommunizieren und welche Vorstellungen von Partnerschaft, Kindschaft und Elternschaft sie damit vermitteln.
- Analyse des „Familien“-Begriffs der Grünen auf Twitter
- Untersuchung der Konzeption von Partnerschaft, Kindschaft und Elternschaft in den Twitter-Posts
- Beurteilung des Einflusses des gesellschaftlichen Wandels auf den „Familien“-Begriff der Grünen
- Vergleich des „Familien“-Begriffs der Grünen mit dem Wandel der Familie in der Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Wandel des „Familien“-Begriffs in den Vordergrund und betont die Bedeutung der sozialen Medien, insbesondere Twitter, für die Kommunikation von Politikern. Die Arbeit fokussiert auf die Analyse von Twitter-Posts dreier Politikerinnen der Grünen im Familienausschuss des Bundestags.
- Thema und Forschungsfrage: Dieses Kapitel präsentiert die zentrale Forschungsfrage, die sich mit der Konzeption des „Familien“-Begriffs der Grünen auf Twitter beschäftigt.
- Aktueller Forschungsstand: Hier wird der aktuelle Forschungsstand zum Thema „Familienbegriff“ in der Gesellschaft und insbesondere im Kontext der sozialen Medien beleuchtet.
- Methode der qualitativen Inhaltsanalyse: Das Kapitel erläutert die angewandte Methode der qualitativen Inhaltsanalyse, die für die Analyse der Twitter-Posts verwendet wird.
- Durchführung: Detaillierte Beschreibung der Durchführung der Inhaltsanalyse, einschließlich der Kategorienbildung.
- Kategorienbildung: Vorstellung der Kategorien „Partnerschaft“, „Kindschaft“ und „Elternschaft“ zur Analyse der Twitter-Posts.
- Auswertung und Interpretation der Ergebnisse: Die Ergebnisse der Inhaltsanalyse werden in Bezug auf die Kategorien „Partnerschaft“, „Kindschaft“ und „Elternschaft“ vorgestellt und interpretiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Familie, Familienbegriff, Twitter, qualitative Inhaltsanalyse, Bündnis 90/Die Grünen, Familienausschuss, Politikerinnen, gesellschaftlicher Wandel, Partnerschaft, Kindschaft, Elternschaft, soziale Medien, politische Kommunikation.
- Quote paper
- Jana Braungardt (Author), 2021, Der „Familien“-Begriff von Bündnis 90/Die Grünen auf Twitter. Analyse von Posts dreier Politikerinnen aus dem Familienausschuss des Bundestags, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1154266