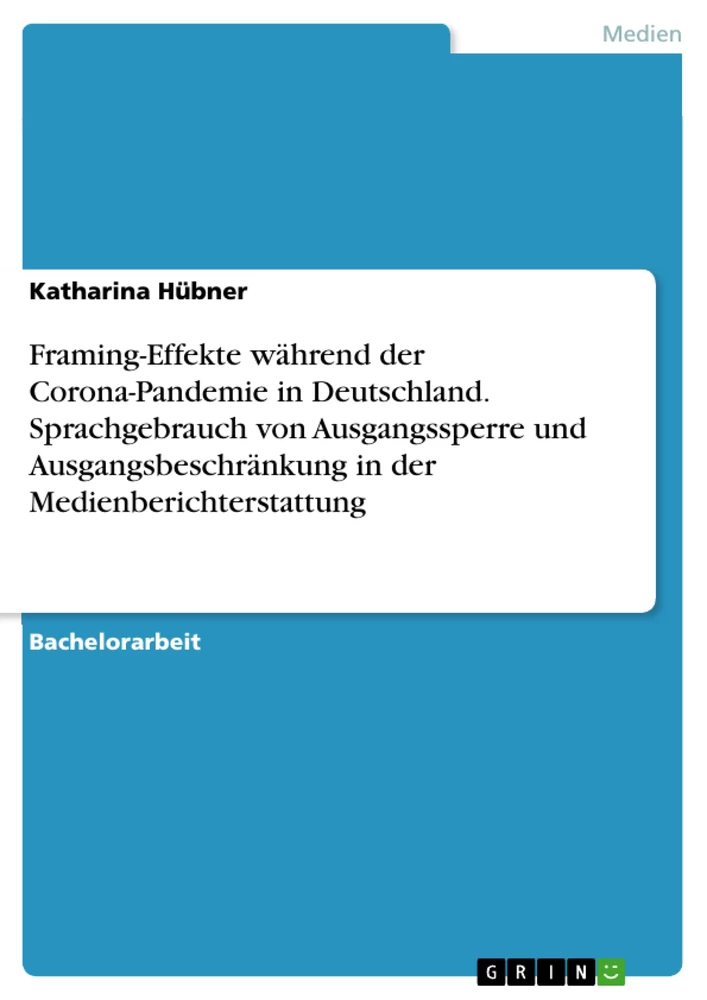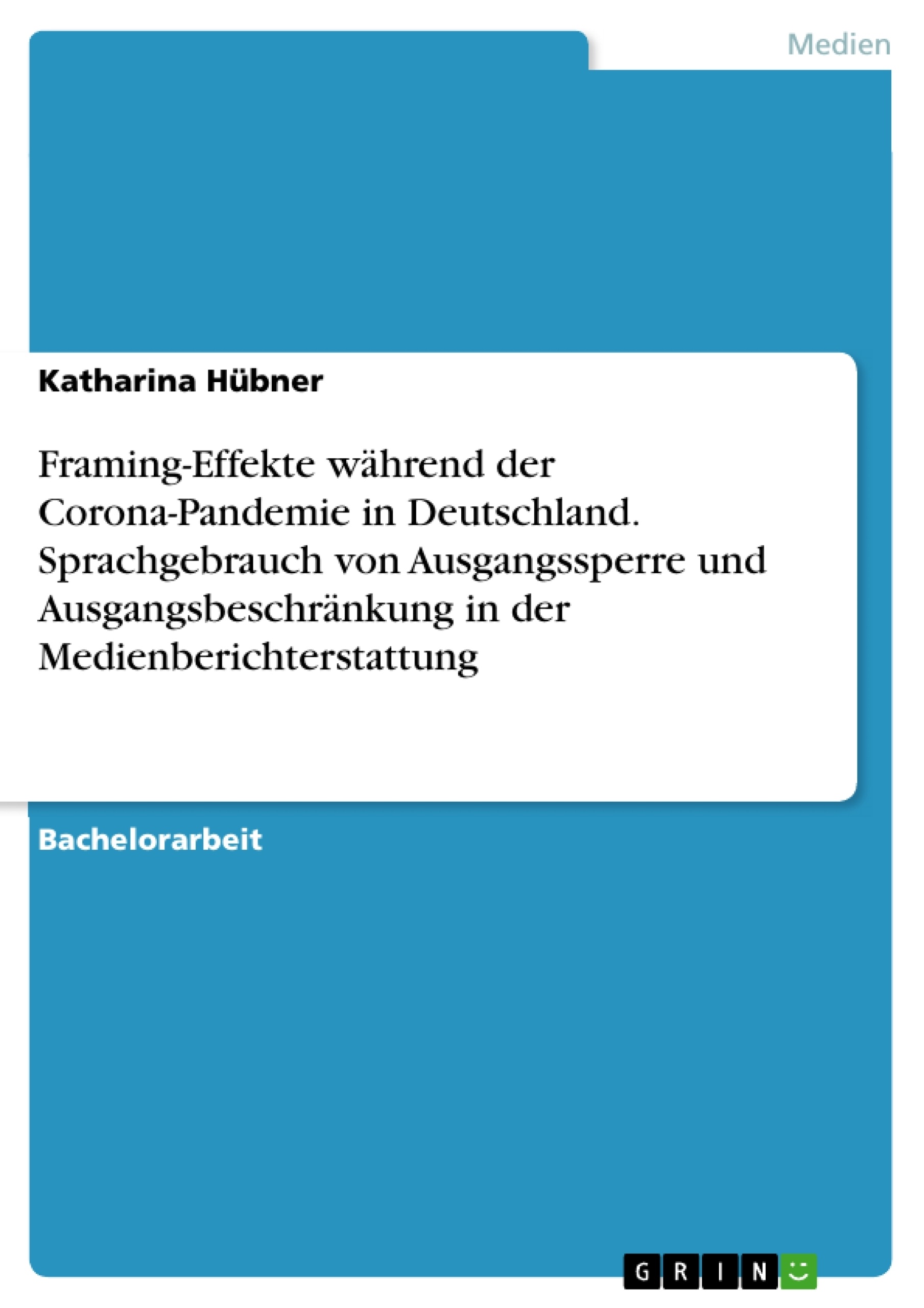Diese Arbeit fokussiert den Sprachgebrauch von Ausgangssperre und Ausgangsbeschränkung in der Debatte um die Eindämmungsmaßnahmen innerhalb der Medienberichterstattung und den daraus resultierenden Frames als potenzielle Einflüsse auf den Beschluss der Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen am 22ten März 2020. Welche Rolle spielten sprachliche Frames in der Legitimation der Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie? Noch bevor am 22ten März 2020 von Bund und Ländern Ausgangs- und Kontaktbeschränkung beschlossen wurden, wurden die Maßnahmen nicht nur von Parteien und Politikerinnen und Politikern, sondern insbesondere auch in der Medienberichterstattung durch einzelne Journalistinnen und Journalisten oder Autorinnen und Autoren debattiert.
Während die Kontaktsperre oder Kontaktbeschränkungen erst zu dem Zeitpunkt, als der Beschluss erlassen wurde, häufiger thematisiert zu werden schienen, schienen Ausgangssperre und Ausgangsbeschränkung bereits als konträre Spieler einer potenziellen Eindämmungsmaßnahme abgehandelt zu werden. Folgende Thematik schien dabei besonders im Fokus zu stehen: die Vereinbarkeit einer Ausgangssperre mit dem Grundgesetz und der Demokratie. In einem Artikel auf Zeit Online vom 19ten März 2020 wird beispielsweise folgende Frage gestellt: „Lässt das Grundgesetz die Maßnahme überhaupt zu?“.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung titelt dagegen, ebenfalls in einem Online-Artikel, schon einen Tag später: „Es geht nur mit dem Hammer“, denn „wer noch immer nicht begriffen hatte, wie ernst die Lage ist, musste seither mit Ausgangsbeschränkungen rechnen“. Andere Artikel schienen dagegen den Appell an die Vernunft zu thematisieren, z. B. in folgendem Spiegel-Kommentar: „Die Frage der Ausgangssperre zeigt das: Wollen wir Politiker, die drakonische Maßnahmen verhängen müssen, weil zu viele von uns nicht bereit sind, vernünftig zu sein und sich an die Regeln zu halten?“. In einem „Essay über die Corona-Gesellschaft“ heißt es dazu: „Die Vernunftpanik verhindert Debatten. […] Man kann gegen Ausgangssperren argumentieren und trotzdem kein Massenmörder sein.“
Inhaltsverzeichnis
- Das Corona-Vokabular: Frames in der COVID-19-Pandemie
- Problemstellung: Ausgangssperre oder Ausgangsbeschränkung?
- Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
- Frames und Framing in der Forschung
- Ursprünge eines disziplinübergreifenden Frame-Konzepts
- Frames im Spannungsfeld des linguistischen und kommunikationswissenschaftlichen Ansatzes
- Frames in kommunikativen Texten: Medien-Frames
- Forschungsstand: Die Rolle von Frames in der Legitimation politischer Maßnahmen
- Empirisches Vorgehen
- Forschungsziele, zentrale Fragestellungen und Annahmen
- Untersuchungsdesign
- Untersuchungsgegenstand
- Untersuchungszeitraum
- Kategorienbildung
- Methode: Suche nach Textmustern
- Erstellung eines eigenen Korpus: Das „Corona-Beschluss-Korpus“
- Berechnung von Mehrworteinheiten durch quantitative Methoden
- Diskursbeschreibung durch qualitative Methoden
- Ergebnisse
- Erste Beobachtungen
- Ausgangssperre – Ergebnisse
- Problemdefinition: Ausgangssperre ist der Feind
- Ursachenzuschreibung: Die Unvernunft der Menschen
- Handlungsempfehlung: Freiwillige Beschränkung der Menschen
- Explizite Bewertung
- Ausgangsbeschränkung – Ergebnisse
- Problemdefinition: Ausgangsbeschränkung ist Rettung
- Ursachenzuschreibung: Die Ausbreitung des Coronavirus
- Handlungsempfehlung: Wohnungen nur aus triftigen Gründen verlassen
- Explizite Bewertung
- Zusammenfassung und Diskussion
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Verwendung des Wortes „Ausgangssperre“ im Kontext der COVID-19-Pandemie. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse von Framing-Effekten im Vokabular während der ersten Monate der Pandemie in der Bundesrepublik Deutschland. Die Arbeit verfolgt das Ziel, zu verstehen, wie sprachliche Mittel und insbesondere Frames die öffentliche Wahrnehmung der damaligen politischen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus beeinflussten.
- Analyse der sprachlichen Darstellung der Ausgangsbeschränkungen im Kontext der COVID-19-Pandemie
- Untersuchung der Rolle von Frames in der öffentlichen Wahrnehmung politischer Maßnahmen
- Bedeutung des Vokabulars für die Legitimierung politischer Entscheidungen in Krisenzeiten
- Identifizierung und Analyse von Framing-Strategien in Medienberichten
- Verknüpfung von Sprachwissenschaft, Medienwissenschaft und Politikwissenschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz des Themas im Kontext der Corona-Pandemie aufzeigt. Die Einleitung führt den Leser in die Problemstellung ein und stellt die Forschungsziele der Arbeit vor. Anschliessend wird im zweiten Kapitel das theoretische Fundament der Arbeit gelegt. Es werden verschiedene Ansätze zum Framing-Konzept vorgestellt und deren Bedeutung für die Analyse von Kommunikationsprozessen erläutert. Das dritte Kapitel widmet sich dem empirischen Vorgehen. Die Forschungsziele und zentralen Fragestellungen werden präzisiert und das Untersuchungsdesign erläutert. Die Arbeit geht dann im vierten Kapitel auf die Ergebnisse der empirischen Analyse ein.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Sprache der Demokratie in der Krise, insbesondere mit Framing-Effekten im Vokabular während der Corona-Pandemie. Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind: Corona-Vokabular, Frames, Framing, Ausgangsbeschränkung, Ausgangsperre, Mediensprache, Politik, Legitimation, Krisenkommunikation, COVID-19-Pandemie.
- Arbeit zitieren
- Katharina Hübner (Autor:in), 2020, Framing-Effekte während der Corona-Pandemie in Deutschland. Sprachgebrauch von Ausgangssperre und Ausgangsbeschränkung in der Medienberichterstattung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1154268