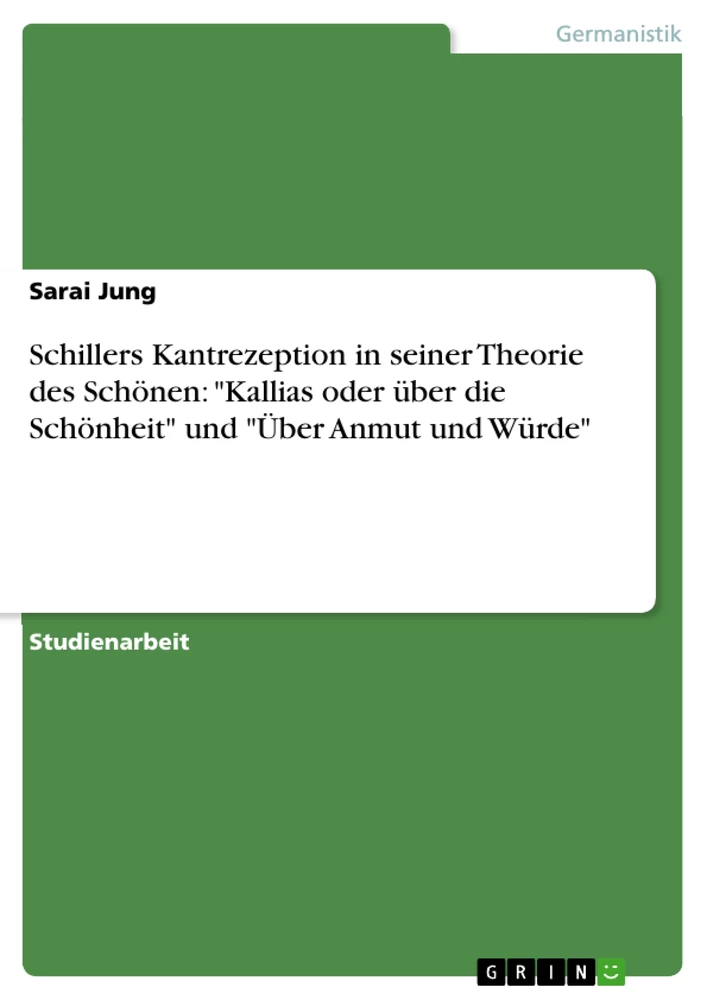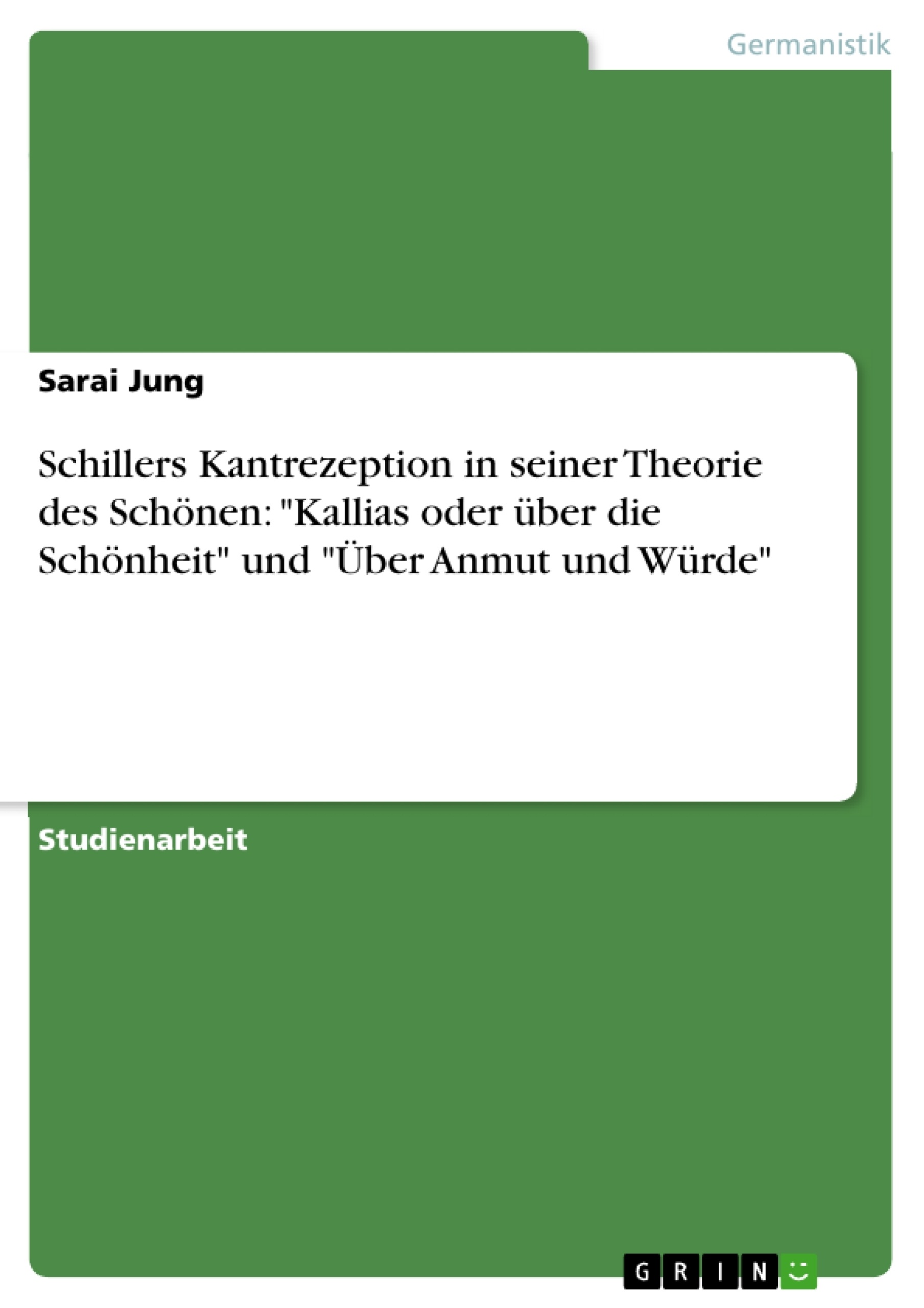Schiller zeigt sich seit seiner ersten Lektüre Kants von dessen Philosophie begeistert und beginnt, sich vor allem mit seiner Theorie des Schönen intensiv zu beschäftigen. Die Ergebnisse seiner Auseinandersetzung mit Kants Schönheitsbegriff finden ihren Ausdruck in dem Briefwechsel mit Körner, der unter dem Namen Kallias bekannt ist. In den Kallias-Fragmenten legt er die Grundlage seiner allgemeinen Schönheitstheorie, die er in der Abhandlung "Über Anmut und Würde" auf den Menschen überträgt.
Die vorliegende Arbeit versucht aufzuzeigen, inwiefern Kants Transzendentalphilosophie einerseits die Grundlage für Schillers Ästhetik bildet, den Dichter andererseits aber auch dazu veranlasst, Kants Ideen in einigen Punkten zu erweitern und sich an anderer Stelle deutlich von ihm zu distanzieren und den Versuch von alternativen Entwürfen zu wagen.
Entgegen des Kantischen Subjektivismus versucht Schiller ein objektives Prinzip der Schönheit zu entwickeln, das auf bestimmten Merkmalen der schönen Gegenstände beruht. Er entwickelt eine Autonomieästhetik und verbindet somit die Idee der Freiheit mit der der Schönheit, was ihn zu der Definition führt, dass Schönheit „Freiheit in der Erscheinung“ sei. In eben dieser Verbindung erweitert er die Reflexionen Kants, der an dem Schönen hauptsächlich unter erkenntnistheoretischem Aspekt interessiert war. Schiller hingegen legt seinen Schwerpunkt weniger auf die Bedingungen menschlicher Erkenntnis, als vielmehr auf die Bedeutung solcher Erkenntnisse für den Menschen als ein Ganzes, für dessen Wollen und Handeln. Schillers anthropologisches Interesse ist es nun auch, was ihn dazu leitet eine Synthese von Moralphilosophie und Ästhetik anzustreben. Innerhalb seiner Abhandlung "Über Anmut und Würde" entwirft er als Alternative zu Kants rigoroser Pflichtethik das Ideal der Schönen Seele, die die Pflicht aus Neigung erfüllt. Während Kant die Vollendung der Menschheit in der Herrschaft der Vernunft sieht, findet Schiller die Vollendung menschlichen Daseins in der Vorstellung des Spiels als harmonische Einheit von Sinnlichkeit und Vernunft. Beide jedoch suchen den Schlüssel zu einem gerechten und sittlichen menschlichen Zusammenleben in der Idee der Freiheit und der Selbsteinschränkung.
Inhaltsverzeichnis
- I. Gliederung
- II. Hauptteil
- 1. Kallias oder über die Schönheit - Schillers Begriff der Schönheit
- 1.1. Eine Einleitung
- 1.2. Die Frage der Subjektivität: subjektive Allgemeingültigkeit oder objektives Prinzip des Geschmacksurteils?
- 1.3. Die Frage nach der Lokalisierung des Urteilsvermögens: Teil der theoretischen Vernunft oder Teil der praktischen Vernunft?
- 1.4. Schillers ästhetisches Modell:
- 1.4.1. die Freiheit als Form der praktischen Vernunft
- 1.4.2. der Prozess des ästhetischen Urteils
- 1.4.3. die Autonomie in der Erscheinung
- 1.4.4. der Zusammenhang zwischen Zweckmäßigkeit und Schönheit
- 1.4.5. Zusammenfassung
- 2. Über Anmut und Würde - Die Anwendung der Schönheitstheorie auf den Menschen
- 2.1. Eine Einleitung
- 2.2. Der Dualismus im Menschen
- 2.3. Der Begriff der Freiheit bei Kant
- 2.4. Die rigorose Pflichtethik Kants
- 2.5. Die Rehabilitierung der Neigung bei Schiller
- 2.6. Die Bestimmung des Menschen: die Schöne Seele
- 2.7. Die Anmut und die Würde
- 3. Abschließende Zusammenfassung
- III. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht Schillers Auseinandersetzung mit Kants Philosophie des Schönen, insbesondere in Bezug auf die "Kritik der Urteilskraft". Ziel ist es, Schillers Konzept der Schönheit und seine Abweichungen von Kants Theorie zu analysieren und dessen Bedeutung für seine Ästhetik herauszuarbeiten. Schillers Ansatz, ein objektives Prinzip des Geschmacksurteils zu finden, wird dabei im Mittelpunkt stehen.
- Schillers Rezeption von Kants Kritik der Urteilskraft
- Der Unterschied zwischen Kants subjektiver und Schillers angestrebter objektiver Ästhetik
- Schillers Konzept der Freiheit in seiner Schönheitstheorie
- Die Anwendung der Schönheitstheorie auf den Menschen (Anmut und Würde)
- Der Zusammenhang zwischen Schönheit und Zweckmäßigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
II. Hauptteil: Dieser Teil der Arbeit analysiert Schillers Schönheitstheorie im Kontext seiner Auseinandersetzung mit Kant. Es wird detailliert untersucht, wie Schiller versucht, ein objektives Prinzip des Geschmacksurteils zu etablieren, im Gegensatz zu Kants subjektiver Auffassung. Schillers Konzept der Freiheit als Grundlage seiner Ästhetik wird beleuchtet, und der Zusammenhang zwischen Schönheit, Zweckmäßigkeit und dem menschlichen Erleben wird erörtert. Die Analyse stützt sich auf Schillers "Kallias oder über die Schönheit" und "Über Anmut und Würde", wobei die jeweiligen Einleitungen und zentralen Argumentationen im Detail besprochen werden. Die Kapitel zeigen Schillers Bemühen, eine eigenständige und kohärente Ästhetik zu entwickeln, die auf einer Verbindung von Vernunft und Empfindsamkeit beruht, während gleichzeitig der Bezug zu Kants Philosophie kritisch reflektiert wird.
Schlüsselwörter
Schiller, Kant, Schönheitstheorie, Kritik der Urteilskraft, objektives Prinzip des Geschmacks, subjektive Allgemeingültigkeit, Freiheit, Anmut, Würde, Zweckmäßigkeit, Autonomieästhetik, Kallias, Über Anmut und Würde.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu Schillers Schönheitstheorie
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Friedrich Schillers Auseinandersetzung mit Immanuel Kants Philosophie des Schönen, insbesondere im Bezug auf Kants "Kritik der Urteilskraft". Der Fokus liegt auf Schillers Konzept der Schönheit, seinen Abweichungen von Kants Theorie und der Bedeutung dieser für seine eigene Ästhetik.
Welche Texte Schillers werden untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf Schillers Schriften "Kallias oder über die Schönheit" und "Über Anmut und Würde". Die Analyse umfasst die jeweiligen Einleitungen und zentralen Argumentationslinien beider Texte.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die Arbeit untersucht, wie Schiller versucht, ein objektives Prinzip des Geschmacksurteils zu etablieren, im Gegensatz zu Kants subjektiver Auffassung. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Schillers Konzept der Freiheit als Grundlage seiner Ästhetik und dem Zusammenhang zwischen Schönheit, Zweckmäßigkeit und menschlichem Erleben.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Schillers Rezeption von Kants "Kritik der Urteilskraft"; der Unterschied zwischen Kants subjektiver und Schillers angestrebter objektiver Ästhetik; Schillers Konzept der Freiheit in seiner Schönheitstheorie; die Anwendung der Schönheitstheorie auf den Menschen (Anmut und Würde); der Zusammenhang zwischen Schönheit und Zweckmäßigkeit.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in einen Hauptteil, der Schillers Schönheitstheorie im Kontext seiner Auseinandersetzung mit Kant analysiert. Sie beinhaltet Kapitel zu "Kallias oder über die Schönheit" (inkl. Unterkapiteln zu Subjektivität des Urteils, Lokalisierung des Urteilsvermögens, Schillers ästhetischem Modell, etc.) und "Über Anmut und Würde" (inkl. Unterkapiteln zum Dualismus im Menschen, Kants Pflichtethik, Schillers Rehabilitierung der Neigung, etc.). Zusätzlich enthält die Arbeit eine Einleitung, eine Zusammenfassung der Kapitel, ein Literaturverzeichnis und eine Auflistung der Schlüsselwörter.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Schiller, Kant, Schönheitstheorie, Kritik der Urteilskraft, objektives Prinzip des Geschmacks, subjektive Allgemeingültigkeit, Freiheit, Anmut, Würde, Zweckmäßigkeit, Autonomieästhetik, Kallias, Über Anmut und Würde.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Die Arbeit zeigt Schillers Bestreben, eine eigenständige und kohärente Ästhetik zu entwickeln, die auf einer Verbindung von Vernunft und Empfindsamkeit beruht, während gleichzeitig der Bezug zu Kants Philosophie kritisch reflektiert wird. Der Hauptteil analysiert detailliert, wie Schiller versucht, ein objektives Prinzip des Geschmacksurteils zu etablieren und wie er seine Theorie auf den Menschen anwendet.
- Quote paper
- Sarai Jung (Author), 2003, Schillers Kantrezeption in seiner Theorie des Schönen: "Kallias oder über die Schönheit" und "Über Anmut und Würde", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11545