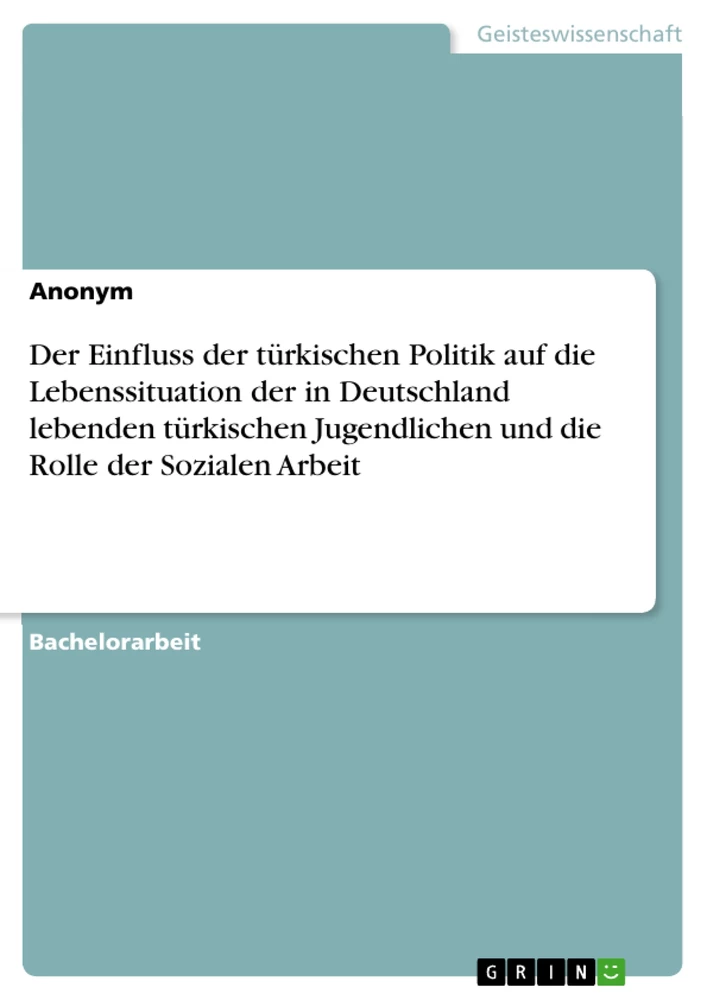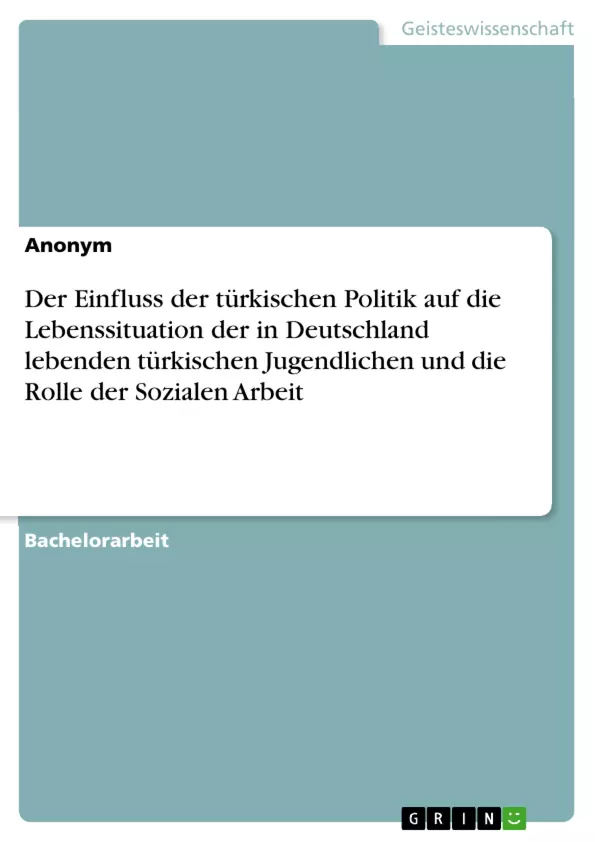In dieser Bachelorarbeit wird der Einfluss der türkischen Politik auf die hier lebenden türkischen Jugendlichen analysiert und die Rolle der Sozialen Arbeit bezüglich der Fragestellung beleuchtet. Da dies eine empirische Forschung ist, wurden zwei Jugendliche mit türkischem Migrationshintergrund interviewt und deren Sichtweisen für die Forschungsfrage herangezogen.
Somit liegt die Aufgabe meiner Arbeit zum einen in der Beschäftigung mit dem politischen Einfluss und dessen Auswirkung auf die Rolle der Sozialen Arbeit.
Mein Forschungsinteresse ist dem Umstand zu verdanken, dass ich ebenfalls einen türkischen Migrationshintergrund habe. Ich selbst bin in Deutschland geboren und hier aufgewachsen. Meine Eltern sind in der Türkei geboren und dort aufgewachsen und mit der Anwerbung von GastarbeiterInnen nach Deutschland eingereist. Während meiner Rolle als Individuum innerhalb der deutschen Gesellschaft ist mir in den letzten Jahren aufgefallen, dass Politik aus dem Heimatland einen Einfluss auf die Lebenssituation im Land, in welchem man aufgewachsen ist, nehmen kann. In meinem Umfeld habe ich einen Einblick in die unterschiedlichen Meinungen und Erfahrungen, sei es durch Familienmitglieder oder Bekanntschaften, bekommen können. Aufgrund dessen habe ich mich dazu entschieden, mich in meiner Bachelorarbeit mit diesem Thema zu beschäftigen, um Erfahrungen und Meinungen mit einer betriebenen Forschung zu begründen.
Da ich mich bei der empirischen Forschung auf die Lebenssituation der in Deutschland lebenden türkischen Jugendlichen beschränke, werde ich damit beginnen, zu Beginn wichtige Begrifflichkeiten zu definieren, sowie einen kleinen Überblick über die Einflussnahme der Politik geben.
Inhaltsverzeichnis
- Forschungsinteresse und Vorgehen
- Begriffsdefinitionen.
- Lebenssituation/Lebenswelt ...
- Jugendliche
- Migrationshintergrund.
- Entwicklung der türkischen Politik
- Politik von Mustafa Kemal Atatürk.
- Instabilitätsphasen der Türkei
- Die Militärputsche von 1960 bis 1997 und ihre Einflussnahme auf die türkische Politik...
- Politik von Recep Tayyip Erdogan
- Chancen und Risiken der Politik Erdogans ..
- Das Verhältnis zwischen der Türkei und der EU..
- Empirische Analyse: Einfluss der türkischen Politik auf die Lebenssituation der in Deutschland lebenden türkischen Jugendlichen......
- Forschungsfrage
- Methodisches Vorgehen: Leitfadengestütztes ExpertInneninterview
- Der Interviewleitfaden......
- Durchführung der Interviews
- Vorgehensweise.
- Sample
- Auswertungsmethode Inhaltsanalyse .......
- Darstellung der Untersuchungsergebnisse.
- Interpretation und Diskussion der Ergebnisse.
- Die Rolle der Sozialen Arbeit…………………………...
- Welche Problemlagen haben sich für die Soziale Arbeit gebildet?
- Auftrag der Sozialen Arbeit nach Staub-Bernasconi
- Interventionsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit für die entstandenen Problemlagen der türkischen Jugendlichen
- Empowerment........
- Öffentlichkeitsarbeit
- Präventive Maßnahmen an Schulen.
- Fazit.......
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht den Einfluss der türkischen Politik auf die Lebenssituation türkischer Jugendlicher in Deutschland und analysiert die Rolle der Sozialen Arbeit in diesem Kontext. Die Arbeit befasst sich mit den Herausforderungen und Chancen, die sich durch die türkische Politik für die Jugendlichen in Deutschland ergeben, und erforscht, wie die Soziale Arbeit auf diese Entwicklungen reagieren kann.
- Entwicklung der türkischen Politik und deren Einfluss auf die Lebenssituation türkischer Jugendlicher in Deutschland
- Analyse der Herausforderungen und Chancen, die sich aus der türkischen Politik für die Jugendlichen in Deutschland ergeben
- Die Rolle der Sozialen Arbeit im Kontext des Einflusses der türkischen Politik auf die Lebenssituation türkischer Jugendlicher
- Interventionsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit für die entstandenen Problemlagen
- Das Verhältnis zwischen der Türkei und der EU und die Auswirkungen auf die Lebensbedingungen türkischer Jugendlicher in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel definiert die wichtigsten Begrifflichkeiten der Arbeit, wie Lebenssituation, Jugendliche und Migrationshintergrund. Das zweite Kapitel gibt einen Überblick über die Entwicklung der türkischen Politik und ihre Einflüsse auf die Lebenssituation türkischer Jugendlicher in Deutschland. Dieses Kapitel beleuchtet die Anfänge der türkischen Politik, die Militärputsche von 1960 bis 1997 und die Politik von Recep Tayyip Erdogan. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der empirischen Analyse, die durch leitfadengestützte ExpertInneninterviews durchgeführt wurde, um den Einfluss der türkischen Politik auf die Lebenssituation der in Deutschland lebenden türkischen Jugendlichen zu erforschen. Es beschreibt die methodische Vorgehensweise, den Interviewleitfaden, die Durchführung und Auswertung der Interviews. Das vierte Kapitel präsentiert die Untersuchungsergebnisse und das fünfte Kapitel interpretiert und diskutiert diese Ergebnisse.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen türkische Politik, Migrationshintergrund, Lebenssituation türkischer Jugendlicher in Deutschland, Soziale Arbeit, Interventionsmöglichkeiten, Empowerment, Öffentlichkeitsarbeit, Präventive Maßnahmen an Schulen, Türkei-EU-Verhältnis und Integration.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Der Einfluss der türkischen Politik auf die Lebenssituation der in Deutschland lebenden türkischen Jugendlichen und die Rolle der Sozialen Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1154632