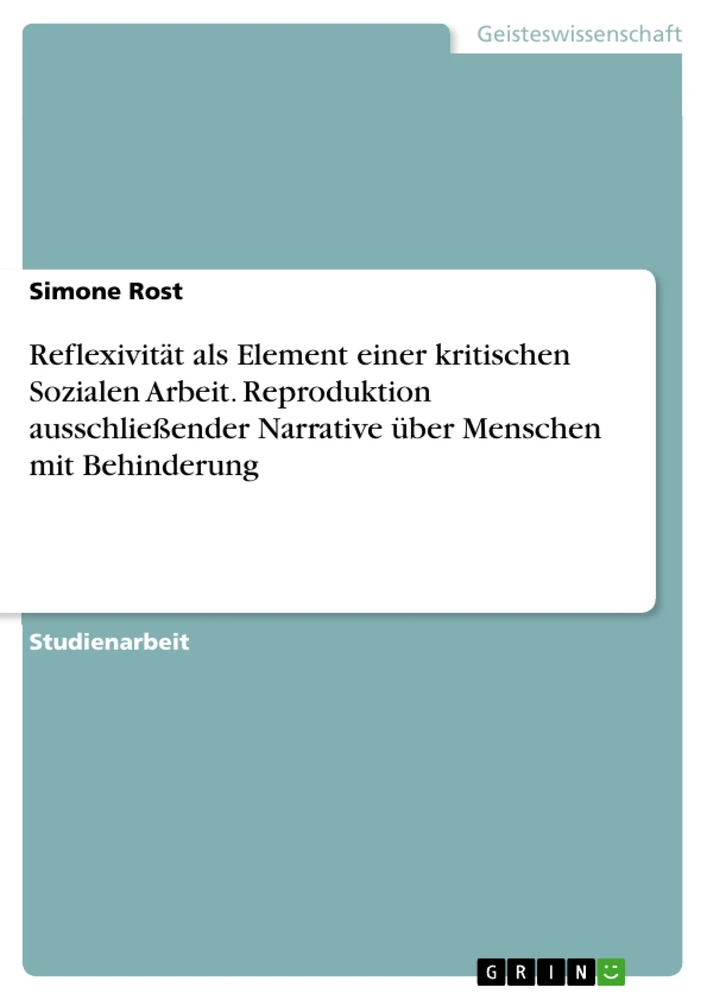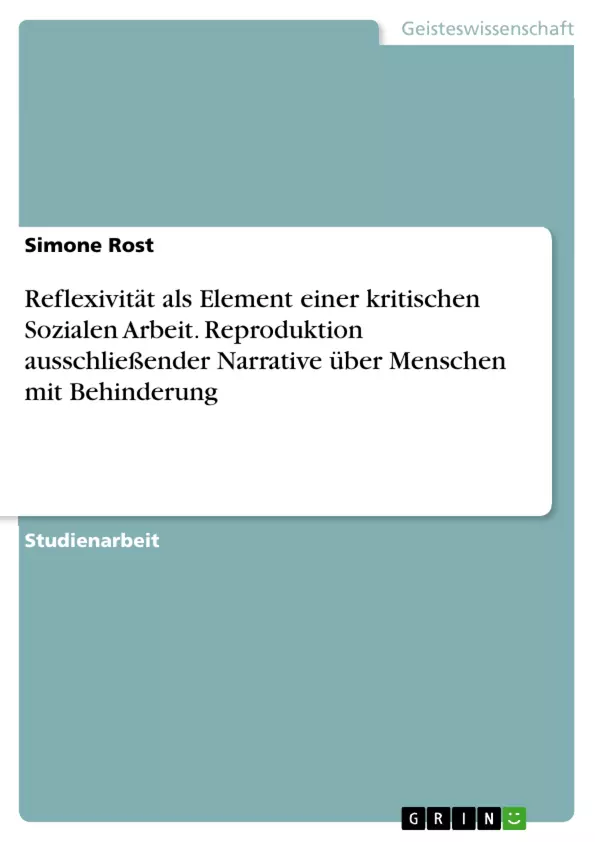Die Hausarbeit setzt sich mit der Theorie einer „Kritischen Sozialen Arbeit“ auseinander. Eine wissenschaftliche Theorie gezielt als kritisch zu deklarieren, mag auf den ersten Blick mitunter irritierend erscheinen: Ist das kritische Hinterfragen etwaiger Sachverhalte denn nicht das selbstverständliche Fundament allen wissenschaftlichen Handelns? Ist Wissenschaft nicht also per se kritisch? Wieso werden dennoch ganze Bücher mit den „Perspektiven kritischer Sozialer Arbeit“ gefüllt?
Bei genauerer Beschäftigung mit der Thematik wird schnell klar, dass es einen maßgeblichen Unterschied macht, auf welche Art und Weise Akteure aus Wissenschaft und Praxis Sozialer Arbeit ihre Erkenntnisse, Handlungsweisen und sogar die Findung ihrer Fragestellungen selbst hinterfragen. Soll heißen: Man kann die herrschende Ordnung und gesellschaftliche Normen als selbstverständliche, unumstößliche Manifestationen dem eigenen Gedankenspielraum zugrunde legen, innerhalb des dadurch vorgegebenen Rahmens die eigene Vorgehensweise reflektieren und dies als (selbst-)kritische Haltung bezeichnen. Hierbei werden dann v.a. Fragen nach mehr Effizienz, Optimierbarkeit von Handlungsabläufen und Zielerreichungen in der Arbeit mit Adressat*innen1 Sozialer Arbeit aufgeworfen. Die als Urväter der Kritischen Theorie geltenden Akteure Adorno oder Horkheimer hätten ein solches Vorgehen jedoch mutmaßlich mit Argwohn betrachtet, entspricht es doch keineswegs den Grundzügen ihrer Philosophie, die sie als sog. „Frankfurter Schule“ (Thommen, o. J.) berühmt gemacht hat.
In dieser Ausarbeitung wird aufgezeigt, inwiefern eine kritische Soziale Arbeit – um als kritisch gemäß der gleichnamigen Theorie zu gelten – bestrebt ist, Ordnungswissen anzuzweifeln, sich der Bearbeitung von Devianz zu widersetzen und daher in Konsequenz ihre eigene Lehre und praktische Anwendung, sowie ihre Reflexion und Kritik selbst fortwährend kritisch zu hinterfragen, wobei sie auch vor der Hinterfragung der Kriterien, die der Reflexion und Kritik zugrunde liegen, nicht Halt macht (vgl. Arbeitskreise Kritische Soziale Arbeit, o. J.). Dies soll am Beispiel davon beleuchtet werden, auf welche Weise Soziale Arbeit Menschen mit Beeinträchtigung in den Blick nimmt. Ziel ist ein Erkenntnisgewinn darüber, inwieweit Soziale Arbeit in der Betrachtung dieser Menschen noch immer ausschließende Narrative duldet und selbst reproduziert.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- SOZIALE ARBEIT ALS KRITISCHE WISSENSCHAFT
- Grundzüge einer kritischen Sozialen Arbeit
- Das Mittel der Reflexivität als Kernelement einer kritischen Perspektive
- Anwendungsbeispiel für den Grundsatz der Reflexivität
- DIE PRODUKTION SOZIALEN AUSSCHLUSSES DURCH ,,BE-HINDERUNG"
- ,,Behindert“ und „Be-Hindert“: Eine begriffliche Differenzierung
- Die Reproduktion ausschließender Narrative in der Arbeit mit „,Be-Hinderten“
- Der Inklusionsgedanke als Repräsentation einer kritischen Perspektive
- RESÜMEE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Ausarbeitung untersucht die Theorie der „Kritischen Sozialen Arbeit" und beleuchtet die Rolle der Reflexivität als zentrales Element dieser Perspektive. Sie analysiert die Herausforderungen, die sich aus der Reproduktion ausschließender Narrative über Menschen mit Behinderung in der Sozialen Arbeit ergeben.
- Kritisches Hinterfragen von Ordnungswissen und gesellschaftlichen Normen
- Analyse der Produktion und Reproduktion von sozialem Ausschluss durch Behinderung
- Das Konzept der Reflexivität als Mittel zur Überwindung von Macht- und Herrschaftsverhältnissen
- Der Inklusionsgedanke als Ausdruck einer kritischen Perspektive in der Sozialen Arbeit
- Die Bedeutung der ständigen Selbstreflexion in der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der „Kritischen Sozialen Arbeit“ ein und stellt die Bedeutung der Reflexivität als Grundlage einer kritischen Perspektive heraus.
- Soziale Arbeit als kritische Wissenschaft: Dieser Abschnitt definiert die Grundzüge einer kritischen Sozialen Arbeit und zeigt, wie das Mittel der Reflexivität als Kernelement in dieser Perspektive verortet werden kann.
- Die Produktion sozialen Ausschlusses durch ,,Be-Hinderung": Dieser Abschnitt befasst sich mit der Produktion und Reproduktion von ausschließenden Narrativen über Menschen mit Behinderung in der Sozialen Arbeit. Es werden die Begriffe „Behindert“ und „Be-Hindert“ differenziert und die Bedeutung des Inklusionsgedankens als Repräsentation einer kritischen Perspektive hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Kritische Soziale Arbeit, Reflexivität, Ausschluss, Behinderung, Inklusion, Narrative, Selbstreflexion, Macht- und Herrschaftsverhältnisse, Befreiungswissen, gesellschaftliche Normen, Ordnungswissen
- Arbeit zitieren
- Simone Rost (Autor:in), 2020, Reflexivität als Element einer kritischen Sozialen Arbeit. Reproduktion ausschließender Narrative über Menschen mit Behinderung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1154767