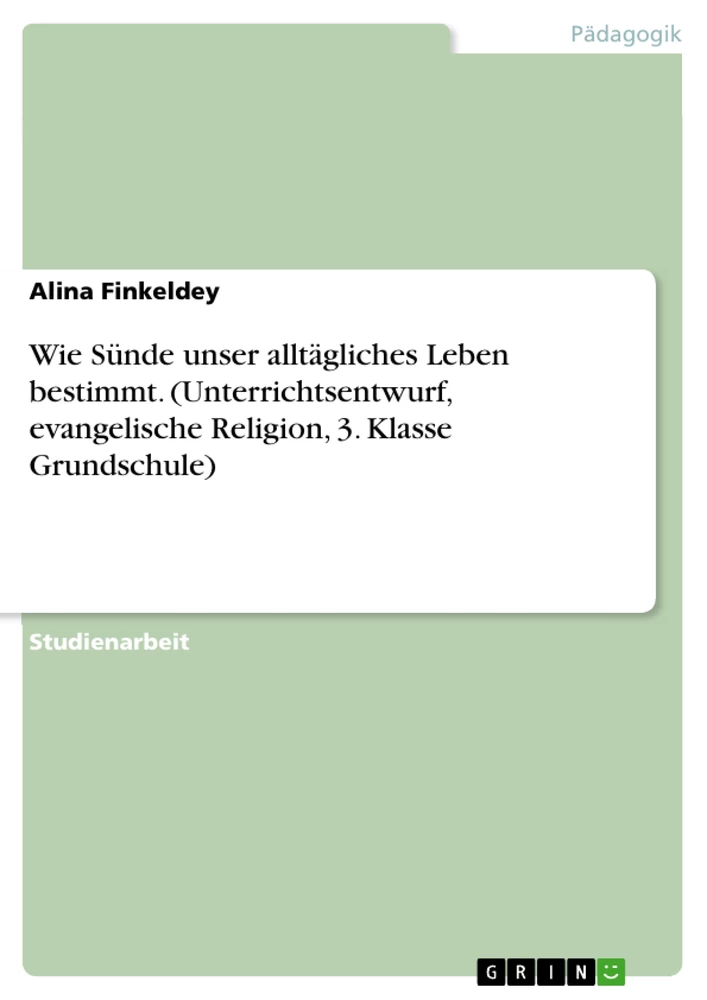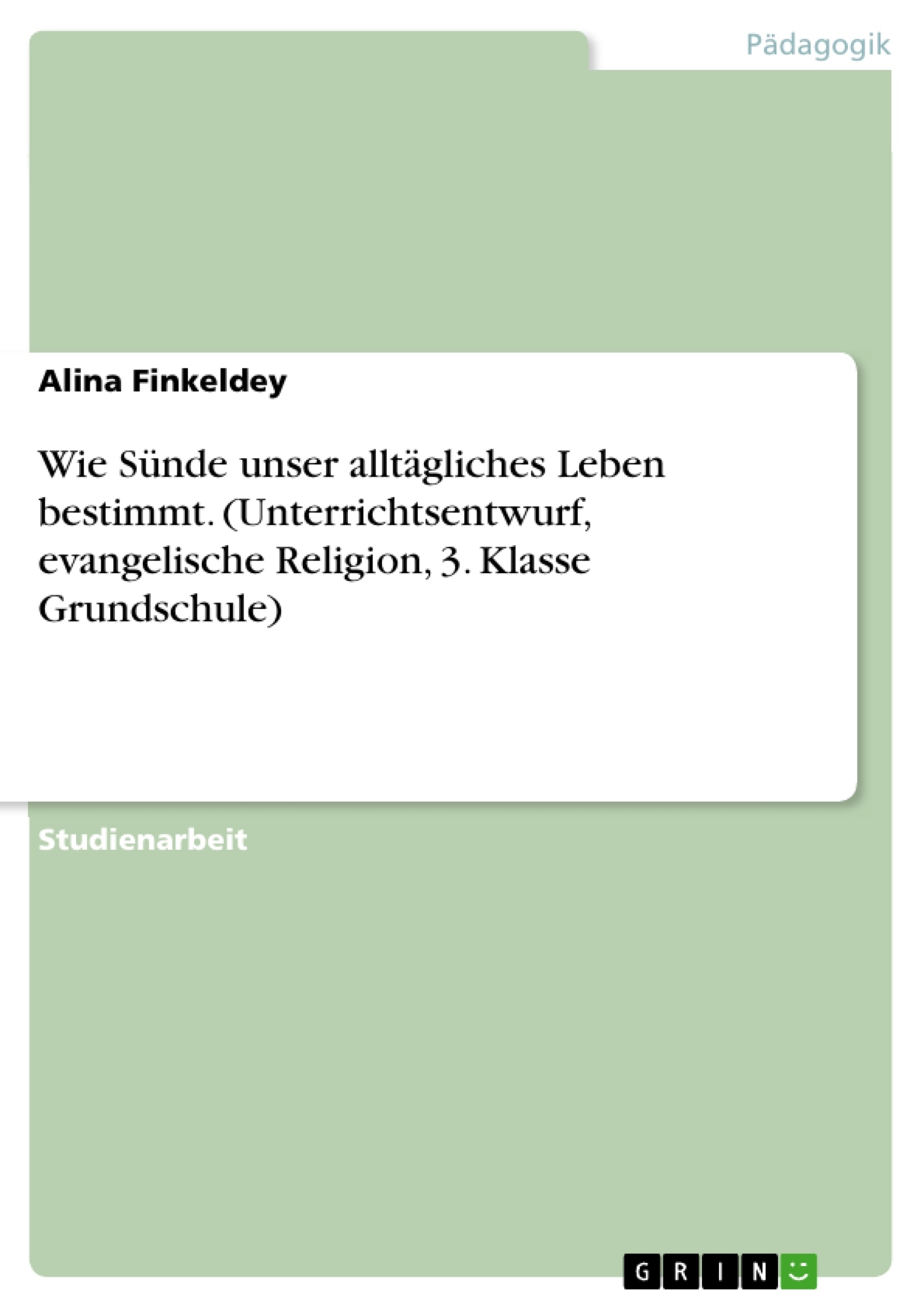In dieser Modulabschlussarbeit ist eine Unterrichtsreihe zum Thema „Sünde“ mit dem Unterthema „Wie die Sünde unser tägliches Leben bestimmt“ entworfen. Schülerinnen und Schüler sollen dabei lernen, dass das biblische Verständnis von Sünde ein anderes Verständnis ist, als die Gesellschaft vorgibt und prägt und diese Erkenntnisse auf ihre Lebenswirklichkeit zu beziehen.
Zunächst wird in der Bedingungsanalyse erläutert, mit welchen SuS die konzipierte Unterrichtseinheit durchgeführt wird. Dabei werden Alter, Schule, soziales Umfeld und religiöse Sozialisierung näher beschrieben.
Bei der Entwicklung einer Unterrichtsreihe für den Religionsunterricht ist das Bewusst werden der zu vermittelnden Inhalte sehr wichtig. Daher werde ich mich in der anschließenden Sachanalyse ausführlich systematisch-theologisch mit dem Sündenbegriff auseinandersetzen. Die biblische Urgeschichte (Genesis Kapitel 1 bis 11) ist dabei Grundlage dieser Erarbeitung. Kinder und Jugendliche verstehen den Begriff „Sünde“ im Laufe ihrer Entwicklung immer wieder in unterschiedlichen und zunehmend komplexen Dimensionen. Dies lässt sich unter anderem durch die moralischen und religiösen Entwicklungstheorien nach L. Kohlberg und J. Fowler begründen, auf die ich im Laufe dieser Arbeit noch näher eingehen werde.
Nachdem die Ergebnisse der Sachanalyse in einem Fazit gesammelt wurden, beginnt der zweite große Abschnitt meiner Arbeit, der religionspädagogische Teil. Die systematisch-theologischen Erkenntnisse sollen nun in einem Unterrichtsentwurf verwertet werden. Konkret soll dies anhand einer von mir konzipierten Unterrichtseinheit deutlich werden. Danach wird diese didaktisch kommentiert, indem Bezug zum Lehrplan genommen wird und Lernziele erläutert werden. Als letztes wird eine Unterrichtsstunde genauer dargestellt und ebenfalls kommentiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bedingungsanalyse
- Sachanalyse
- Einleitung
- Begriffsbestimmung
- Sünde im Kontext der biblischen Urgeschichte
- Begriffsgeschichte - Lutherische Sündenlehre Sünde bis zur Reformation
- Sündenverständnis nach Gerhard Ebeling
- Sündenverständnis nach Konrad Hilpert
- Exkurs: Rechtfertigungslehre
- Fazit
- Tabelle der geplanten Unterrichtseinheit
- Didaktischer Kommentar zur geplanten Unterrichtseinheit mit Bezugnahme auf den Lehrplan
- Tabelle der Unterrichtsstunde
- Didaktisch-Methodischer Kommentar zur Unterrichtsstunde
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Modulabschlussarbeit entwirft eine Unterrichtsreihe zum Thema „Sünde“ mit dem Unterthema „Wie die Sünde unser tägliches Leben bestimmt“. Schülerinnen und Schüler sollen dabei lernen, dass das biblische Verständnis von Sünde ein anderes Verständnis ist, als die Gesellschaft vorgibt und prägt, und diese Erkenntnisse auf ihre Lebenswirklichkeit beziehen.
- Das biblische Verständnis von Sünde im Vergleich zur gesellschaftlichen Vorstellung
- Die Bedeutung der biblischen Urgeschichte für das Sündenverständnis
- Entwicklung des Sündenbegriffs in der Geschichte der Theologie
- Die Relevanz des Sündenbegriffs für das tägliche Leben
- Religionspädagogische Ansätze zur Vermittlung des Themas „Sünde“
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Thematik und die Ziele der Modulabschlussarbeit vor und gibt einen Überblick über den Aufbau der Arbeit.
- Bedingungsanalyse: Dieses Kapitel beschreibt die spezifische Lerngruppe, für die die Unterrichtseinheit konzipiert ist, inklusive Alter, Schule, soziales Umfeld und religiöse Sozialisierung.
- Sachanalyse: Die Sachanalyse beschäftigt sich mit dem Sündenbegriff aus systematisch-theologischer Perspektive. Es werden die biblische Urgeschichte, die Begriffsgeschichte, verschiedene Sündenverständnisse sowie die Rechtfertigungslehre beleuchtet.
- Tabelle der geplanten Unterrichtseinheit: Dieses Kapitel präsentiert die strukturierte Planung der Unterrichtseinheit, inklusive der einzelnen Unterrichtseinheiten und deren Inhalte.
- Didaktischer Kommentar zur geplanten Unterrichtseinheit: Der didaktische Kommentar erläutert die didaktischen Entscheidungen und Lernziele der Unterrichtseinheit, wobei Bezug zum Lehrplan genommen wird.
- Tabelle der Unterrichtsstunde: Dieses Kapitel stellt eine exemplarische Unterrichtsstunde im Detail vor.
- Didaktisch-Methodischer Kommentar zur Unterrichtsstunde: Der didaktisch-methodische Kommentar analysiert und kommentiert die exemplarische Unterrichtsstunde hinsichtlich ihrer didaktischen und methodischen Aspekte.
Schlüsselwörter
Sünde, biblische Urgeschichte, Sündenverständnis, Lutherische Sündenlehre, Gerhard Ebeling, Konrad Hilpert, Rechtfertigungslehre, Religionspädagogik, Unterrichtseinheit, Lehrplan, Unterrichtsstunde.
- Quote paper
- Alina Finkeldey (Author), 2021, Wie Sünde unser alltägliches Leben bestimmt. (Unterrichtsentwurf, evangelische Religion, 3. Klasse Grundschule), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1154782