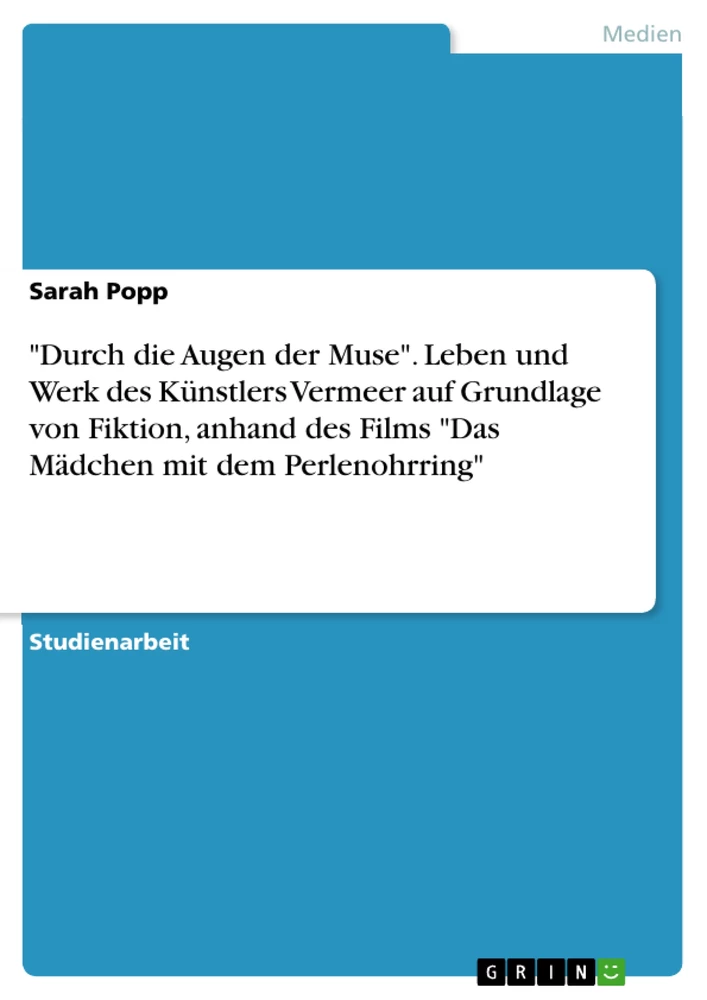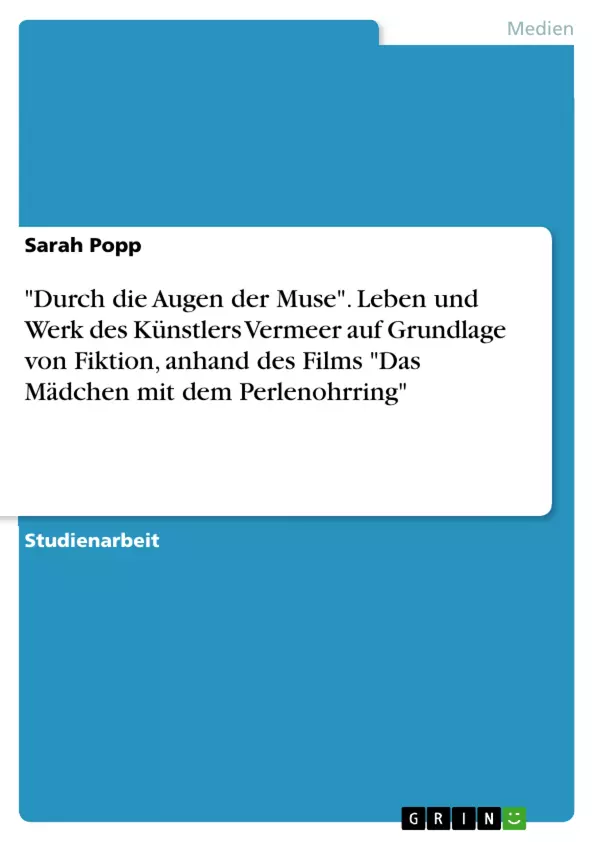Die Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Künstler Vermeer und dessen Darstellung in der Verfilmung "Das Mädchen mit dem Perlenohrring". Hierbei werden reale Künstlerbiografie und der "Film-Vermeer" hinsichtlich Ihrer Darstellung miteinander verglichen.
Der Historienfilm „Das Mädchen mit dem Perlenohrring“ von Regisseur Peter Webber beruht laut seiner eigenen Aussage zum größten Teil auf einer fiktiven Romanvorlage. Tatsächlich spiegelt der Spielfilm aus dem Jahr 2003 in vielen Sequenzen das zeitgenössische Leben um 1665 in Delft wider. Das Leben des Malers Jan Vermeer wird dem Publikum hierbei vor allem durch die Augen seiner Dienstmagd Grit nähergebracht, welche sich auch hinter dem rätselhaften Porträt „Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge“ von 1665 verbergen soll. Da es trotz unzähliger Biografien über das Leben des flämischen Künstlers kaum verschriftliche Nachweise über die Beweggründe und Entstehungsprozesse seiner Werke zu finden gibt, ist es schwierig, über Vermeers Malintention zu recherchieren. Trotzdem fasziniert vor allem sein „Perlenmädchen“ Gemälde seit vielen Jahren die Forschung und Kunstinteressierte. Die dargestellte Frau wirkt mit ihrer milchig- blassen Haut wie eine Porzellanpuppe. Die weichen Gesichtszüge wurden nur mithilfe von Licht und Perspektive ohne erkennbare Pinselstriche auf die Leinwand gebracht. Eine Technik, welche der Künstler extra für dieses Werk konzipiert hatte. Auch wirft die träumerisch verklärte Darstellung des Mädchens mit Turban Fragen nach der Rezeption auf. Wen hat Jan Vermeer hier so eindrucksvoll verewigt? Eine Frage mit der sich der Film „Das Mädchen mit dem Perlenohrring“ spielerisch auseinandersetzt und dabei auf der Basis einer fiktiven Geschichte viel Wahrheitsgetreues aus Vermeers Leben widerspiegelt. Welche Stilmittel Vermeers adaptiert der Film hierbei? Gibt es Parallelen zwischen dem historischen und dem Film Vermeer? Schadet der Grad der Fiktionalisierung dem Erbe des Künstlers oder ist er für seinen Nachruhm eher förderlich?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ein Künstlerfilm auf der Basis von Fiktion
- Der historische Jan Vermeer
- Von Delft nach Hollywood- Vermeers Leben als Film
- Zwischen Realität und Fiktion – die Figurenkonstellation
- Der Film Vermeer
- Der Patron Pieter van Ruijven
- Vermeers Frauen
- Die Magd Grit
- Mit den Augen Vermeers- filmstilistische Mittel
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Verfilmung des Romans „Das Mädchen mit dem Perlenohrring“ von Tracy Chevalier und untersucht, inwieweit der Film das Leben und Werk des niederländischen Malers Jan Vermeer auf Grundlage von Fiktion widerspiegelt.
- Vermeer als Künstler im Kontext der holländischen Malerei des 17. Jahrhunderts
- Der Film als fiktive Interpretation des Lebens und Werks Vermeers
- Die Rezeption von Vermeers Kunst in der Gegenwart
- Die Rolle der fiktiven Figuren im Film und deren Bezug zur historischen Realität
- Die filmischen Mittel, die verwendet werden, um Vermeers Kunst zu visualisieren
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung bietet eine Einführung in das Thema und stellt die Relevanz des Films „Das Mädchen mit dem Perlenohrring“ als Quelle für die Analyse von Vermeers Werk dar.
Kapitel 2 untersucht den Film als künstlerische Adaption des Lebens und Werks von Vermeer. Es beleuchtet den historischen Jan Vermeer und seine Rolle in der holländischen Malerei sowie den Einfluss, den der Film auf die Rezeption von Vermeers Kunst hat.
Kapitel 3 analysiert die Figurenkonstellation im Film und setzt diese in Bezug zu den historischen Personen, die Vermeer umgaben. Es beleuchtet die Rolle von vermeintlichen Figuren wie Grit, Vermeers Dienstmagd, und deren Einordnung in die künstlerische Schöpfung Vermeers.
Kapitel 4 beschäftigt sich mit den filmstilistischen Mitteln, die im Film verwendet werden, um Vermeers Kunst zu visualisieren. Es geht dabei um die Frage, inwieweit der Film die Perspektive Vermeers einfangen und seine künstlerischen Techniken visualisieren kann.
Das Resümee fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und bietet eine abschließende Bewertung des Films als Rezeption von Vermeers Werk.
Schlüsselwörter
Jan Vermeer, holländische Malerei, 17. Jahrhundert, Film, Fiktion, „Das Mädchen mit dem Perlenohrring“, Figurenkonstellation, filmstilistische Mittel, Rezeption, Kunstgeschichte
- Quote paper
- Sarah Popp (Author), 2020, "Durch die Augen der Muse". Leben und Werk des Künstlers Vermeer auf Grundlage von Fiktion, anhand des Films "Das Mädchen mit dem Perlenohrring", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1154912