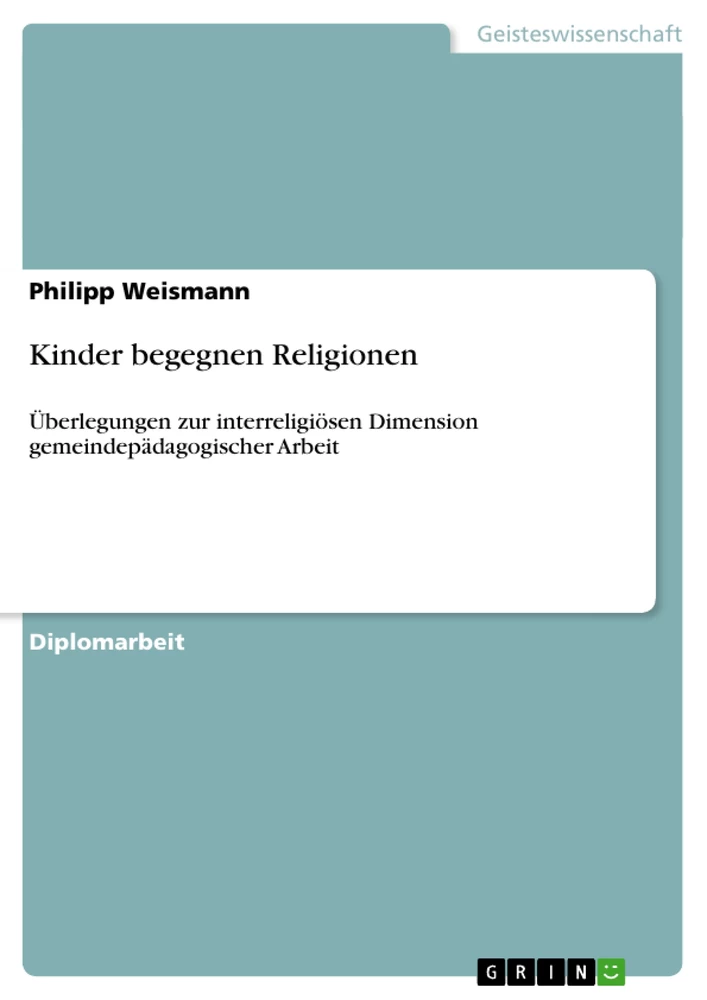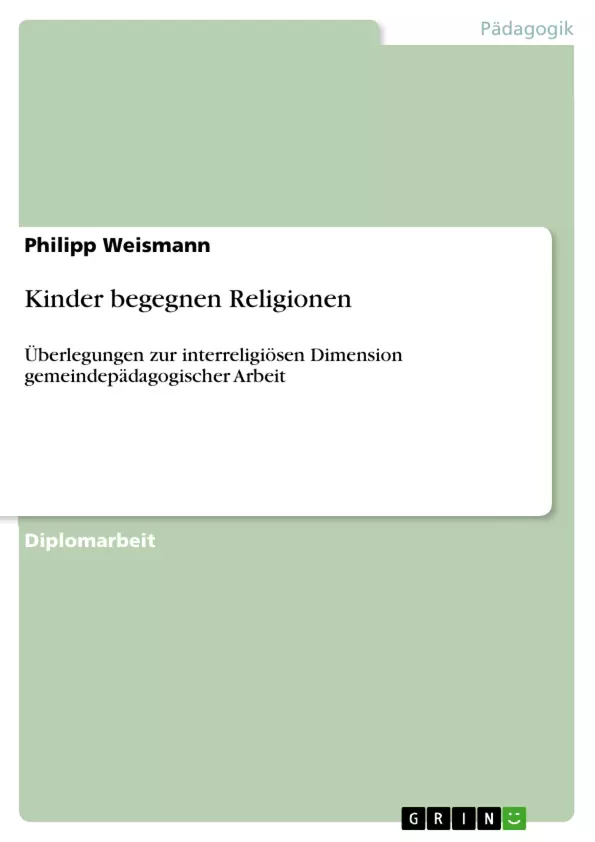Diese Arbeit soll aufzeigen, welchen neuen Fragen zur Religiosität und Interreligiosität ihrer Arbeit sich kirchliche Mitarbeiter in unserer Zeit stellen müssen, welche Entscheidungen wir in grenzwertigen Situationen zu treffen haben, und wie unsere Kirchgemeinden reagieren könnten, wenn sie diese Problemwahrnehmung teilen. Welche Begegnungen können und müssen wir den Kindern in unseren Gemeinden ermöglichen und wie können auch Kirchgemeinden dazu beitragen, ein fruchtbares Miteinander der verschiedenen Glaubensrichtungen zu gestalten?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Darstellung und Analyse der Situation - der Diskussionszusammenhang
- Auf der Suche nach einer Standortbestimmung
- Aspekte gegenwärtigen Kindererlebens
- Veränderung des religiösen Spektrums
- Die demographische Situation
- Situation in den Familien
- Das soziale Umfeld der Kinder
- Medienwelten
- Begegnungen von Menschen, Traditionen und Religionen
- Begegnungsräume
- Religionsunterricht (RU)
- Gemeinde, Christenlehre
- Zusammenfassung
- Leben und Welt aus der Sicht von Kindern
- Die Entwicklung der (religiösen) Identität bei Kindern
- Religion und Kognition
- Erik Erikson und die Entwicklung der Identität
- Kognitive Stufen der Religionspsychologie
- Stufen der Glaubensentwicklung (James Fowler)
- Zusammenfassung
- Moralentwicklung
- Weiterentwicklung gesellschaftlicher Normen und Moralvorstellungen
- Denken kontra Handeln?
- Bezugspunkte und Zielsetzung der Moralentwicklung
- Entwicklung von moralischer Autonomie
- Lawrence Kohlberg und die Stufen des moralischen Urteils
- Zusammenfassung
- Religiöses Urteil
- Der Begriff der Religion bei Oser
- Ergänzende Untersuchungen und Reflexionen zu Oser
- Was brauchen die Kinder?
- Perspektivwechsel?
- Das Christentum und die anderen Religionen
- Das Christentum herausgefordert im pluralen Kontext
- Theologische Diskurse zum Verhältnis der Religionen
- Exklusivismus
- Inklusivismus
- Pluralismus
- Die Suche nach Wahrheit
- Kritische Schlussfolgerungen
- Religion als Begriff für Glaubensgemeinschaften
- Die Religionen im Licht christlich-theologischer Leitdifferenzierungen
- Christentum als Konstitution des Dialoges
- Anmerkungen zum Dialogbegriff
- Christentum und Dialog
- Der Mensch als von Gott geschaffenes Wesen
- Das Kriterium der Nächsten- und Feindesliebe
- Jesus Christus als „Begegnung in Person"
- Die Asymmetrie des christlichen Projektes
- Grundsätze evangelischer Dialogarbeit
- Handlungsperspektiven
- Ziele Gemeindepädagogischen Handelns
- Grundsätze evangelischen Bildungsverständnisses
- Blockaden!
- Gemeinde als Lernraum für alle
- Dialog mit Kindern
- Möglichkeiten der Begegnung
- Resümee: Chancen und Grenzen
- Anlagen
- Literaturverzeichnis
- Selbständigkeitserklärung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der interreligiösen Dimension gemeindepädagogischer Arbeit im Kontext der Begegnung von Kindern mit verschiedenen Religionen. Sie analysiert die aktuelle Situation in Deutschland, die durch zunehmende Multikulturalität und Multireligiosität geprägt ist, und beleuchtet die Herausforderungen, die sich daraus für die Arbeit mit Kindern in christlichen Gemeinden ergeben.
- Die Entwicklung der (religiösen) Identität bei Kindern im Kontext der Begegnung mit verschiedenen Religionen
- Die Bedeutung von Moralentwicklung und religiösem Urteil für das Verständnis und den Umgang mit anderen Religionen
- Theologische Diskurse zum Verhältnis der Religionen und die Herausforderungen für die christliche Gemeinde im Dialog mit anderen Religionen
- Ziele und Grundsätze gemeindepädagogischen Handelns im interreligiösen Kontext
- Möglichkeiten und Grenzen der Begegnung von Kindern mit verschiedenen Religionen in der Gemeinde
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik der Begegnung von Kindern mit verschiedenen Religionen in der heutigen Gesellschaft dar und skizziert die Zielsetzung der Arbeit. Kapitel 1 analysiert die aktuelle Situation in Deutschland, die durch zunehmende Multikulturalität und Multireligiosität geprägt ist. Es werden die Veränderungen im religiösen Spektrum, die demographische Situation, die Situation in den Familien, das soziale Umfeld der Kinder und die Medienwelten beleuchtet. Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Entwicklung der (religiösen) Identität bei Kindern und untersucht die Bedeutung von Moralentwicklung und religiösem Urteil für das Verständnis und den Umgang mit anderen Religionen. Kapitel 3 beleuchtet die theologischen Diskurse zum Verhältnis der Religionen und die Herausforderungen für die christliche Gemeinde im Dialog mit anderen Religionen. Kapitel 4 untersucht die Bedeutung des Dialoges für das Christentum und die Prinzipien evangelischer Dialogarbeit. Kapitel 5 widmet sich den Zielen und Grundsätzen gemeindepädagogischen Handelns im interreligiösen Kontext und beleuchtet die Möglichkeiten und Grenzen der Begegnung von Kindern mit verschiedenen Religionen in der Gemeinde.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die interreligiöse Dimension, gemeindepädagogische Arbeit, Kinder, Religionen, Multikulturalität, Multireligiosität, Identität, Moralentwicklung, religiöses Urteil, theologische Diskurse, Dialog, evangelische Dialogarbeit, Begegnung, Gemeinde, Lernraum, Chancen und Grenzen.
- Quote paper
- Philipp Weismann (Author), 2007, Kinder begegnen Religionen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/115550