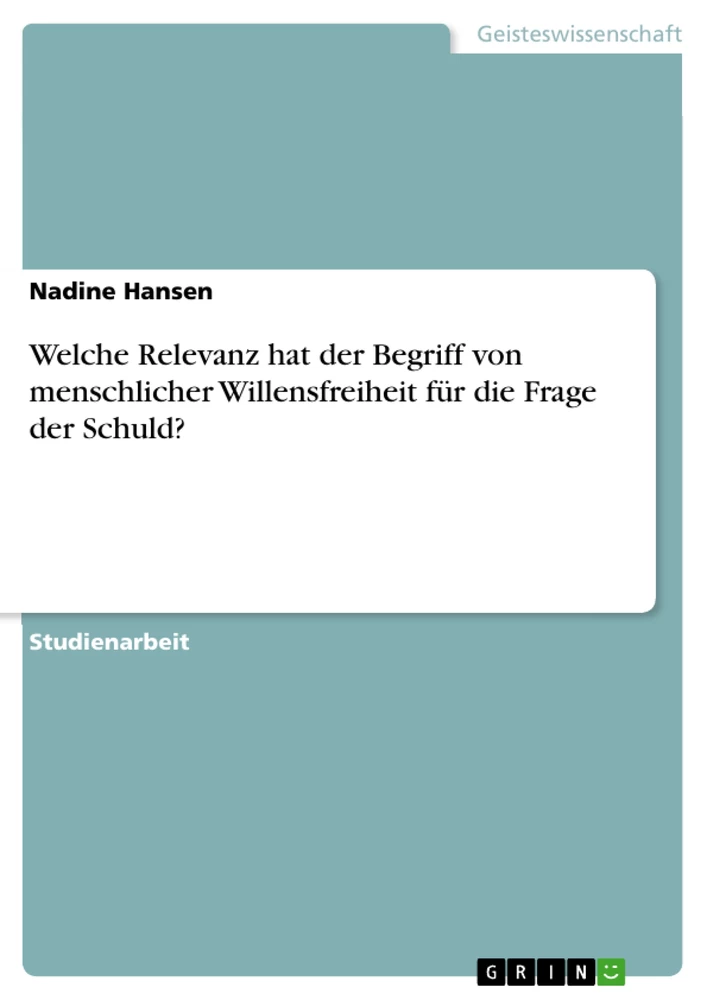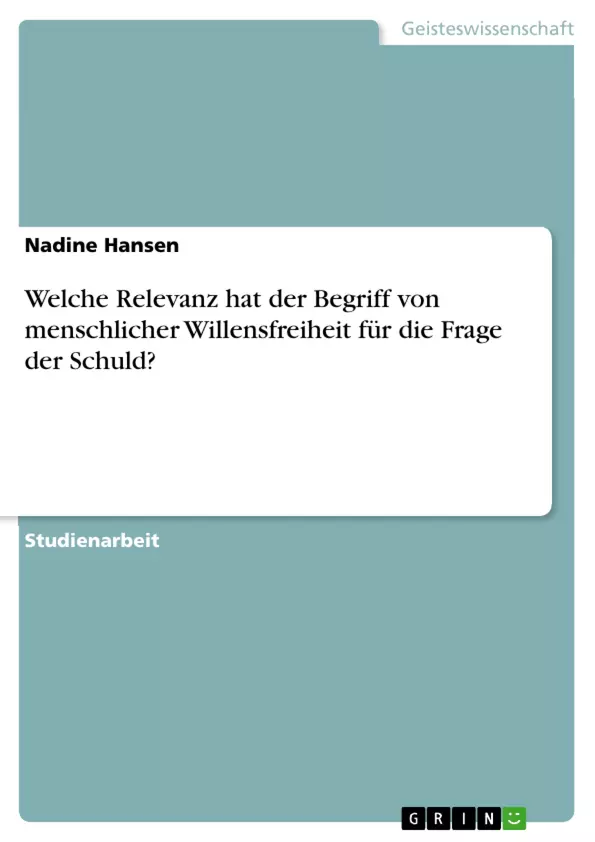Die Frage danach, ob der menschliche Wille frei oder determiniert ist, beschäftigt seit
jeher die Philosophie. Die Beantwortung dieser Frage ist in jedem Fall folgenschwer,
denn sie macht grundlegende Aussagen über das Wesen des Menschen und von ihr
hängt ab, wie weit dem Menschen Verantwortung für seine Taten übertragen werden
kann.
Es ist so, dass man unterstellen kann, alle Menschen der Vergangenheit und der
Gegenwart empfinden sehr sensibel, ob ihnen Unrecht getan wird oder ob Recht waltet.
Jeder Mensch, selbst ein mehrfacher Mörder, verabscheut in seinem Wesen
Ungerechtigkeit ihm selbst gegenüber. Der einfachste Gedanke wäre wohl der, dass
Menschen das vermeiden, was sie selbst verabscheuen. In diesem Fall ungerechtes
Handeln. Warum ist das nicht so? Stattdessen wird unser Zusammenleben von
Gesetzen geregelt, die den Menschen vor dem Menschen schützen. Zumindest kann
man sich fragen, ob der Mensch einfach unfrei ist und nicht anders handeln kann und
wenn ja, was steht über ihm und beeinflusst ihn und sein Handeln?
Mit David Humes Theorie soll eine traditionelle philosophische Position dargestellt
werden. Gleichzeitig soll erfahrbar sein, ob diese Theorie noch in der Gegenwart
Geltung haben kann und wie der Einfluss der Frage nach der Willensfreiheit aus
philosophischer Sicht, auf die Schuld in den jüngeren Rechtswissenschaften hat.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1,1. Einleitung
- 2. Die Nicht- Existenz der Willensfreiheit am Beispiel von David Hume
- 3. Nulla poena sine culpa- Das Schuldprinzip
- 3.1. § 20 des StGB.
- 3.2. Freier Wille und Strafrecht: Streitgespräch
- 4. Zwischenfazit
- 5. Hirnforschung statt Erkenntnistheorie..
- 6. Strafe ohne Schuld...
- 6.1. Die Präventionsstrafe.......
- 7. Schluss..
- Bibliographie:.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage nach der Relevanz des Begriffs der menschlichen Willensfreiheit für die Frage der Schuld. Sie analysiert die philosophischen und rechtlichen Aspekte dieser Thematik und untersucht, inwieweit die Annahme einer determinierten Willensfreiheit Auswirkungen auf die Strafbarkeit von Handlungen hat.
- Die Nicht-Existenz der Willensfreiheit nach David Hume
- Das Schuldprinzip im Strafrecht
- Die Rolle der Hirnforschung in der Debatte um Willensfreiheit und Schuld
- Die Frage nach der Strafbarkeit ohne Schuld
- Die Bedeutung der Willensfreiheit für die Verantwortlichkeit des Menschen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Willensfreiheit und Schuld ein und stellt die Relevanz der Frage nach der Willensfreiheit für die Frage der Schuld dar. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven auf die Willensfreiheit und die damit verbundenen ethischen und rechtlichen Implikationen.
Das zweite Kapitel analysiert die Theorie von David Hume, der die Nicht-Existenz der Willensfreiheit postuliert. Hume argumentiert, dass menschliches Handeln einem Ursache-Wirkungsprinzip unterliegt und dass der Wille determiniert ist. Er stellt die Frage, ob der Mensch für seine Handlungen verantwortlich gemacht werden kann, wenn sein Wille nicht frei ist.
Das dritte Kapitel befasst sich mit dem Schuldprinzip im Strafrecht. Es wird erläutert, dass das Schuldprinzip eine zentrale Grundlage des deutschen Strafrechts darstellt und dass die Strafbarkeit von Handlungen von der Schuld des Täters abhängt. Das Kapitel analysiert die Bedeutung des Begriffs der Schuld im Strafrecht und die Auswirkungen der Annahme einer determinierten Willensfreiheit auf das Schuldprinzip.
Das vierte Kapitel stellt ein Zwischenfazit dar und fasst die wichtigsten Erkenntnisse der vorherigen Kapitel zusammen. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die Annahme einer determinierten Willensfreiheit die Strafbarkeit von Handlungen in Frage stellt.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit der Rolle der Hirnforschung in der Debatte um Willensfreiheit und Schuld. Es werden die Erkenntnisse der Hirnforschung zur Willensfreiheit vorgestellt und die Frage diskutiert, inwieweit diese Erkenntnisse Auswirkungen auf die Frage der Schuld haben.
Das sechste Kapitel untersucht die Frage nach der Strafbarkeit ohne Schuld. Es werden verschiedene Strafkonzepte vorgestellt, die eine Strafbarkeit ohne Schuld ermöglichen, wie beispielsweise die Präventionsstrafe.
Der Schluss fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und stellt die Relevanz der Frage nach der Willensfreiheit für die Frage der Schuld heraus. Es werden die ethischen und rechtlichen Implikationen der verschiedenen Positionen zur Willensfreiheit diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Willensfreiheit, Determinismus, Schuld, Strafrecht, Strafbarkeit, Präventionsstrafe, Hirnforschung, Verantwortung, Kausalität, Motive, Handlungsfreiheit, David Hume, Nulla poena sine culpa.
- Quote paper
- Nadine Hansen (Author), 2007, Welche Relevanz hat der Begriff von menschlicher Willensfreiheit für die Frage der Schuld?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/115567