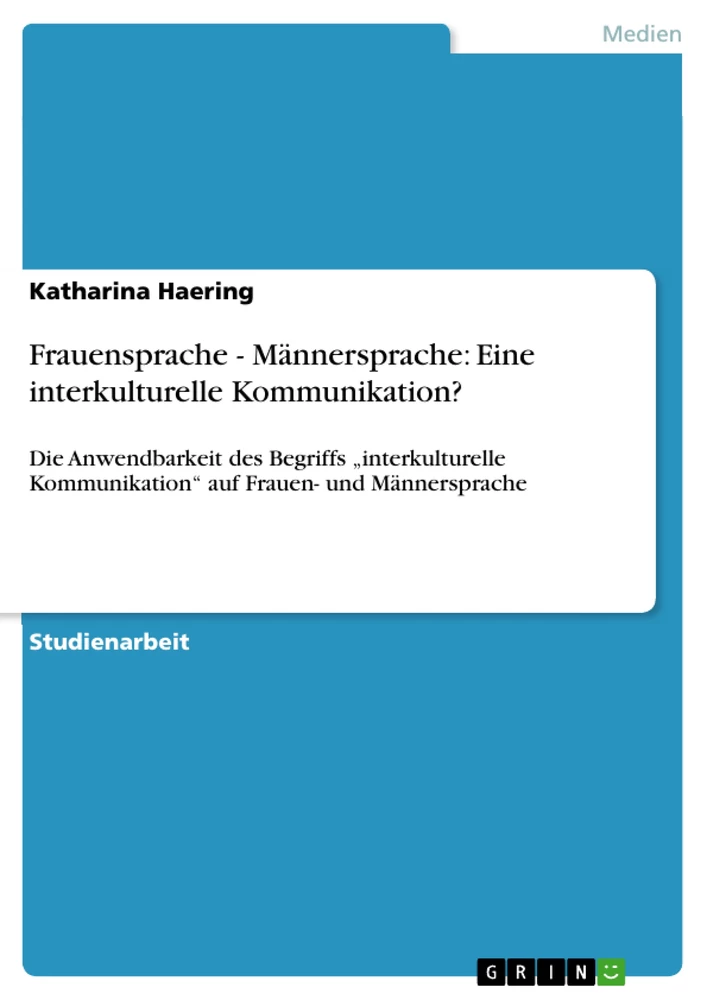Im ersten Teil der Arbeit geht es darum, zu überprüfen, ob der Begriff „interkulturelle
Kommunikation“ unter der Annahme, dass geschlechtstypische Unterschiede bestehen, auf
die Kommunikation zwischen Männern und Frauen angewendet werden kann.
Dazu soll dem Leser zunächst ein Überblick über die als weiblich und männlich geltenden
Kommunikationsmerkmale gegeben werden. Diese werden in einer Tabelle aufgelistet.
Anschließend soll der Begriff „interkulturelle Kommunikation“ definiert und probeweise auf
die Kommunikation zwischen Männern und Frauen angewandt werden. Damit soll überprüft
werden, was man demnach unter Kommunikation zwischen Geschlechtern verstehen müsste.
Die sich aus der hypothetischen Anwendung ergebenden Schlussfolgerungen sollen dann
konkret auf die zuvor in der Tabelle genannten Merkmale wie beispielsweise „gebrauchen
indirekte Formulierungen“ angewendet werden. Da sich aus dieser hypothetischen
Anwendung des Begriffs der interkulturellen Kommunikation auf Männer- und Frauensprache
Kritik am „Zwei- Kulturen Ansatz“ ergibt, folgt diese anschließend in einem Abschnitt.
Im zweiten Teil der Arbeit geht es um die Frage, ob die kommunikativen Unterschiede
zwischen Männern und Frauen tatsächlich so groß sind, wie lange behauptet wurde/ teilweise
immer noch behauptet wird. Da es den Rahmen einer Hausarbeit sprengen würde,
Auswertungen an großen Textkorpora vorzunehmen, sollen hierzu verschiedene neuere
Studien zu geschlechtstypischem Kommunikationsverhalten angeführt werden. Anschließend
soll eine von mir selbst durchgeführte Stichprobe anhand eines Auszugs aus einer „Sabine
Christiansen“ – Sendung vorgestellt und ausgewertet werden. Es geht hierbei um den
Gebrauch von Abtönungspartikeln und Positionsausdrücken.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hinführung und Zielvorgabe
- Vorgehensweise
- Die Anwendbarkeit des Begriffs „interkulturelle Kommunikation“ auf Männer und Frauen unter der Annahme von geschlechtstypischen Gesprächsstilen
- „Erforschte“ gesprächstypische Verhaltensweisen von Männern und Frauen
- Interkulturelle Kommunikation
- Eine Begriffsbestimmung und probeweise Anwendung auf die Kommunikation zwischen Frauen und Männer
- Die Verständigungsproblematik interkultureller Kommunikation nach K. Knapp und K. Brinker
- Zusammenfassung
- Kritik am Zwei- Kulturen Ansatz
- Sprechen Männer und Frauen tatsächlich so unterschiedlich?
- Neuere Ergebnisse der Geschlechterforschung: Hängt ein bestimmtes Kommunikationsverhalten nicht doch maßgeblich von anderen Faktoren als dem Geschlecht ab?
- Die Positionsausdrücke (P-A)
- Der Gebrauch von Abtönungspartikeln und Positionsausdrücken in einer Sendung von „Sabine Christiansen“: Eine Stichprobe
- Die Abtönungspartikel (A-P)
- Zusammenfassung
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Anhang: Transkript Sabine Christiansen - Überflüssigkeit der Religion?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, ob der Begriff „interkulturelle Kommunikation“ auf die Kommunikation zwischen Männern und Frauen anwendbar ist, selbst wenn Unterschiede im Kommunikationsverhalten bestehen. Die Arbeit untersucht, ob die Unterschiede im Kommunikationsverhalten von Männern und Frauen tatsächlich so groß sind, wie lange behauptet wurde.
- Untersuchung der Anwendbarkeit des Begriffs „interkulturelle Kommunikation“ auf die Kommunikation zwischen Männern und Frauen
- Analyse von „erforschten“ gesprächstypischen Verhaltensweisen von Männern und Frauen
- Kritik am „Zwei-Kulturen Ansatz“
- Bewertung neuerer Ergebnisse der Geschlechterforschung
- Analyse des Gebrauchs von Abtönungspartikeln und Positionsausdrücken in einer Sendung von „Sabine Christiansen“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der „Männersprache“ und „Frauensprache“ ein und stellt die Zielsetzung der Arbeit dar. Sie beleuchtet die historische Entwicklung der Forschung zu geschlechtstypischem Kommunikationsverhalten und stellt die These auf, dass die Unterschiede im Kommunikationsverhalten von Männern und Frauen möglicherweise nicht so groß sind, wie lange behauptet wurde.
Das zweite Kapitel untersucht die Anwendbarkeit des Begriffs „interkulturelle Kommunikation“ auf die Kommunikation zwischen Männern und Frauen. Es werden typische Merkmale des weiblichen und männlichen Kommunikationsverhaltens vorgestellt und der Begriff „interkulturelle Kommunikation“ definiert. Anschließend wird der Begriff probeweise auf die Kommunikation zwischen Männern und Frauen angewandt, um zu überprüfen, was man demnach unter Kommunikation zwischen Geschlechtern verstehen müsste. Die sich aus dieser hypothetischen Anwendung ergebenden Schlussfolgerungen werden dann konkret auf die zuvor genannten Merkmale angewendet. Abschließend wird Kritik am „Zwei-Kulturen Ansatz“ geäußert.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Frage, ob die kommunikativen Unterschiede zwischen Männern und Frauen tatsächlich so groß sind, wie lange behauptet wurde. Es werden verschiedene neuere Studien zu geschlechtstypischem Kommunikationsverhalten vorgestellt und eine von der Autorin selbst durchgeführte Stichprobe anhand eines Auszugs aus einer „Sabine Christiansen“ Sendung vorgestellt und ausgewertet. Es geht hierbei um den Gebrauch von Abtönungspartikeln und Positionsausdrücken.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die „Männersprache“, die „Frauensprache“, die „interkulturelle Kommunikation“, die „Zwei-Kulturen-Theorie“, die „Differenzhypothese“, die „Abtönungspartikel“, die „Positionsausdrücke“ und die „Genderforschung“. Der Text analysiert die Unterschiede im Kommunikationsverhalten von Männern und Frauen und hinterfragt die Gültigkeit des „Zwei-Kulturen-Ansatzes“. Er beleuchtet die Frage, ob die Unterschiede im Kommunikationsverhalten von Männern und Frauen tatsächlich so groß sind, wie lange behauptet wurde, oder ob andere Faktoren eine größere Rolle spielen.
Häufig gestellte Fragen
Kann man Kommunikation zwischen Geschlechtern als "interkulturell" bezeichnen?
Die Arbeit untersucht den "Zwei-Kulturen-Ansatz", der davon ausgeht, dass Männer und Frauen in unterschiedlichen Kommunikationskulturen aufwachsen.
Was sind typische Merkmale der sogenannten "Frauensprache"?
Oft werden Merkmale wie der häufigere Gebrauch von Abtönungspartikeln, indirekte Formulierungen und ein beziehungsorientierter Stil genannt.
Was besagt die Kritik am "Zwei-Kulturen-Ansatz"?
Neuere Forschungen legen nahe, dass Kommunikationsunterschiede weniger vom Geschlecht als vielmehr von Status, Kontext und individueller Position abhängen.
Was sind Abtönungspartikel und Positionsausdrücke?
Es handelt sich um sprachliche Mittel, die die Einstellung des Sprechers verdeutlichen oder die Stärke einer Aussage modifizieren (z.B. "vielleicht", "halt", "eben").
Wie wurde die Stichprobe zur "Sabine Christiansen"-Sendung ausgewertet?
Die Autorin analysierte ein Transkript der Sendung auf geschlechtstypische Sprachmuster, um die theoretischen Thesen in der Praxis zu prüfen.
- Quote paper
- Bachelor of Arts Katharina Haering (Author), 2005, Frauensprache - Männersprache: Eine interkulturelle Kommunikation?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/115571