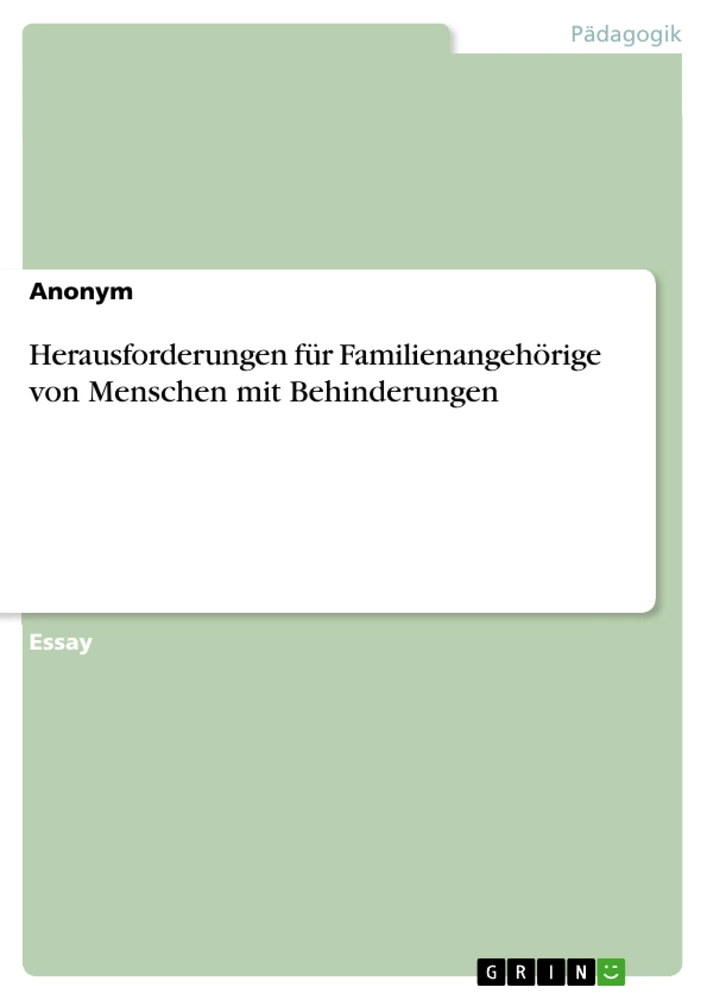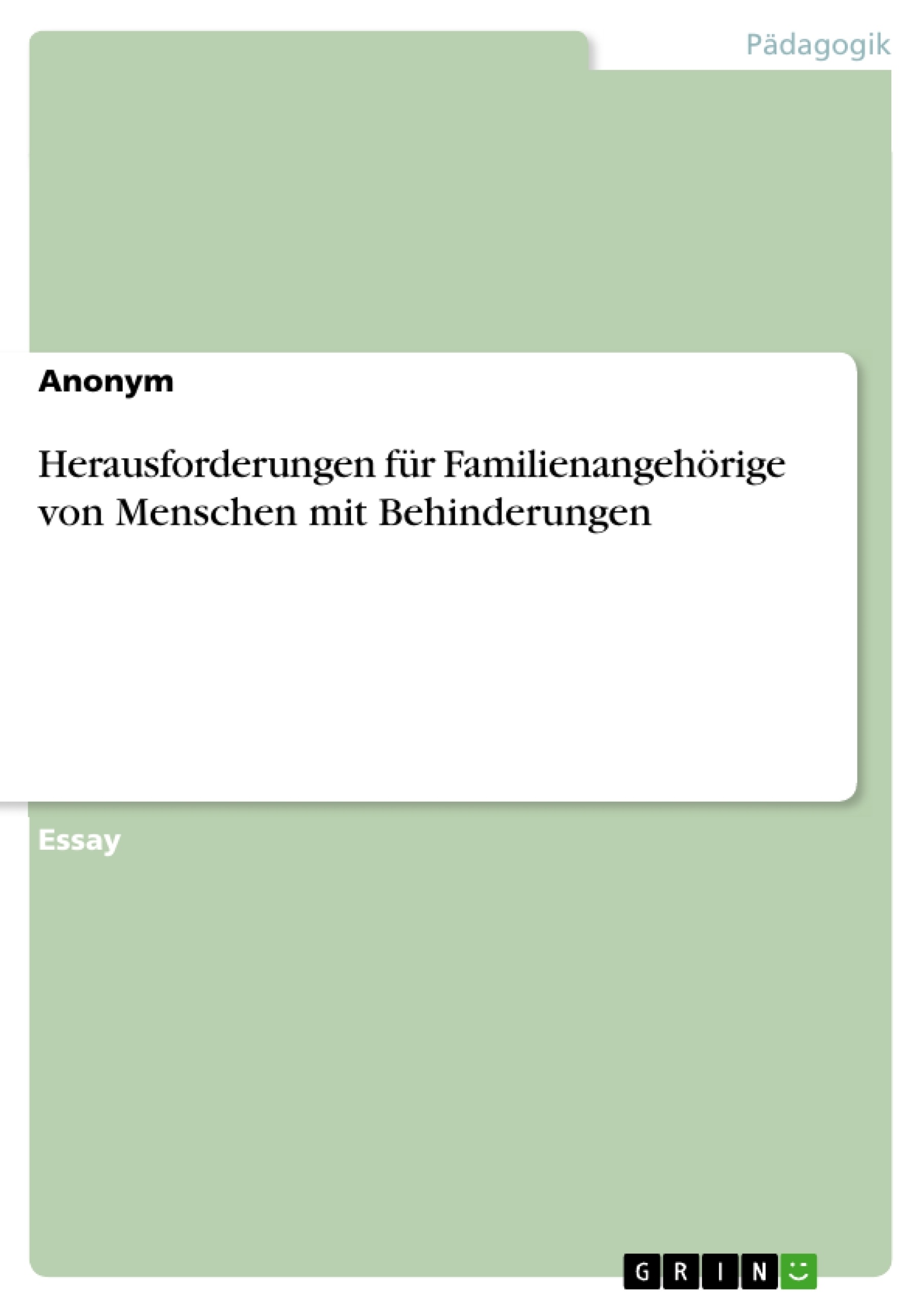Das Leben mit einer Behinderung, sei es die eigene Behinderung oder die Behinderung eines Angehörigen kann mit vielen Herausforderungen verbunden sein. In Deutschland leben im Jahr 2021 16,8 Millionen Menschen mit Behinderungen, davon 7,5 Millionen mit einer Schwerbehinderung (bmas.de 2018). Dieses Scientific Essay befasst sich mit der herausfordernden Situation der Eltern und weiteren Familienangehörigen von Menschen mit Behinderungen.
Bei Diagnostizierung einer Behinderung werden Familien und ihre Angehörigen vor große Belastungsproben gestellt. Bezüglich der Lebensplanung, des situativen Alltags, der Beziehungsgestaltung sowie der Rollenerwartung warten einige Hindernisse auf die Familienangehörigen sowie auf die Person selbst. Der ursprünglich entworfene Lebensplan wird durch das Ereignis der Diagnosestellung eines Kindes mit Behinderung durcheinandergebracht. Im Fokus steht der gesundheitliche Aspekt, da die Eltern ihr Kind je nach Förderungsbedarf unterstützen müssen. Zahlreiche Termine mit geschultem Fachpersonal und die Auswahl der passenden Therapiemöglichkeiten stehen im Vordergrund. Später sind eine gelingende Integration in der Schule, die Suche nach einem Beruf sowie der mögliche Auszug aus dem Elternhaus von besonderer Bedeutung.
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich dieses Scientific Essay mit folgender zentraler Fragestellung: Welche Herausforderungen müssen die Familien von Menschen mit Behinderung bewältigen und welche Möglichkeit hat die Soziale Arbeit diesen Herausforderungen zu begegnen?
Das vorliegende Essay befasst sich zunächst mit der Begriffserklärung in dem theoretischen Teil (Kapitel 2) und führt im Kapitel 3 die Herausforderungen in Bezug auf die biografischen Stationen eines jeden Individuums auf. Die prägnanten Lebenszyklen von der Geburt bis hin zur Verselbstständigung werden gekürzt dargestellt. Kapitel 4 beinhaltet die besondere Rolle der Geschwister eines Menschen mit Behinderung. Anschließend beschreibt Kapitel 5 das Empowerment-Konzept als Handlungsempfehlung bezogen auf die Soziale Arbeit. In dem Fazit (Kapitel 6) werden die einzelnen Schlussfolgerungen zusammengefasst reflektiert und die eigene Meinung der Verfasserin dieses Scientific Essays dargelegt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Begriffserklärung
- 2.1 Behinderung
- 3 Lebenslauftypische Stationen und ihre Herausforderungen
- 3.1 Geburt, Kindergarten, Schule
- 3.2 Übergang in die Verselbstständigung
- 4 Die Rolle der Geschwister und deren familiäre Situation
- 5 Handlungsempfehlung im Hinblick auf das Berufsfeld der Sozialen Arbeit
- 5.1 Empowerment
- 5.1.1 Begriffserklärung
- 5.1.2 Handlungsmodell
- 5.1 Empowerment
- 6 Fazit und eigene Meinung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Scientific Essay untersucht die Herausforderungen, denen Familien von Menschen mit Behinderungen gegenüberstehen. Es beleuchtet die Auswirkungen einer Behinderung auf den familiären Alltag und die Lebensplanung der betroffenen Familien in verschiedenen Lebensphasen. Weiterhin wird ein Handlungsansatz aus dem Bereich der Sozialen Arbeit skizziert.
- Herausforderungen für Familien in verschiedenen Lebensphasen (Geburt, Schule, Verselbstständigung)
- Die Rolle und Situation von Geschwistern von Menschen mit Behinderungen
- Das Empowerment-Konzept in der Sozialen Arbeit
- Die Bedeutung von Inklusion im Kontext von Behinderung
- Möglichkeiten der Sozialen Arbeit zur Unterstützung von Familien
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Herausforderungen für Familienangehörige von Menschen mit Behinderungen ein. Sie benennt die hohe Anzahl von Menschen mit Behinderungen in Deutschland und skizziert die Belastungssituation der Familien. Die zentrale Forschungsfrage lautet: Welche Herausforderungen müssen die Familien von Menschen mit Behinderung bewältigen und welche Möglichkeit hat die Soziale Arbeit diesen Herausforderungen zu begegnen? Die Struktur des Essays wird vorgestellt.
2 Begriffserklärung: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Behinderung" unter Berücksichtigung verschiedener wissenschaftlicher Perspektiven und rechtlicher Grundlagen (Bundesteilhabegesetz, ICF-CY, UN-Behindertenrechtskonvention). Es wird die unterschiedliche Interpretation des Begriffs in der Literatur beleuchtet und die Bedeutung von Inklusion hervorgehoben.
3 Lebenslauftypische Stationen und ihre Herausforderungen: Dieses Kapitel behandelt die Herausforderungen für Familien von Menschen mit Behinderungen in verschiedenen Lebensphasen. Es beginnt mit der Geburt und den damit verbundenen emotionalen und organisatorischen Belastungen, geht auf die Herausforderungen im Kindergarten und in der Schule ein, inklusive des Themas inklusive Pädagogik und der oft unzureichenden Versorgung mit integrativen Plätzen.
4 Die Rolle der Geschwister und deren familiäre Situation: Dieses Kapitel fokussiert sich auf die spezifische Situation der Geschwister von Menschen mit Behinderung. Es beleuchtet die Auswirkungen der Behinderung des Geschwisterkindes auf die Geschwister selbst, ihre familiäre Rolle und ihre Entwicklung. (Der genaue Inhalt dieses Kapitels ist aufgrund der fehlenden Textpassage nicht vollständig rekonstruierbar.)
5 Handlungsempfehlung im Hinblick auf das Berufsfeld der Sozialen Arbeit: Dieses Kapitel behandelt das Empowerment-Konzept als Handlungsansatz für die Soziale Arbeit im Umgang mit den Herausforderungen von Familien mit Menschen mit Behinderung. Es erklärt den Begriff Empowerment und skizziert ein mögliches Handlungsmodell für Sozialarbeiter, das betroffene Familien unterstützt. (Der genaue Inhalt dieses Kapitels ist aufgrund der fehlenden Textpassage nicht vollständig rekonstruierbar.)
Schlüsselwörter
Behinderung, Inklusion, Familie, Soziale Arbeit, Empowerment, Herausforderungen, Lebenslauf, Geschwister, Bundesteilhabegesetz, ICF-CY, UN-Behindertenrechtskonvention, integrative Pädagogik.
Häufig gestellte Fragen zum wissenschaftlichen Essay: Herausforderungen für Familien von Menschen mit Behinderungen
Was ist der Gegenstand des wissenschaftlichen Essays?
Der Essay untersucht die Herausforderungen, denen Familien von Menschen mit Behinderungen in verschiedenen Lebensphasen gegenüberstehen. Er beleuchtet die Auswirkungen einer Behinderung auf den familiären Alltag und die Lebensplanung und skizziert einen Handlungsansatz aus der Sozialen Arbeit.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die zentralen Themen sind die Herausforderungen für Familien in verschiedenen Lebensphasen (Geburt, Schule, Verselbstständigung), die Rolle und Situation von Geschwistern, das Empowerment-Konzept in der Sozialen Arbeit, die Bedeutung von Inklusion und Möglichkeiten der Sozialen Arbeit zur Unterstützung von Familien.
Welche Kapitel umfasst der Essay?
Der Essay gliedert sich in eine Einleitung, eine Begriffserklärung von „Behinderung“, ein Kapitel zu lebenslauftypischen Stationen und deren Herausforderungen, ein Kapitel zur Rolle der Geschwister, ein Kapitel mit Handlungsempfehlungen für die Soziale Arbeit und ein Fazit.
Wie wird der Begriff „Behinderung“ definiert?
Der Essay definiert „Behinderung“ unter Berücksichtigung verschiedener wissenschaftlicher Perspektiven und rechtlicher Grundlagen wie dem Bundesteilhabegesetz, ICF-CY und der UN-Behindertenrechtskonvention. Die unterschiedliche Interpretation des Begriffs in der Literatur und die Bedeutung von Inklusion werden beleuchtet.
Welche Herausforderungen in den verschiedenen Lebensphasen werden betrachtet?
Der Essay betrachtet die Herausforderungen von der Geburt (emotionale und organisatorische Belastungen) über den Kindergarten und die Schule (inklusive Pädagogik, integrative Plätze) bis zum Übergang in die Verselbstständigung.
Welche Rolle spielen die Geschwister von Menschen mit Behinderungen?
Der Essay beleuchtet die Auswirkungen der Behinderung eines Geschwisterkindes auf die Geschwister selbst, ihre familiäre Rolle und ihre Entwicklung. Aufgrund fehlender Textpassagen sind die Details jedoch nicht vollständig rekonstruierbar.
Welchen Handlungsansatz bietet der Essay für die Soziale Arbeit?
Der Essay behandelt das Empowerment-Konzept als Handlungsansatz. Es erklärt den Begriff und skizziert ein mögliches Handlungsmodell für Sozialarbeiter zur Unterstützung betroffener Familien. Details sind aufgrund fehlender Textpassagen jedoch nicht vollständig rekonstruierbar.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für den Essay?
Schlüsselwörter sind Behinderung, Inklusion, Familie, Soziale Arbeit, Empowerment, Herausforderungen, Lebenslauf, Geschwister, Bundesteilhabegesetz, ICF-CY, UN-Behindertenrechtskonvention und integrative Pädagogik.
Was ist die zentrale Forschungsfrage des Essays?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Welche Herausforderungen müssen die Familien von Menschen mit Behinderung bewältigen und welche Möglichkeiten hat die Soziale Arbeit diesen Herausforderungen zu begegnen?
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Herausforderungen für Familienangehörige von Menschen mit Behinderungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1156385