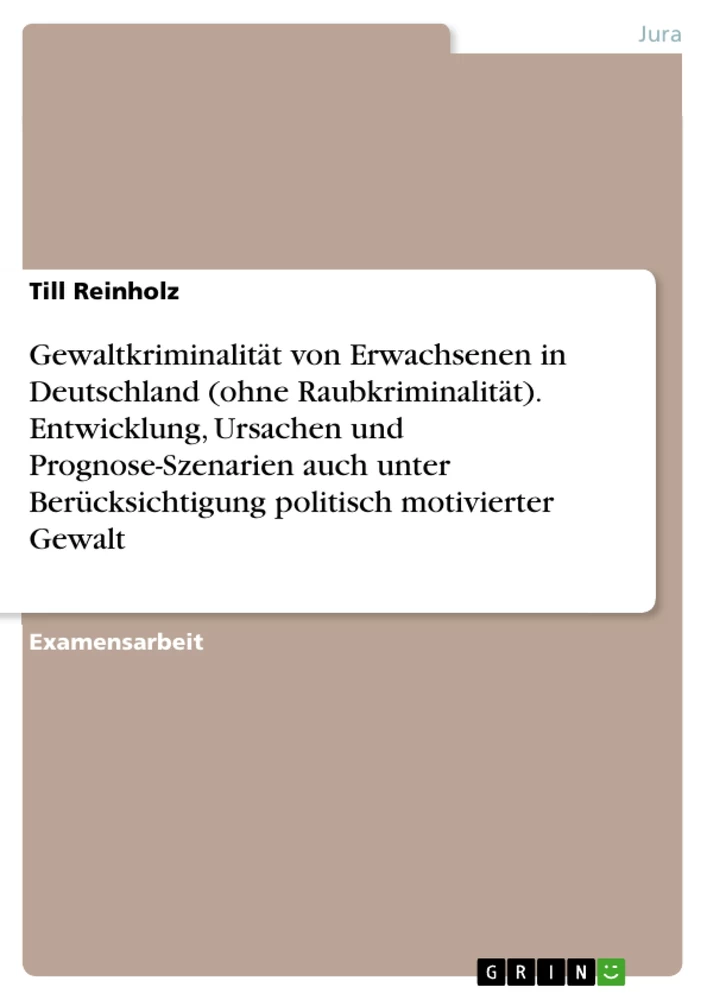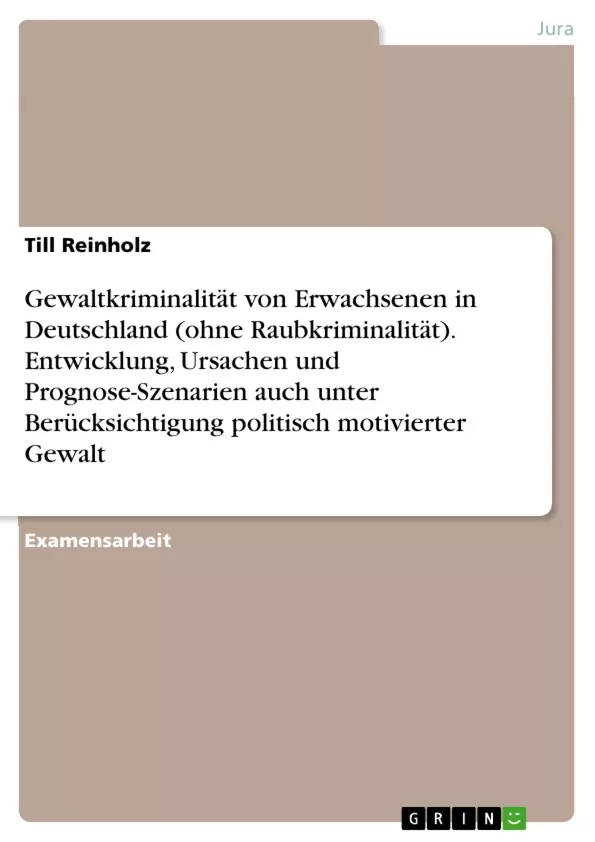Homo homini lupus – der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Der Philosoph Thomas Hobbes sah Gewalt in der Gesellschaft als Krieg aller gegen alle als Naturzustand an und deklarierte den friedlichen Zustand als erklärungsbedürftig. Hingegen versucht die moderne Kriminologie, Gewaltkriminalität als Anomalie zu begreifen und diese Abweichung vom normalen Zustand der Friedfertigkeit in all ihren Facetten zu erklären. Gewalt als Antagonist der Friedfertigkeit wird in Medien und Gesellschaft überproportional viel Aufmerksamkeit zuteil, obwohl sie lediglich 3,3 % der erfassten Gesamtkriminalität einnimmt. Die Menschen nehmen eine zunehmende Verrohung der Gesellschaft wahr, was medial ebenfalls propagiert wird und auch im politischen Diskurs der letzten Jahre an Bedeutung gewann. Seit dem 13. Jahrhundert ging die Tötungsrate in Deutschland jedoch um 98 % zurück.
Diese Arbeit soll helfen, die Entwicklung in einen historischen Kontext einzubetten und derartige Paradoxien aufzulösen, Gewaltkriminalität Erwachsener mithilfe von Fragen nach den Ursachen ihrer Entstehung besser zu verstehen und aus den gewonnen Erkenntnissen Prognosen für zukünftige Szenarien aufstellen zu können. Dabei soll politisch motivierte Gewalt besondere Aufmerksamkeit erfahren.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Definition, Abgrenzungen und Phänomenologie
- III. Historische Entwicklung und aktuelle Situation – eine empirische Grundlegung aus verschiedenen Perspektiven
- 1. Entwicklung im Hellfeld
- 2. Befunde im Dunkelfeld
- 3. Die Entwicklung aus Sicht der Bevölkerung
- 4. Zwischenfazit
- IV. Ursachen
- 1. Aggression aus evolutionsbiologischer und psychologischer Sicht
- 2. Affektive und rationale Komponenten
- 3. Frustration und situative Faktoren
- 4. Lehren und Lernen von Gewalt und Selbstkontrolle
- 5. Protektive Faktoren
- 6. Gesellschaftliche Zivilisationsprozesse
- V. Prognose-Szenarien
- 1. Best-Case-Szenario
- 2. Worst-Case-Szenario
- 3. Trend-Szenario
- VI. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die Gewaltkriminalität von Erwachsenen in Deutschland, ausgenommen Raubdelikte. Ziel ist es, die Entwicklung, Ursachen und mögliche zukünftige Szenarien dieser Kriminalität zu analysieren, wobei auch politisch motivierte Gewalt berücksichtigt wird. Die Arbeit stützt sich auf empirische Daten und verschiedene theoretische Perspektiven.
- Entwicklung der Gewaltkriminalität in Deutschland
- Ursachen und Einflussfaktoren von Gewaltkriminalität (biologisch, psychologisch, soziologisch)
- Analyse des Hellfelds und Dunkelfelds der Gewaltkriminalität
- Bedeutung gesellschaftlicher Zivilisationsprozesse
- Prognose zukünftiger Entwicklungen der Gewaltkriminalität
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema Gewaltkriminalität in Deutschland ein und skizziert den Aufbau und die Zielsetzung der Arbeit. Sie erläutert den Fokus auf Gewaltkriminalität ohne Raubdelikte und die Einbeziehung politisch motivierter Gewalt.
II. Definition, Abgrenzungen und Phänomenologie: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Gewaltkriminalität präzise und grenzt ihn von anderen Kriminalitätsformen ab. Es beschreibt das Phänomen der Gewaltkriminalität in seinen verschiedenen Ausprägungen und beleuchtet die Schwierigkeiten einer eindeutigen Definition aufgrund der Vielschichtigkeit des Themas. Es legt die methodologischen Grundlagen für die weitere Analyse fest.
III. Historische Entwicklung und aktuelle Situation – eine empirische Grundlegung aus verschiedenen Perspektiven: Dieses Kapitel analysiert die historische Entwicklung der Gewaltkriminalität in Deutschland, basierend auf empirischen Daten aus dem Hellfeld (polizeiliche Kriminalstatistik) und dem Dunkelfeld (z.B. Viktimisierungserhebungen). Es untersucht die Entwicklung politisch motivierter Gewalt im Kontext der Gesamtentwicklung. Der Vergleich verschiedener Datenquellen erlaubt eine differenzierte Betrachtung der aktuellen Situation und ihrer Einordnung in den historischen Kontext. Das Kapitel schließt mit einem Zwischenfazit, das die wichtigsten Erkenntnisse zusammenfasst.
IV. Ursachen: Dieses Kapitel beleuchtet die Ursachen von Gewaltkriminalität aus multiplen Perspektiven. Es integriert evolutionsbiologische und psychologische Erklärungsansätze für Aggression, analysiert affektive und rationale Komponenten gewalttätigen Verhaltens, und untersucht den Einfluss von Frustration, situativen Faktoren, sowie dem Lernen von Gewalt und der Rolle von Selbstkontrolle. Zusätzlich werden protektive Faktoren und gesellschaftliche Zivilisationsprozesse in ihrer Bedeutung für die Gewaltprävention diskutiert. Die verschiedenen Erklärungsansätze werden miteinander verknüpft, um ein umfassendes Verständnis der Ursachen zu ermöglichen.
V. Prognose-Szenarien: Dieses Kapitel entwickelt verschiedene Prognose-Szenarien für die zukünftige Entwicklung der Gewaltkriminalität in Deutschland – ein Best-Case-, ein Worst-Case- und ein Trend-Szenario. Jedes Szenario basiert auf den vorherigen Analysen und berücksichtigt verschiedene Einflussfaktoren und Entwicklungstrends. Es bietet eine Einschätzung möglicher zukünftiger Entwicklungen unter unterschiedlichen Bedingungen.
Schlüsselwörter
Gewaltkriminalität, Deutschland, Entwicklung, Ursachen, Prognose, Empirische Forschung, Politisch motivierte Gewalt, Hellfeld, Dunkelfeld, Aggression, Frustration, Selbstkontrolle, Zivilisationsprozess, Viktimisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur wissenschaftlichen Arbeit: Gewaltkriminalität in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Gewaltkriminalität von Erwachsenen in Deutschland, ausgenommen Raubdelikte. Berücksichtigt wird auch politisch motivierte Gewalt. Ziel ist die Analyse der Entwicklung, Ursachen und möglicher zukünftiger Szenarien dieser Kriminalität.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der Gewaltkriminalität in Deutschland, ihre Ursachen und Einflussfaktoren (biologisch, psychologisch, soziologisch), die Analyse des Hellfelds und Dunkelfelds, die Bedeutung gesellschaftlicher Zivilisationsprozesse und die Prognose zukünftiger Entwicklungen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Definition, Abgrenzungen und Phänomenologie, Historische Entwicklung und aktuelle Situation, Ursachen, Prognose-Szenarien und Resümee. Jedes Kapitel wird durch Unterkapitel weiter spezifiziert (siehe Inhaltsverzeichnis).
Wie werden die Ursachen von Gewaltkriminalität untersucht?
Die Ursachen werden aus multiplen Perspektiven beleuchtet: evolutionsbiologische und psychologische Erklärungsansätze für Aggression, affektive und rationale Komponenten gewalttätigen Verhaltens, Einfluss von Frustration und situativen Faktoren, Lernen von Gewalt, Rolle der Selbstkontrolle, protektive Faktoren und gesellschaftliche Zivilisationsprozesse.
Welche Datenquellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf empirische Daten aus dem Hellfeld (polizeiliche Kriminalstatistik) und dem Dunkelfeld (z.B. Viktimisierungserhebungen), um die historische Entwicklung und die aktuelle Situation der Gewaltkriminalität zu analysieren.
Welche Prognosen werden erstellt?
Es werden verschiedene Prognose-Szenarien für die zukünftige Entwicklung der Gewaltkriminalität erstellt: ein Best-Case-, ein Worst-Case- und ein Trend-Szenario. Diese basieren auf den vorherigen Analysen und berücksichtigen verschiedene Einflussfaktoren und Entwicklungstrends.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Gewaltkriminalität, Deutschland, Entwicklung, Ursachen, Prognose, Empirische Forschung, Politisch motivierte Gewalt, Hellfeld, Dunkelfeld, Aggression, Frustration, Selbstkontrolle, Zivilisationsprozess, Viktimisierung.
Welche methodologische Grundlage liegt der Arbeit zugrunde?
Die Arbeit legt im zweiten Kapitel die methodologischen Grundlagen für die weitere Analyse fest und nutzt eine Kombination aus empirischer Datenanalyse und theoretischen Perspektiven.
Wie ist der Aufbau der Arbeit?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, definiert den Begriff der Gewaltkriminalität und grenzt ihn ab. Danach wird die historische Entwicklung und die aktuelle Situation analysiert, bevor die Ursachen untersucht werden. Schließlich werden Prognose-Szenarien entwickelt und die Arbeit mit einem Resümee abgeschlossen.
- Quote paper
- Till Reinholz (Author), 2020, Gewaltkriminalität von Erwachsenen in Deutschland (ohne Raubkriminalität). Entwicklung, Ursachen und Prognose-Szenarien auch unter Berücksichtigung politisch motivierter Gewalt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1156438