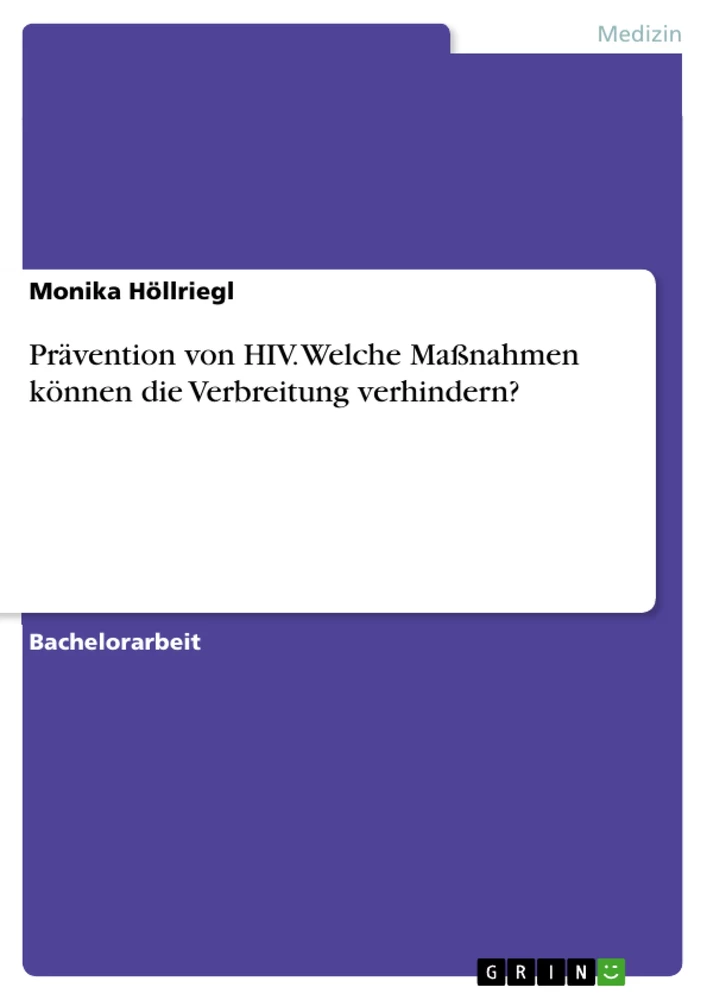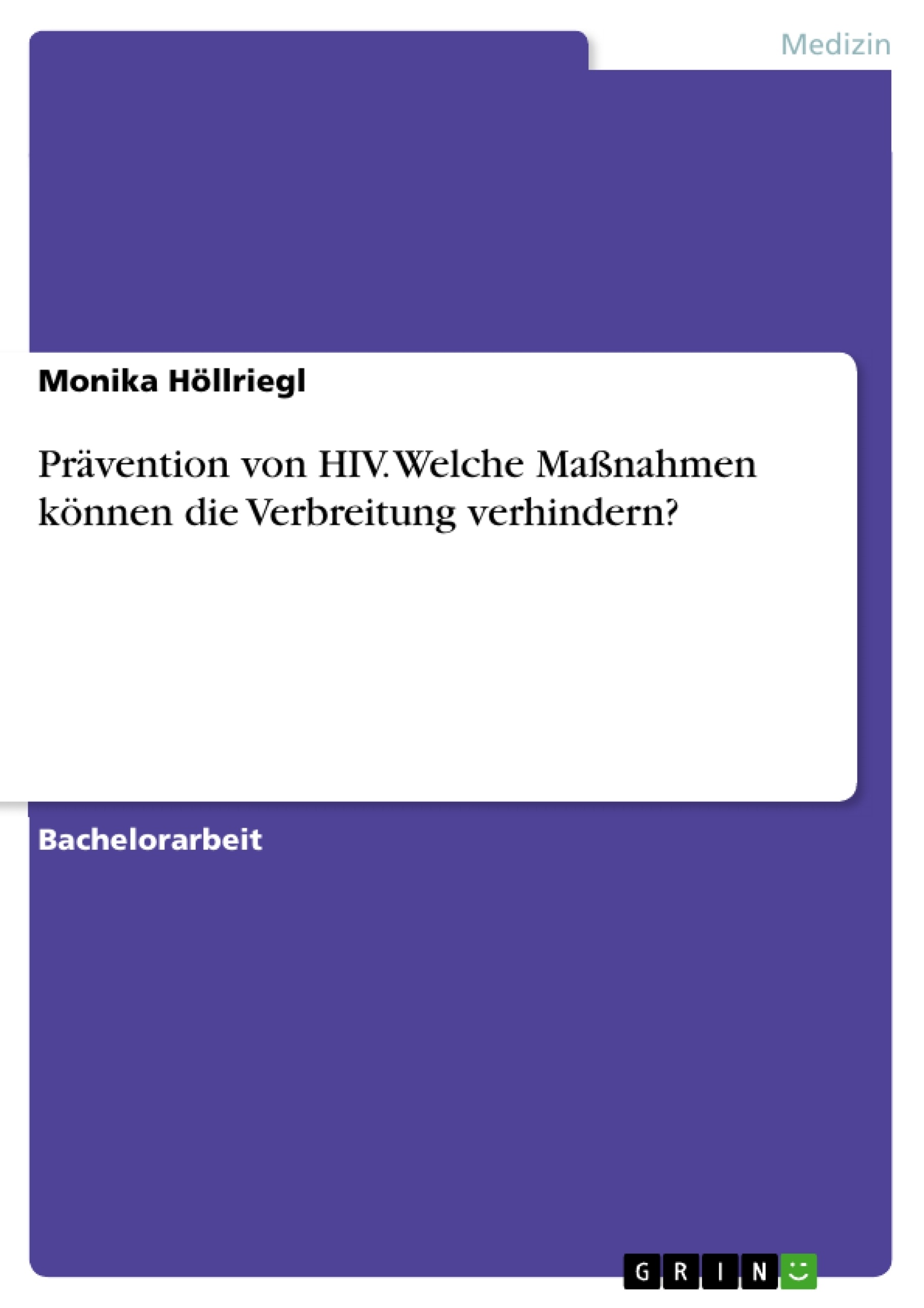Weltweit lebten 2016 etwa 36,7 Millionen Menschen mit HIV (vgl. WHO 2017). Seit Ausbruch des HI-Virus in den 80er-Jahren ist eine hochwirksame Therapie entwickelt worden, die die Erkrankung an AIDS verhindern kann. Diese muss allerdings konsequent das Leben lang eingenommen werden.
Die vorliegende Arbeit geht auf das Thema der Prävention ein, wie die weitere Übertragung von bereits HIV-Infizierten reduziert werden kann. Es wird eine systematische Literaturanalyse durchgeführt, um Aufschluss über evidenzbasierte Präventionsinterventionen zu erhalten. Zwanzig Studien erfüllten die Einschlusskriterien. Es wird analysiert, welche Beratungsstrategien zur Prävention und dadurch zur Einhaltung der Therapie bei HIV-positiven Personen führen und welche anderen Präventionsinterventionen bereits durchgeführt werden. Ergebnis dieser Studien ist, dass Beratung standardisiert und durch geschulte Personen durchgeführt zur Senkung des Risikoverhaltens bzw. Veränderungen des Lebensstils führen können. Unter anderem wird in den Studien auf die motivierende Gesprächsführung hingewiesen. Außerdem gibt es auch technische Hilfsmittel die helfen, dass die Therapie regelmäßig eingenommen wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemdarstellung
- Zielsetzung der Arbeit
- Fragestellung
- Methodik
- Die HIV-Infektion/AIDS
- Epidemiologie
- Übertragungswege
- Viruslast/CD4-Zellen
- Therapie
- Prävention
- Studien zum Thema Prävention und unterschiedliche Präventionsstrategien
- Beratungsstrategien zur HIV- Prävention
- Präventionsstrategien in der Schwangerschaft
- Präventionsstrategien bei intravenösen Drogenkonsum
- Diskussion und Praxisrelevanz der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, verschiedene Maßnahmen und Strategien zur Prävention der HIV-Übertragung weltweit zusammenzufassen. Sie soll aufzeigen, wie kurze Zeiträume in der ambulanten Versorgung genutzt werden können, um HIV-positive Menschen zu beraten. Das Ziel ist, risikoreiche Übertragungswege der Krankheit zu erkennen, zu reduzieren und zu vermeiden.
- Effektive Prävention zur Reduzierung der HIV-Neuinfektionsrate
- Analyse von Beratungsstrategien zur Prävention von HIV
- Untersuchung von Präventionsinterventionen in verschiedenen Kontexten (Schwangerschaft, intravenöser Drogenkonsum)
- Diskussion der Praxisrelevanz der Ergebnisse für den gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege
- Zusammenfassende Darstellung evidenzbasierter Präventionsstrategien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Problematik der HIV-Infektion und stellt die Zielsetzung und Fragestellung der Arbeit dar. Der Methodik-Teil beschreibt die Herangehensweise an die Forschungsfrage, die Literatursuche und die Analyse der Daten. Im Hauptteil werden die Begriffe HIV und AIDS definiert, die Epidemiologie, die Übertragungswege und die Therapie erläutert. Anschließend werden verschiedene Präventionsstrategien vorgestellt.
Das Kapitel über Studien zum Thema Prävention analysiert verschiedene Forschungsarbeiten zu Beratungsstrategien, Präventionsmaßnahmen in der Schwangerschaft und bei intravenösem Drogenkonsum. Die Diskussion im letzten Kapitel beleuchtet die Ergebnisse der Studien, die Limitationen und die Praxisrelevanz im gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege.
Schlüsselwörter
HIV-Prävention, HIV-Übertragung, systematische Literaturrecherche, Beratungsstrategien, Präventionsinterventionen, evidenzbasierte Praxis, Risiko- und Verhaltensänderung, Motivationsgesprächsführung, HIV-Therapie, Gesundheitsförderung, Gesundheitsberatung, gehobener Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege.
Häufig gestellte Fragen
Wie kann die HIV-Übertragung heute effektiv verhindert werden?
Durch eine konsequente antiretrovirale Therapie (ART), die die Viruslast unter die Nachweisgrenze senkt, sowie durch Beratungsstrategien zur Risikoreduktion.
Was ist motivierende Gesprächsführung in der HIV-Prävention?
Es ist eine Beratungsform, die darauf abzielt, die Eigenmotivation der Patienten zur Verhaltensänderung und Therapietreue (Adhärenz) zu stärken.
Welche Präventionsstrategien gibt es für Schwangere?
Durch medikamentöse Behandlung der Mutter und begleitende Maßnahmen bei der Geburt kann die Übertragung des Virus auf das Kind fast vollständig verhindert werden.
Was hilft HIV-positiven Menschen bei der Einhaltung der Therapie?
Neben professioneller Beratung helfen auch technische Hilfsmittel wie Erinnerungsfunktionen oder Apps dabei, die lebensnotwendigen Medikamente regelmäßig einzunehmen.
Warum ist die Viruslast für die Prävention so wichtig?
Eine niedrige Viruslast bedeutet ein minimales Risiko für eine Übertragung auf Sexualpartner. Die Überwachung der CD4-Zellen gibt zudem Aufschluss über den Zustand des Immunsystems.
- Quote paper
- MSc Monika Höllriegl (Author), 2018, Prävention von HIV. Welche Maßnahmen können die Verbreitung verhindern?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1156874