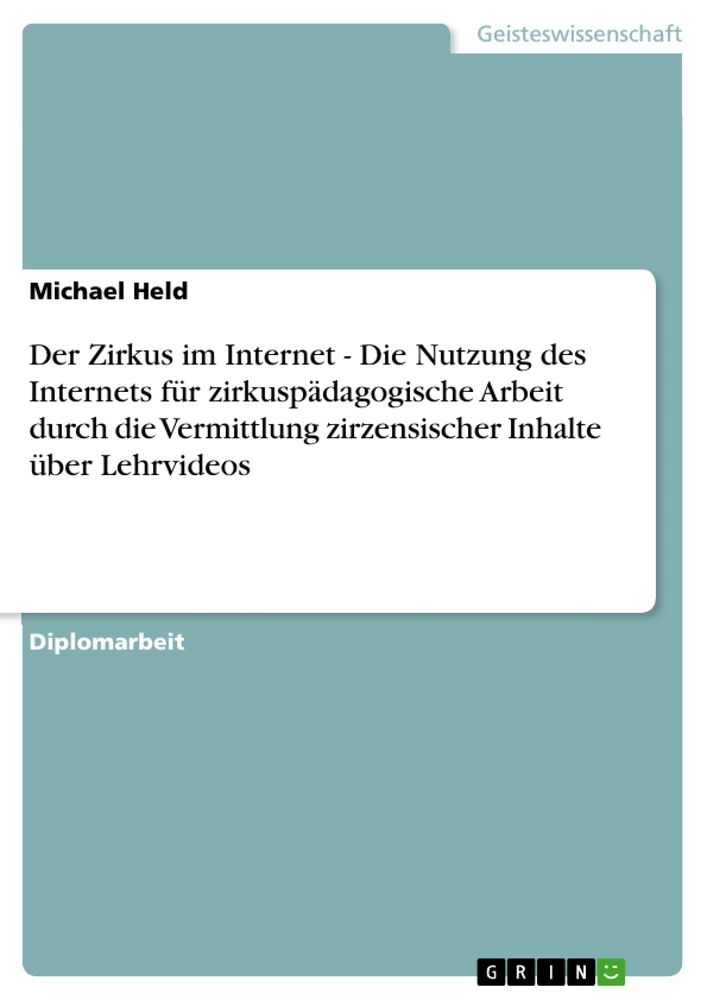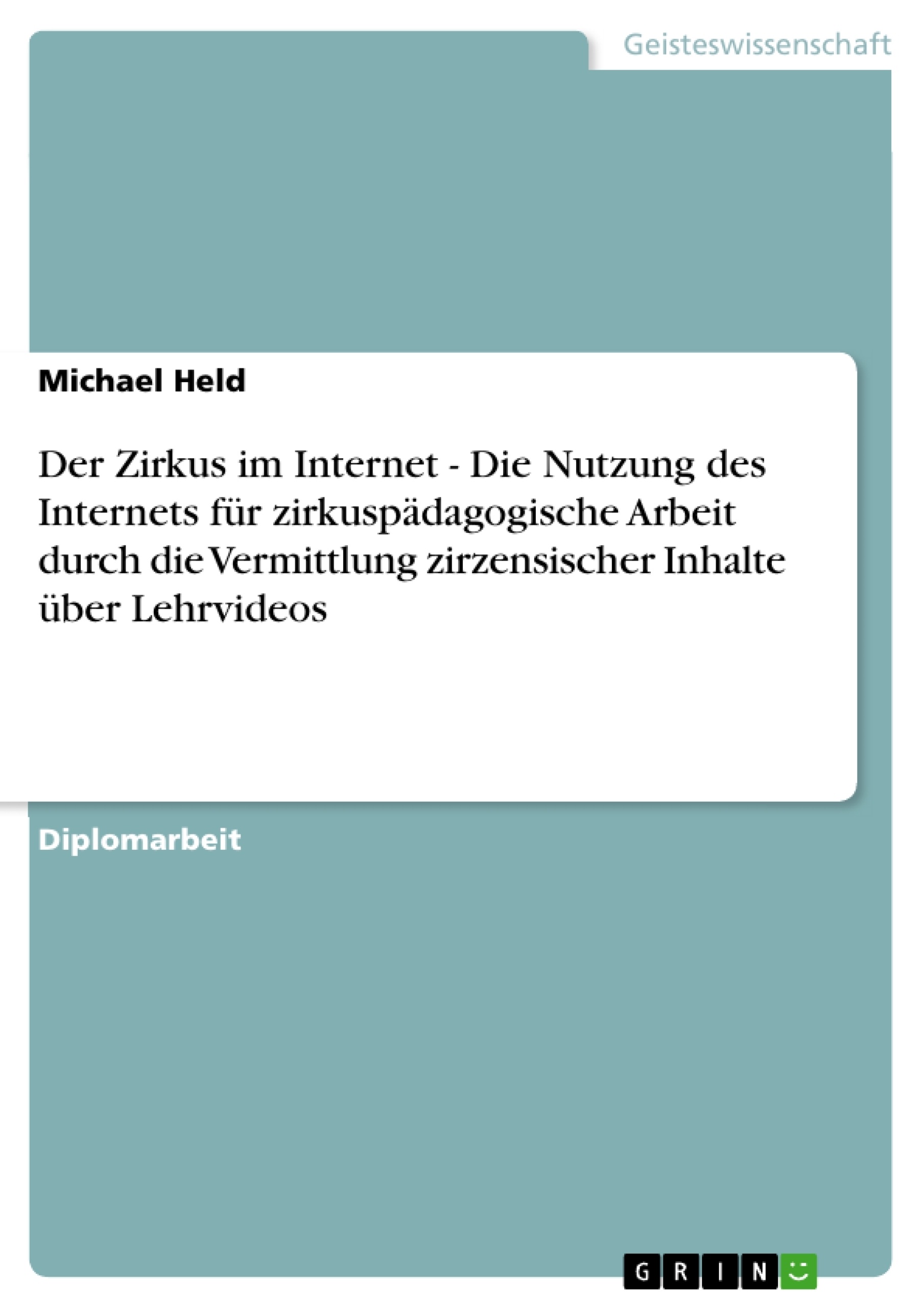Viele Kinder bekommen beim Betreten der bunten Zirkuswelt leuchtende Augen. Den meisten von ihnen reicht dabei nicht der bloße Konsum der atemberaubenden Zirkusnummern. Sie möchten selbst Zirkus machen und ihrem staunenden Publikum schwierige Tricks präsentieren. Auch meine ersten Kontakte zu der Welt des Zirkus waren mit diesem Wunsch verbunden. Dabei bewunderte ich in erster Linie das Spiel der Jongleure mit der Schwerkraft.
Die Kunst der Jonglage zu erlernen gestaltete sich jedoch nicht sonderlich einfach. Jahrelang stellte das Buch „Alles über die Kunst des Jonglierens“ meine einzige Quelle für Informationen und Tricks dar. Erst durch den Zugang zum Internet erschlossen sich mir viele neue Möglichkeiten. Auf verschiedenen Internetseiten fand ich ein umfangreiches Angebot an Jongliervideos und Beschreibungen, wodurch ich immer neue Tricks üben konnte. Zu diesem Zeitpunkt lernte ich meinen heutigen Jonglierpartner und guten Freund Felix Feldmann kennen, der mich auf die Existenz von Jongliertreffen und Conventions aufmerksam machte. Auch hier bot das Internet ausführliche Informationen und ich konnte in Kontakt mit dieser Welt treten.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Gegenwartsgesellschaft und affektiv-motorische Verarmung
- Ursachen und Auswirkungen affektiv-motorischer Verarmung bei Kindern und Jugendlichen
- Verhäuslichung durch veränderten Wohnraum
- Der Einfluss neuer Technologien auf die Spielkultur
- Neue Medien und „Erfahrungen aus zweiter Hand“
- Bewegungs-, Erlebnis- und Beziehungsarmut als „Leitkultur"
- Die Bedeutung von Spiel und Bewegung im Kontext der Entwicklung
- Das Spiel als Spiegel der Kultur
- Bewegung als Baustein der menschlichen Entwicklung
- Der Bewegungsauftrag in der Pädagogik
- Der Zirkus als Pädagoge
- Zusammenfassung des ersten Teils
- Ursachen und Auswirkungen affektiv-motorischer Verarmung bei Kindern und Jugendlichen
- Die Entwicklung von Zirkus und Zirkuspädagogik als Konsequenz gesellschaftlicher Bedürfnisse
- Zirkus im Wandel der Zeit
- Das 18. und 19. Jahrhundert - Entstehung und Blüte
- Das 20. Jahrhundert - Krieg und Zirkussterben
- Der Zirkus der Gegenwart - Renaissance und neuer Glanz
- Die Entdeckung des Zirkus durch die Pädagogik
- Die Erfindung des Kinderzirkus durch Pater Flanagan
- Los Muchachos und die Verbreitung des Kinderzirkus
- Die Renaissance des Zirkus und seine Etablierung in der Pädagogik
- Zusammenfassung des zweiten Teils
- Zirkus im Wandel der Zeit
- Anwendungsfelder der Zirkuskünste und ihre pädagogische Relevanz
- Die Zirkuskünste und ihr pädagogischer und therapeutischer Wert
- Interaktion und Körperkraft in der Akrobatik
- Schulung der Feinmotorik und der Geduld durch Jonglierübungen
- Konzentration und Körperspannung in äquilibristischen Disziplinen
- Clownerie als Spiel mit der Emotion
- Zirkusspiele
- Angewandte Zirkuspädagogik - eine Bestandsaufnahme zirkuspädagogischer Arbeitsfelder
- Zirkus in der Schule
- Zirkus im außerschulischen Bereich
- Zusammenfassung des dritten Teils
- Die Zirkuskünste und ihr pädagogischer und therapeutischer Wert
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Nutzung des Internets für zirkuspädagogische Arbeit. Sie untersucht, wie zirzensische Inhalte über Lehrvideos vermittelt werden können, um die affektiv-motorische Verarmung bei Kindern und Jugendlichen entgegenzuwirken. Die Arbeit analysiert die Ursachen und Auswirkungen dieser Verarmung im Kontext der heutigen Gesellschaft und beleuchtet die Bedeutung von Spiel und Bewegung für die Entwicklung. Sie stellt den Zirkus als pädagogisches Instrument vor und untersucht die Entwicklung des Zirkus und der Zirkuspädagogik im Laufe der Zeit. Die Arbeit beleuchtet die pädagogischen und therapeutischen Werte der Zirkuskünste und zeigt verschiedene Anwendungsfelder der Zirkuspädagogik auf.
- Affektiv-motorische Verarmung bei Kindern und Jugendlichen
- Bedeutung von Spiel und Bewegung für die Entwicklung
- Zirkus als pädagogisches Instrument
- Entwicklung des Zirkus und der Zirkuspädagogik
- Anwendungsfelder der Zirkuspädagogik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Diplomarbeit ein und stellt die Relevanz des Themas „Der Zirkus im Internet“ dar. Sie beleuchtet die Problematik der affektiv-motorischen Verarmung bei Kindern und Jugendlichen und zeigt die Bedeutung von Spiel und Bewegung für die Entwicklung auf. Das erste Kapitel analysiert die Ursachen und Auswirkungen der affektiv-motorischen Verarmung. Es werden die Verhäuslichung durch veränderten Wohnraum, der Einfluss neuer Technologien auf die Spielkultur, die „Erfahrungen aus zweiter Hand“ durch neue Medien und die Bewegungs-, Erlebnis- und Beziehungsarmut als „Leitkultur“ untersucht. Das Kapitel beleuchtet die Bedeutung von Spiel und Bewegung im Kontext der Entwicklung und zeigt den Bewegungsauftrag in der Pädagogik auf. Es stellt den Zirkus als Pädagoge vor und fasst die wichtigsten Punkte des ersten Teils zusammen.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Entwicklung von Zirkus und Zirkuspädagogik als Konsequenz gesellschaftlicher Bedürfnisse. Es zeichnet die Geschichte des Zirkus vom 18. und 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart nach und zeigt die Entstehung und Blüte des Zirkus, das Zirkussterben im 20. Jahrhundert und die Renaissance des Zirkus in der Gegenwart. Das Kapitel beleuchtet die Entdeckung des Zirkus durch die Pädagogik, die Erfindung des Kinderzirkus durch Pater Flanagan, die Verbreitung des Kinderzirkus durch Los Muchachos und die Etablierung des Zirkus in der Pädagogik. Es fasst die wichtigsten Punkte des zweiten Teils zusammen.
Das dritte Kapitel untersucht die Anwendungsfelder der Zirkuskünste und ihre pädagogische Relevanz. Es beleuchtet die pädagogischen und therapeutischen Werte der Zirkuskünste, wie Akrobatik, Jonglieren, Äquilibristik und Clownerie. Das Kapitel zeigt die Bedeutung von Zirkusspielen für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen auf und gibt einen Überblick über die verschiedenen Anwendungsfelder der Zirkuspädagogik, wie Zirkus in der Schule und Zirkus im außerschulischen Bereich. Es fasst die wichtigsten Punkte des dritten Teils zusammen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die affektiv-motorische Verarmung, Spiel und Bewegung, Zirkuspädagogik, Zirkus im Internet, Lehrvideos, neue Technologien, gesellschaftliche Bedürfnisse, pädagogische Relevanz, Zirkuskünste, Akrobatik, Jonglieren, Äquilibristik, Clownerie, Zirkusspiele, Anwendungsfelder der Zirkuspädagogik, Zirkus in der Schule, Zirkus im außerschulischen Bereich.
- Arbeit zitieren
- Dipl. Sozialpädagoge/Sozialarbeiter Michael Held (Autor:in), 2008, Der Zirkus im Internet - Die Nutzung des Internets für zirkuspädagogische Arbeit durch die Vermittlung zirzensischer Inhalte über Lehrvideos, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/115769