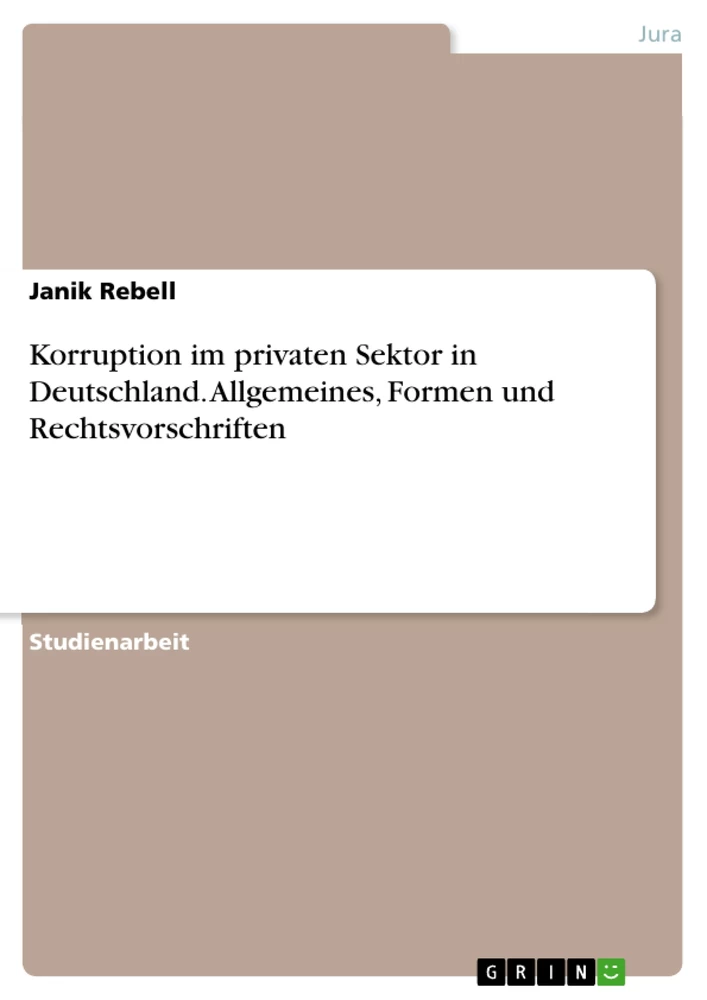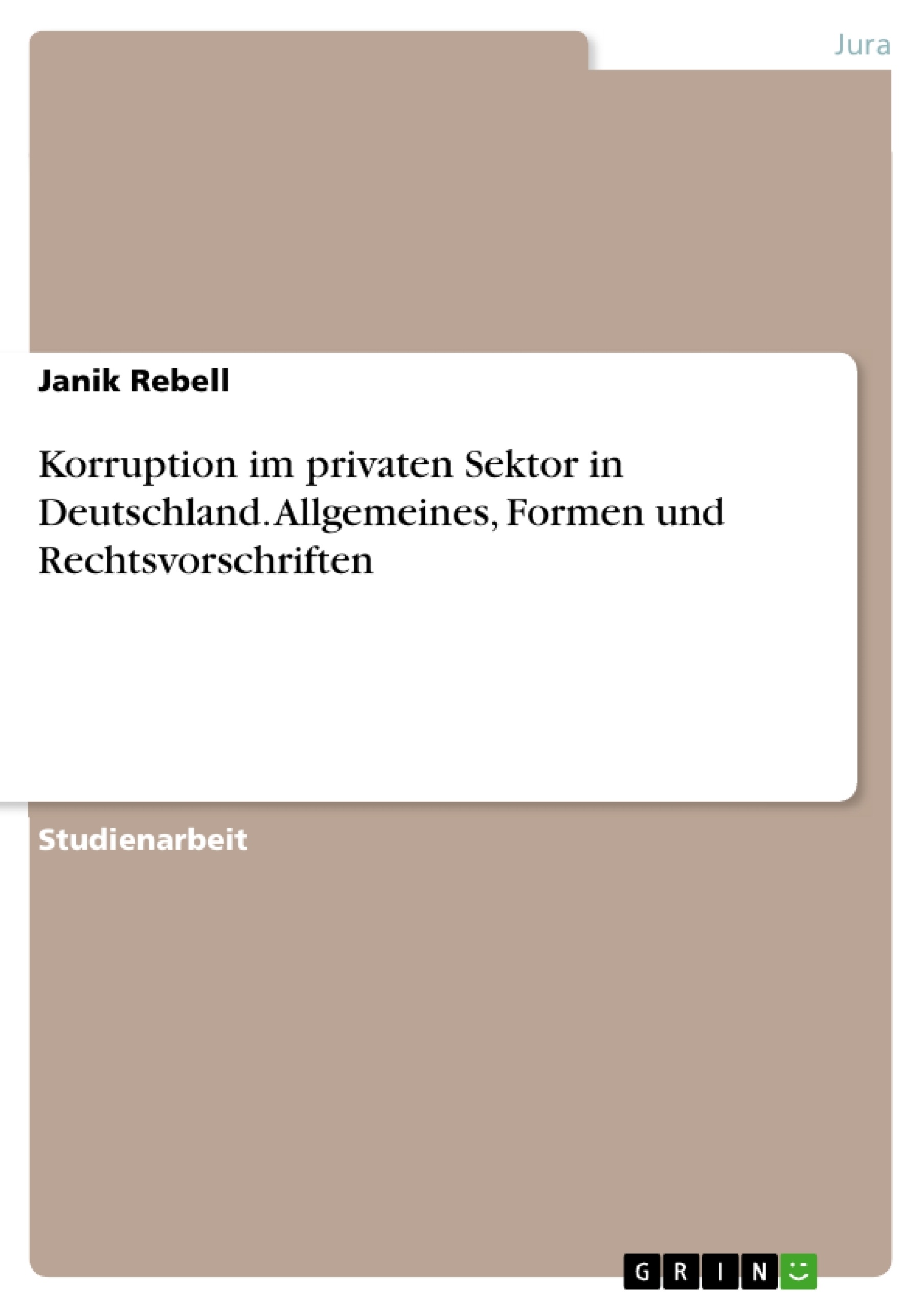In dieser Arbeit wird der zweitgrößte Bereich der Korruption in Deutschland, also der nicht-öffentliche beziehungsweise private Sektor, genauer dargestellt und beleuchtet. Unter Korruption werden vermutlich meistens Vorgänge im öffentlichen Sektor, in der allgemeinen öffentlichen Verwaltung, verstanden. Dieser Zielbereich nimmt tatsächlich mit 50,6 % (Stand 2020) auch den größten Anteil der 5.510 im Jahr 2020 bekanntgewordenen Korruptionsstraftaten ein. Knapp 66 % des Restanteils, also 33,2 %, werden hierbei jedoch in der Wirtschaft begangen.
Der Begriff Korruption dürfte in der westeuropäischen Bevölkerung größtenteils bekannt sein, trotzdessen, dass dieses "Phänomen" in Ländern wie Deutschland, Österreich oder der Schweiz nicht so stark vertreten ist wie in östlichen Kulturen, beispielsweise Syrien oder dem Sudan. Aufschluss hierüber gibt der jährliche Corruption Perceptions Index, welcher insgesamt 180 Ländern anhand des Korruptions-Levels im öffentlichen Sektor in eine Bepunktung zwischen 0 und 100 einordnet ( 0 = "highly corrupt" – 100 = "very clean"). Deutschland befand sich hierbei 2020 mit einem Wert von 80 auf Rang 9 der Liste und zählt damit im Vergleich zu den „sauberen“ Ländern. Der Durchschnittswert liegt bei 43/100 Punkten - etwa 66 % der Länder haben eine Bepunktung unter 50 erreicht.
Auch wenn der öffentliche Sektor in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern weniger korrupt zu sein scheint, entsteht auch in unserem Land eine enorme Schadenssumme durch entsprechende Vorgänge. Laut Bundeskriminalamt entstand im Jahr 2020 eine Schadenssumme von ca. 81.000.000 €, was im Vergleich zu den Vorjahren jedoch noch relativ niedrig ist (z.B. 2017 = 291 Mio €).
Inhaltsverzeichnis
- Anmerkung
- Einleitung
- Korruption im Allgemeinen
- Darstellung und Definition
- Privater Sektor
- Modellierung und Formen der Korruption
- Prinzipal-Agent-Klient-Modell
- Formen der Korruption
- Rechtsvorschriften der Korruption im privaten Sektor
- Darstellung
- Rechtshistorische Entwicklung
- Beispielsfälle
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Korruption im privaten Sektor. Ziel ist es, dieses Phänomen zu definieren, zu modellieren und anhand relevanter Rechtsvorschriften zu beleuchten. Die Arbeit betrachtet auch Beispielsfälle und die rechtshistorische Entwicklung.
- Definition und Darstellung von Korruption
- Modellierung von Korruption im privaten Sektor (Prinzipal-Agent-Klient-Modell)
- Formen der Korruption im privaten Sektor
- Relevante Rechtsvorschriften und deren historische Entwicklung
- Analyse von Beispielsfällen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Korruption ein und vergleicht die Korruption im öffentlichen Sektor Deutschlands mit anderen Ländern. Sie betont den erheblichen Schaden, der durch Korruption im privaten Sektor entsteht, und begründet die Notwendigkeit, diesen Bereich genauer zu untersuchen. Der Corruption Perceptions Index wird als Referenz herangezogen, um den relativen Grad an Korruption in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern zu veranschaulichen. Die Einleitung verweist auf die Herausforderungen der Literaturrecherche während der Corona-Pandemie.
Korruption im Allgemeinen: Dieses Kapitel definiert Korruption und fokussiert auf ihre Erscheinungsformen im privaten Sektor. Es legt den Grundstein für die spätere Analyse der Problematik und bietet einen umfassenden Überblick über die Bedeutung der Korruption im privaten Sektor im Kontext des Gesamtschadens, der durch Korruption entsteht. Es dient als Basis für die darauf folgenden Kapitel, welche die Modellierung, die Rechtslage und Beispiele detaillierter untersuchen.
Modellierung und Formen der Korruption: In diesem Kapitel wird das Prinzipal-Agent-Klient-Modell als Grundlage zur Modellierung von Korruptionsprozessen im privaten Sektor verwendet. Dieses Modell veranschaulicht die verschiedenen Beziehungen und Interaktionen zwischen Prinzipal, Agent und Klient und ermöglicht somit ein besseres Verständnis der Entstehung und des Ablaufs von Korruptionshandlungen. Die verschiedenen Formen von Korruption im privaten Sektor werden aufgezeigt und differenziert, um das vielschichtige Problem zu beleuchten. Das Modell dient als analytisches Werkzeug um verschiedene Szenarien zu verstehen.
Rechtsvorschriften der Korruption im privaten Sektor: Dieses Kapitel befasst sich mit den rechtlichen Grundlagen zur Bekämpfung von Korruption im privaten Sektor. Die Darstellung der relevanten Rechtsvorschriften wird mit einer rechtshistorischen Entwicklung kombiniert, um zu zeigen, wie sich die rechtlichen Regelungen im Laufe der Zeit entwickelt haben und wie sie auf die jeweiligen Herausforderungen reagiert haben. Die Einbeziehung von Beispielsfällen verdeutlicht die praktische Anwendung der Gesetze und zeigt die Auswirkungen von Korruption. Der Fokus liegt auf der Darstellung der rechtlichen Rahmenbedingungen und ihrer Entwicklung.
Schlüsselwörter
Korruption, privater Sektor, Prinzipal-Agent-Klient-Modell, Rechtsvorschriften, Strafgesetzbuch, Schadenshöhe, Rechtshistorische Entwicklung, Beispielsfälle.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Korruption im Privaten Sektor
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht umfassend Korruption im privaten Sektor. Sie beinhaltet eine Einleitung, eine Definition und Modellierung von Korruption, eine Analyse relevanter Rechtsvorschriften und Beispielsfälle. Die rechtshistorische Entwicklung wird ebenso beleuchtet wie die Herausforderungen der Literaturrecherche während der Corona-Pandemie. Der Corruption Perceptions Index wird als Vergleichsmaßstab herangezogen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Definition und Darstellung von Korruption, die Modellierung von Korruptionsprozessen mithilfe des Prinzipal-Agent-Klient-Modells, die verschiedenen Formen von Korruption im privaten Sektor, relevante Rechtsvorschriften und deren historische Entwicklung sowie die Analyse von Beispielsfällen.
Wie wird Korruption modelliert?
Das Prinzipal-Agent-Klient-Modell dient als analytisches Werkzeug zur Modellierung von Korruptionsprozessen. Es veranschaulicht die Beziehungen und Interaktionen zwischen den beteiligten Akteuren und ermöglicht ein besseres Verständnis der Entstehung und des Ablaufs von Korruptionshandlungen.
Welche Rechtsvorschriften werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert die relevanten Rechtsvorschriften zur Bekämpfung von Korruption im privaten Sektor. Die Darstellung der Rechtsvorschriften wird mit ihrer rechtshistorischen Entwicklung kombiniert, um die Entwicklung der rechtlichen Regelungen und deren Reaktion auf Herausforderungen aufzuzeigen. Beispielsfälle verdeutlichen die praktische Anwendung der Gesetze.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu: Anmerkung, Einleitung, Korruption im Allgemeinen (mit Unterkapiteln zu Darstellung/Definition und Privatem Sektor), Modellierung und Formen der Korruption (mit Unterkapiteln zum Prinzipal-Agent-Klient-Modell und Formen der Korruption), Rechtsvorschriften der Korruption im privaten Sektor (mit Unterkapiteln zu Darstellung, Rechtshistorischer Entwicklung und Beispielsfällen), und Zusammenfassung.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Korruption, privater Sektor, Prinzipal-Agent-Klient-Modell, Rechtsvorschriften, Strafgesetzbuch, Schadenshöhe, Rechtshistorische Entwicklung, Beispielsfälle.
Wo finde ich Informationen zum Corruption Perceptions Index?
Der Corruption Perceptions Index wird in der Einleitung erwähnt und dient als Referenz, um den Grad der Korruption in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern zu veranschaulichen. Die Arbeit selbst liefert keine detaillierten Informationen zum Index, sondern nutzt ihn als Vergleichswert.
Wie wird der Schaden durch Korruption im privaten Sektor bewertet?
Die Arbeit betont den erheblichen Schaden, der durch Korruption im privaten Sektor entsteht, ohne jedoch eine konkrete quantitative Schadenshöhe zu beziffern. Die Analyse konzentriert sich auf die qualitative Beschreibung und die rechtliche Einordnung der Korruption.
Welche Herausforderungen gab es während der Recherche?
Die Einleitung erwähnt die Herausforderungen der Literaturrecherche während der Corona-Pandemie.
- Quote paper
- Janik Rebell (Author), 2021, Korruption im privaten Sektor in Deutschland. Allgemeines, Formen und Rechtsvorschriften, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1158303