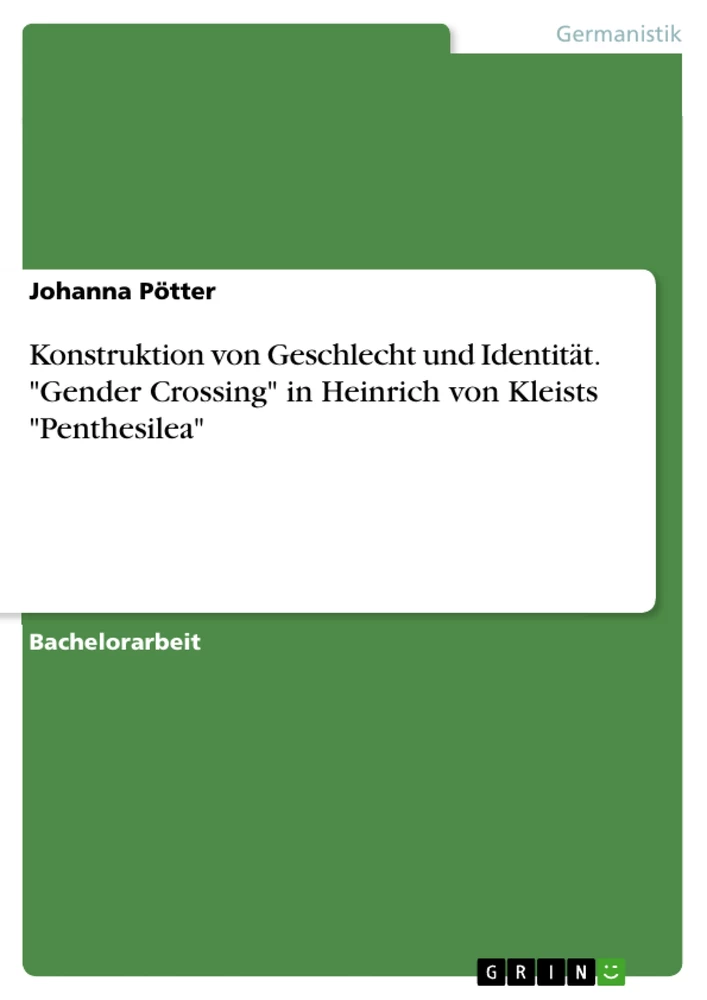Heinrich von Kleists Tragödie "Penthesilea" ist zwischen 1806 und 1807 entstanden. Ein Teil der Penthesilea wurde im Januar 1808 in der von Kleist gemeinsam mit Adam Müller herausgegebenen Zeitschrift Phöbus veröffentlicht.
Für Kleist erschien es glücklich, dass es überhaupt zu einer Veröffentlichung kam, hatte er doch Schwierigkeiten damit, einen Verleger für seine Penthesilea zu finden. Das Drama verstieß in der damaligen Zeit gegen alle klassizistischen Grundsätze in der Behandlung antiker Stoffe. Heutzutage findet die Penthesilea zunehmend Beachtung in diversen wissenschaftlichen Diskursen.
Kleist ermöglicht eine Interpretation, welche den Fokus auf die Verhandlung des Geschlechterverhältnisses im Drama richtet, vor allem durch die beiden Protagonisten, die Amazonenkönigin Penthesilea und den griechischen Helden Achill.
Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, in diesem Zusammenhang Konzepte von Geschlecht und Identität zu erarbeiten und dabei zu analysieren, inwieweit bestehende Machtverhältnisse bei der Reproduktion dieser gesellschaftlich konstruierten Kategorien mitwirken.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Heinrich von Kleists Penthesilea
- Aufbau und Inhalt
- Kontexte und Motive
- Kultur, Identität, Staat
- Penthesilea unter dem Aspekt der Gender-Forschung
- Geschlechterdiskurs um 1800
- Gender Trouble und Kleist
- Analyse des Dramas
- Darstellung Penthesilea
- Darstellung Achill
- Geschlechterverhältnis bei Kleist
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, Konzepte von Geschlecht und Identität in Heinrich von Kleists Tragödie "Penthesilea" zu erarbeiten. Dabei soll analysiert werden, inwieweit bestehende Machtverhältnisse bei der Reproduktion dieser gesellschaftlich konstruierten Kategorien mitwirken. Das Drama wird exemplarisch für die Dekonstruktivität herangezogen, die solche gesellschaftlichen Institutionen und Wertnormen ausüben können.
- Analyse der Gender-Performanz in "Penthesilea"
- Dekonstruktion und Kritik an starren Geschlechterkonzepten
- Beschreibung "typisch männlicher" und "typisch weiblicher" Geschlechtscharaktere
- Untersuchung von "gender-crossing" in "Penthesilea"
- Beziehung zwischen Geschlecht, Identität und Macht im Drama
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema "gender crossing" in "Penthesilea" ein und gibt einen Überblick über Inhalt und Kontexte des Dramas.
Das zweite Kapitel befasst sich mit Kleists "Penthesilea", analysiert Aufbau und Inhalt des Dramas sowie Kontexte und Motive, die darin zum Tragen kommen.
Das dritte Kapitel befasst sich mit dem Geschlechterdiskurs um 1800 und beleuchtet den Widerspruch zwischen diesem Diskurs und Kleists Verständnis von Geschlecht, Identität und Macht.
Das vierte Kapitel analysiert das Drama im Hinblick auf Gender-Theorie und beleuchtet die Konstruktion von Geschlecht und Identität in "Penthesilea".
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter in dieser Arbeit sind "gender crossing", "Geschlecht", "Identität", "Machtverhältnisse", "Gender-Performanz", "Penthesilea", "Heinrich von Kleist", "Dekonstruktion" und "Geschlechterdiskurs".
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Gender Crossing" in Kleists Penthesilea?
Es beschreibt das Überschreiten und Auflösen klassischer Geschlechterrollen. Die Amazonenkönigin Penthesilea übernimmt "männliche" Kriegerattribute, während der Held Achill Momente der "weiblich" konnotierten Passivität zeigt.
Warum war das Drama zur Zeit seiner Entstehung (1808) umstritten?
Es verstieß gegen klassizistische Ideale der Beherrschtheit und Vernunft. Die extreme Gewalt und die leidenschaftliche, fast rauschhafte Darstellung der Protagonisten schockierten das zeitgenössische Publikum.
Wie wird die Amazonengesellschaft im Werk dargestellt?
Die Amazonen bilden einen Staat, der sich durch die Abkehr von männlicher Herrschaft definiert, dabei aber selbst starre Gesetze und Gewaltstrukturen zur Identitätsbildung nutzt.
Welche Rolle spielt die "Gender-Performanz" nach Judith Butler in der Analyse?
Die Arbeit nutzt dieses Konzept, um zu zeigen, dass Geschlecht bei Kleist nicht biologisch fixiert ist, sondern durch Handlungen und gesellschaftliche Erwartungen immer wieder neu "aufgeführt" wird.
Wie endet die Beziehung zwischen Penthesilea und Achill?
Die Beziehung endet tragisch: In einem Zustand des Wahnsinns tötet Penthesilea Achill auf dem Schlachtfeld und zerfleischt ihn gemeinsam mit ihren Hunden, bevor sie selbst stirbt.
Was kritisiert Kleist an den Geschlechterkonzepten seiner Zeit?
Er dekonstruiert die Vorstellung, dass Männer und Frauen naturgegebene, unveränderliche Charaktereigenschaften besitzen, und zeigt die zerstörerische Kraft starrer gesellschaftlicher Normen.
- Quote paper
- Johanna Pötter (Author), 2017, Konstruktion von Geschlecht und Identität. "Gender Crossing" in Heinrich von Kleists "Penthesilea", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1159176