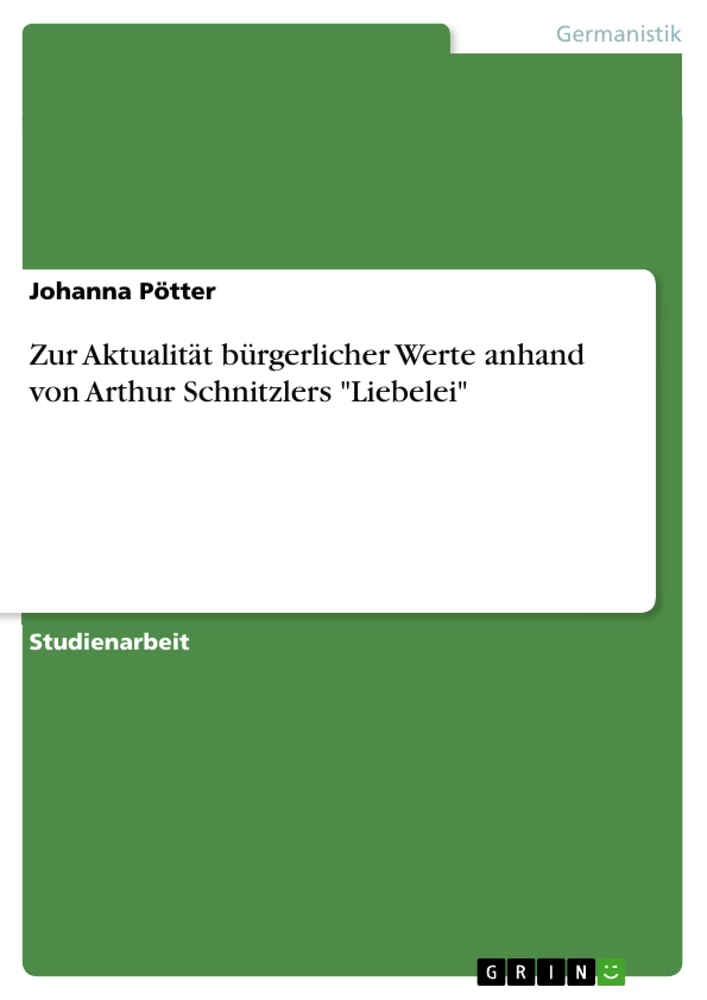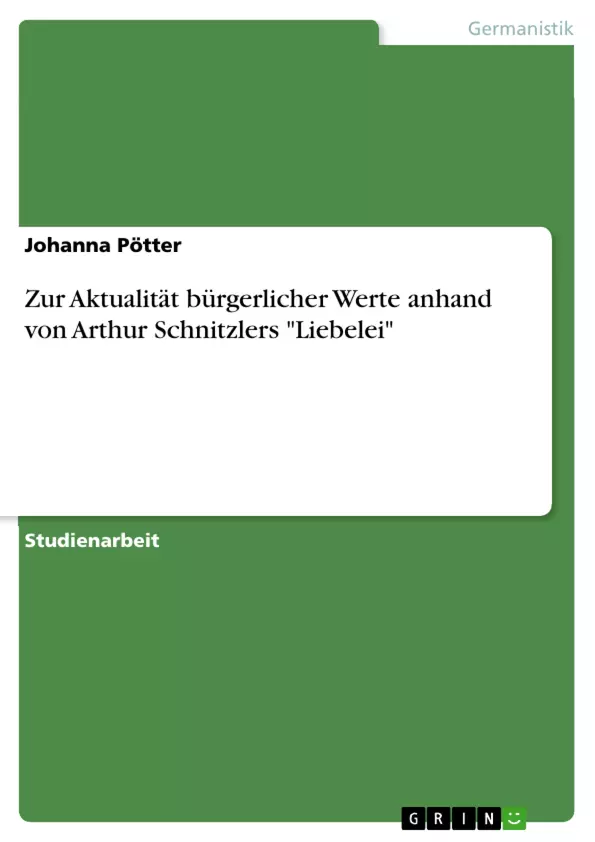Ziel der vorliegenden Arbeit soll es sein, herauszufinden, inwieweit sich in Schnitzlers „Liebelei“ Elemente des traditionellen bürgerlichen Trauerspiels und der bürgerlichen Wertordnung finden lassen. Es soll untersucht werden, in welchen Kategorien und Belangen das Drama der Konzeption des traditionellen bürgerlichen Trauerspiels des 18. Jahrhunderts entspricht. Dafür soll zunächst, im ersten Teil der Arbeit, verhandelt werden, worin typische und charakteristische Merkmale, Elemente und Motive des bürgerlichen Trauerspiels bestehen, insbesondere hinsichtlich der Werteordnung, welche innerhalb der bürgerlichen Familie gelebt wird. Der zweite Teil der Arbeit bezieht sich auf das Wien zur Zeit des Fin-de-Siècle, und soll näher erläutern, inwieweit sich Schnitzler von dem entsprechenden Zeitgeist in seinem Werk inspirieren lassen hat und wo sich zeitgenössische Einflüsse auf das Stück feststellen lassen. Der Fokus soll dabei auch gerichtet werden auf das in dieser Zeit vorherrschende Frauenbild und wie sich dieses auf die Konzeption von Schnitzlers Frauentypen auswirkt. Der dritte Teil schließlich bezieht sich konkret auf Schnitzlers Stück „Liebelei“ und soll darlegen, wie es Schnitzler gelingt, über seine Figurenkonstellation und die Darstellung der entsprechenden Charaktere verschiedene Beziehungskonzeptionen und Auffassungen von Liebe zu veranschaulichen. Darüber soll auch die Aktualität des bürgerlichen Wertekanons verhandelt werden. Auf dieser Grundlage soll schließlich die Frage geklärt werden, ob diese Werte bei Schnitzler noch als aktuell und vertretbar erscheinen, welche Ideale und moralischen Ideen als zeitlos modern gewertet werden kennen und an welchen Stellen es in dieser Hinsicht zu Diskrepanzen kommt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Familie als zentrales Element des bürgerlichen Trauerspiels
- Arthur Schnitzler und das Wien des Fin-de-Siècle
- „Liebelei“
- Figurenkonstellation
- Christines Ideale
- Destruktion der Vaterautorität
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht, inwieweit sich in Schnitzlers „Liebelei“ Elemente des traditionellen bürgerlichen Trauerspiels und der bürgerlichen Wertordnung wiederfinden lassen. Dabei wird analysiert, inwiefern das Drama der Konzeption des bürgerlichen Trauerspiels des 18. Jahrhunderts entspricht. Die Analyse umfasst die typischen Merkmale und Motive des bürgerlichen Trauerspiels, insbesondere die innerhalb der bürgerlichen Familie gelebten Wertvorstellungen. Außerdem werden die Einflüsse des Wiener Fin-de-Siècle auf Schnitzlers Werk, das Frauenbild dieser Zeit und die Darstellung von Beziehungskonzeptionen und Liebesauffassungen in „Liebelei“ betrachtet.
- Das bürgerliche Trauerspiel und seine Elemente
- Die Rolle der Familie in der bürgerlichen Literatur
- Der Einfluss des Fin-de-Siècle auf Arthur Schnitzler
- Die Darstellung von Liebe und Beziehungskonzeptionen in „Liebelei“
- Die Aktualität bürgerlicher Werte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die Zielsetzung der Arbeit und skizziert den Aufbau der Analyse. Im zweiten Kapitel wird die Familie als zentrales Element des bürgerlichen Trauerspiels untersucht, wobei insbesondere die Wertvorstellungen und Konflikte innerhalb der bürgerlichen Familie betrachtet werden. Das dritte Kapitel befasst sich mit dem Wien des Fin-de-Siècle und seinen Einflüssen auf Schnitzlers Werk. Das vierte Kapitel analysiert Schnitzlers Stück „Liebelei“ im Hinblick auf Figurenkonstellation, Christines Ideale und die Destruktion der Vaterautorität.
Schlüsselwörter
Bürgerliches Trauerspiel, Familie, Wertordnung, Fin-de-Siècle, Arthur Schnitzler, „Liebelei“, Beziehungskonzeptionen, Liebesauffassungen, Vaterautorität, Tugend, Standesgrenzen.
Häufig gestellte Fragen
Welche literarische Gattung bedient Schnitzlers "Liebelei"?
Das Stück weist starke Elemente des traditionellen bürgerlichen Trauerspiels auf, obwohl es Ende des 19. Jahrhunderts entstand.
Was ist das zentrale Thema von "Liebelei"?
Zentral sind der Konflikt zwischen echtem Gefühl (Christine) und leichtlebiger Affäre (Fritz) sowie die starren bürgerlichen Ehrbegriffe und Standesgrenzen.
Welche Rolle spielt das Wiener Fin-de-Siècle?
Die Epoche prägt die Atmosphäre des Stücks, insbesondere durch die Darstellung von Dekadenz, Melancholie und dem Frauenbild der "süßen Mädel".
Wie wird die Vaterautorität im Stück dargestellt?
Die Arbeit analysiert die "Destruktion der Vaterautorität", da Christines Vater (Weiring) im Gegensatz zum strengen bürgerlichen Vater des 18. Jahrhunderts eine eher milde, fast nachgiebige Haltung einnimmt.
Sind die bürgerlichen Werte in Schnitzlers Werk noch aktuell?
Die Arbeit untersucht die Diskrepanz zwischen den moralischen Idealen des 18. Jahrhunderts und ihrer (oft hohlen) Anwendung in der Wiener Gesellschaft um 1900.
- Quote paper
- Johanna Pötter (Author), 2016, Zur Aktualität bürgerlicher Werte anhand von Arthur Schnitzlers "Liebelei", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1159184