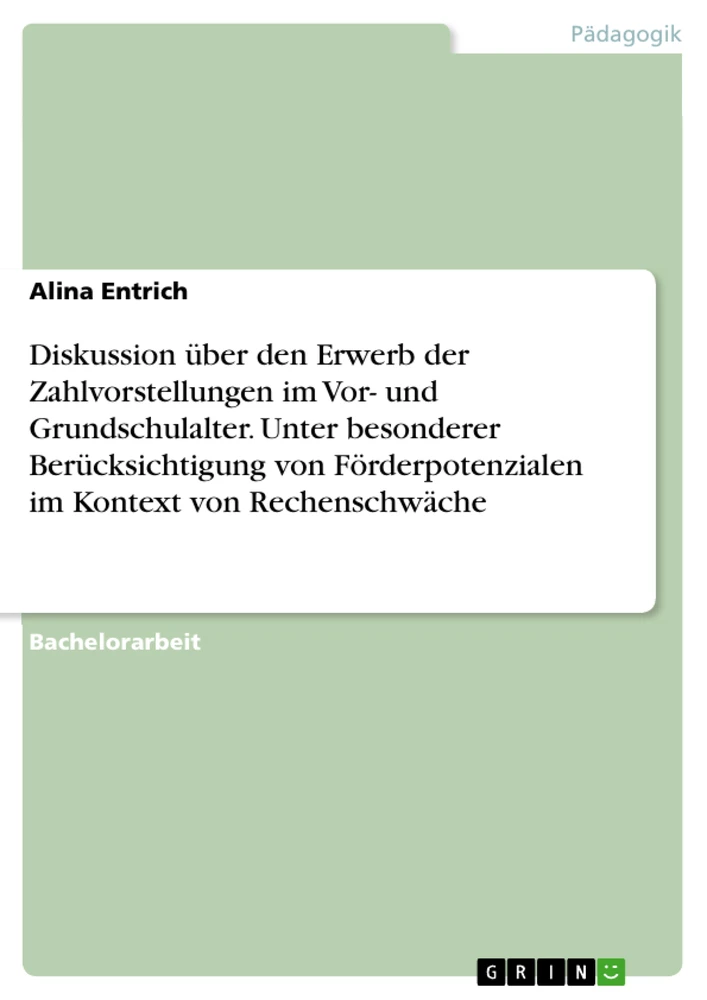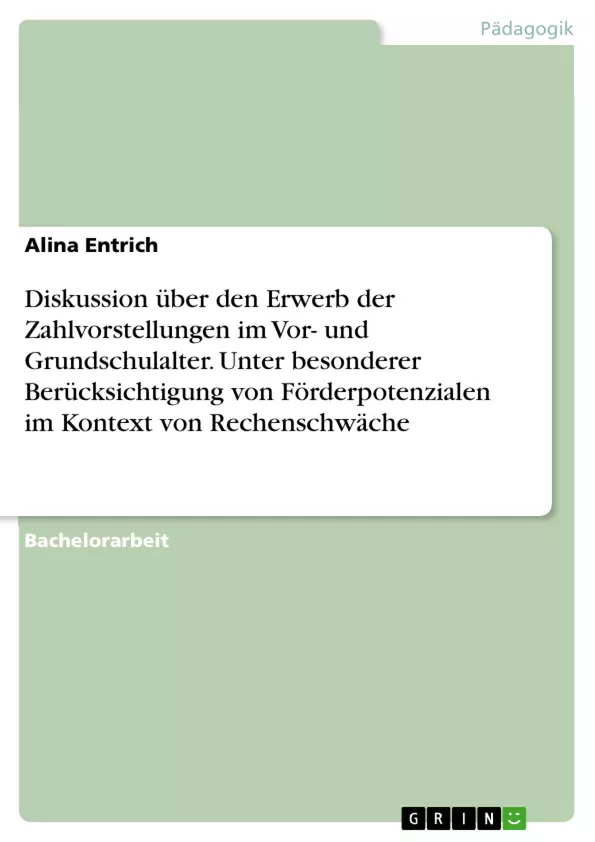Laut der aktuellen Studie der TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) besitzen deutsche Grundschüler/innen Schwierigkeiten und Defizite im Fach Mathematik. An der TIMSS Studie, die im Jahre 2019 von der Universität Hamburg geleitet wurde, haben 58 Staaten mit mehr als 300.000 Schüler der vierten Klassenstufe teilgenommen. In Deutschland wurden die Studienergebnisse von 4.900 Viertklässlern untersucht. Die mathematischen
Leistungen liegen, wie auch in den Vorgängerstudien der Jahre 2007, 2011, 2015 im Mittelfeld des internationalen Vergleichs. Jedoch erreichen 20 % der Schüler nicht die dritte Kompetenzstufe, was laut dem Dortmunder Bildungsforscher Wilfried Bos sehr besorgniserregend ist. Demnach können Schüler einer vierten Klasse nur zum Teil sicher mit Zahleigenschaften umgehen, mathematische Zusammenhänge erkennen und nutzen sowie diese
unterschiedlich darstellen. Die vierte Kompetenzstufe, welche das sichere und flexible Anwenden von Rechenstrategien und Rechenverfahren beinhaltet, wird nur von wenigen Schülern am Ende der vierten Klasse beherrscht
Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich eingehend mit dieser Problematik und stellt geeignete Fördermaßnahmen für rechenschwache Schüler vor. Um zunächst einen inhaltlichen Überblick zu gewinnen, behandelt das erste Kapitel die unterschiedlichen Definitionsversuche, welche für die Dyskalkulie und für die Rechenschwäche in der Fachliteratur verwendet werden.
Das zweite Kapitel befasst sich ausführlich mit dem Aufbau mathematischer Vorläufer- und Grundfertigkeiten im Vor- und Grundschulalter sowie mit dem Erwerb erster Rechenstrategien. Im Mittelpunkt dieser Bachelorarbeit steht die intensive Ausarbeitung und Vorstellung der Förderstrategien für rechnen- und leistungsschwache Kinder in dem Bereich der Zahlbegriffsentwicklung. Im Verlauf des darauffolgenden Kapitels werden ein bekanntes Mathematikbuch, das Zahlenbuch, und ein speziell entwickeltes Förderprogramm, das Dortmunder Zahlbegriffstraining für rechenschwache Kinder, miteinander verglichen. Das Ziel dieses Vergleiches ist es, die einzelnen Lern-und Förderwerke in ihrem Aufbau zu untersuchen und die Qualität der Fördermaßnahmen herauszustellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Dyskalkulie und Rechenschwäche
- Definition Dyskalkulie
- Definition Rechenschwäche
- Erwerb mathematischer Kenntnisse im Vor- und Grundschulalter
- Entwicklung des Zahlbegriffs
- Zählen
- Zählprinzipien
- Zahlwortreihe
- Zahlaspekte
- Förderungsmöglichkeiten für rechenschwache Kinder
- Addition und Subtraktion
- Zahlbeziehungen
- Teil-Ganzes-Beziehungen
- Stellenwertsystem
- Zählendes Rechnen
- Fördermaßnahmen für rechenschwache Kinder
- Entwicklung des Zahlbegriffs
- Analyse des Themenblocks „Entwicklung des Zahlbegriffs“ im Zahlenbuch 1 und im Dortmunder Zahlbegriffstraining
- Makrostruktur
- Zahlenbuch 1
- Dortmunder Zahlbegriffstraining
- Mesostruktur
- Zahlenbuch 1
- Dortmunder Zahlbegriffstraining
- Mikrostruktur Zahlenbuch 1
- Spiralprinzip
- Materialeinsatz
- Prozessbezogene Kompetenzen
- Mikrostruktur Dortmunder Zahlbegriffstraining
- Spiralprinzip
- Materialeinsatz
- Prozessbezogene Kompetenzen
- Makrostruktur
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Lehr- und Fördermaterialien
- Förderstrategien zur Unterstützung rechenschwacher Kinder im Zahlenbuch 1
- Fördermaßnahmen im Dortmunder Zahlbegriffstraining
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit zielt darauf ab, die Problematik von Rechenschwäche bei Grundschulkindern zu beleuchten und geeignete Fördermaßnahmen aufzuzeigen. Sie beschäftigt sich mit verschiedenen Definitionsversuchen von Dyskalkulie und Rechenschwäche und analysiert den Erwerb mathematischer Kenntnisse im Vor- und Grundschulalter, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung des Zahlbegriffs.
- Definition und Unterscheidung von Dyskalkulie und Rechenschwäche
- Entwicklung mathematischer Vorläufer- und Grundfertigkeiten im Vor- und Grundschulalter
- Analyse des Erwerbs des Zahlbegriffs und seiner Bedeutung für den Rechenunterricht
- Vergleich von Fördermaterialien im Kontext der Zahlbegriffsentwicklung für rechenschwache Kinder
- Vorstellung und Bewertung von Förderstrategien und -maßnahmen für rechenschwache Schüler
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz der Thematik von Rechenschwäche in der Grundschule dar und benennt die Zielsetzung der Arbeit. Kapitel 2 befasst sich mit den Definitionen von Dyskalkulie und Rechenschwäche und beleuchtet die Ursachen und Symptome beider Phänomene. Kapitel 3 analysiert den Erwerb mathematischer Kenntnisse im Vor- und Grundschulalter, wobei die Entwicklung des Zahlbegriffs im Vordergrund steht. Es werden die verschiedenen Aspekte des Zahlbegriffs, wie Zählen, Zählprinzipien, Zahlwortreihe und Zahlaspekte, behandelt.
Kapitel 4 stellt eine umfassende Analyse des Themenblocks „Entwicklung des Zahlbegriffs“ im Zahlenbuch 1 und im Dortmunder Zahlbegriffstraining vor. Die Makro-, Meso- und Mikrostrukturen beider Materialien werden analysiert und verglichen, wobei das Spiralprinzip, der Materialeinsatz und die Prozessbezogenen Kompetenzen besondere Aufmerksamkeit erhalten.
Kapitel 5 beschäftigt sich mit Gemeinsamkeiten und Unterschieden der beiden Lehr- und Fördermaterialien hinsichtlich ihrer Förderstrategien für rechenschwache Kinder. Die Arbeit endet mit einem Fazit, das die Ergebnisse der Analyse zusammenfasst und relevante Erkenntnisse für die Praxis des Mathematikunterrichts in der Grundschule ableitet.
Schlüsselwörter
Rechenschwäche, Dyskalkulie, Zahlbegriffsentwicklung, Fördermaterialien, Zahlenbuch 1, Dortmunder Zahlbegriffstraining, Mathematikdidaktik, Grundschule, Lernförderung, Arithmetik, Zählen, Zählprinzipien, Zahlaspekte.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Dyskalkulie und Rechenschwäche?
Dyskalkulie wird oft als klinische Entwicklungsverzögerung definiert, während Rechenschwäche ein breiterer Begriff für massive Schwierigkeiten beim Erwerb mathematischer Grundlagen ist, oft bedingt durch didaktische oder psychologische Faktoren.
Wie entwickeln Kinder eine stabile Zahlvorstellung?
Dies geschieht durch das Erlernen von Zählprinzipien, das Verständnis von Teil-Ganzes-Beziehungen und die Verknüpfung von Mengen mit Zahlworten und Symbolen.
Was ist das „Dortmunder Zahlbegriffstraining“?
Es ist ein speziell entwickeltes Förderprogramm für rechenschwache Kinder, das gezielt die Grundlagen der Zahlbegriffsentwicklung trainiert, bevor komplexe Rechenoperationen eingeführt werden.
Warum ist das „zählende Rechnen“ problematisch?
Kinder, die verharren, Aufgaben wie 8+5 durch Abzählen an den Fingern zu lösen, entwickeln kein Verständnis für Zahlbeziehungen und stoßen bei größeren Zahlenräumen schnell an ihre Grenzen.
Welche Rolle spielt das „Zahlenbuch“ im Mathematikunterricht?
Das Zahlenbuch ist ein weit verbreitetes Lehrwerk, das auf dem Spiralprinzip basiert und versucht, mathematische Strukturen durch Entdeckendes Lernen und geeignete Anschauungsmittel zu vermitteln.
- Quote paper
- Alina Entrich (Author), 2021, Diskussion über den Erwerb der Zahlvorstellungen im Vor- und Grundschulalter. Unter besonderer Berücksichtigung von Förderpotenzialen im Kontext von Rechenschwäche, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1159187