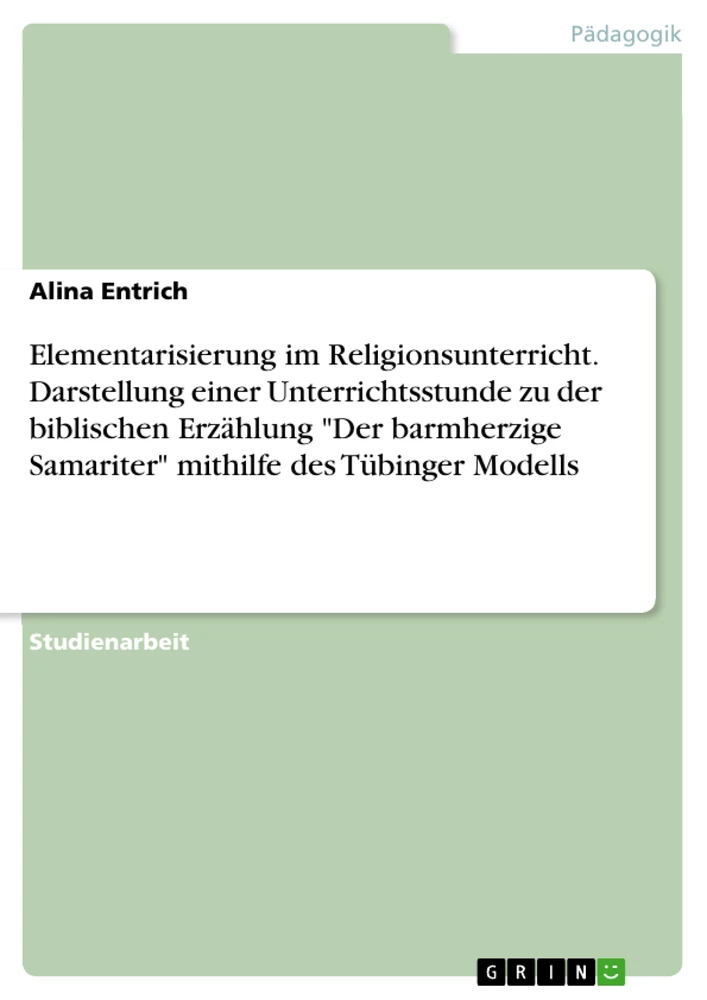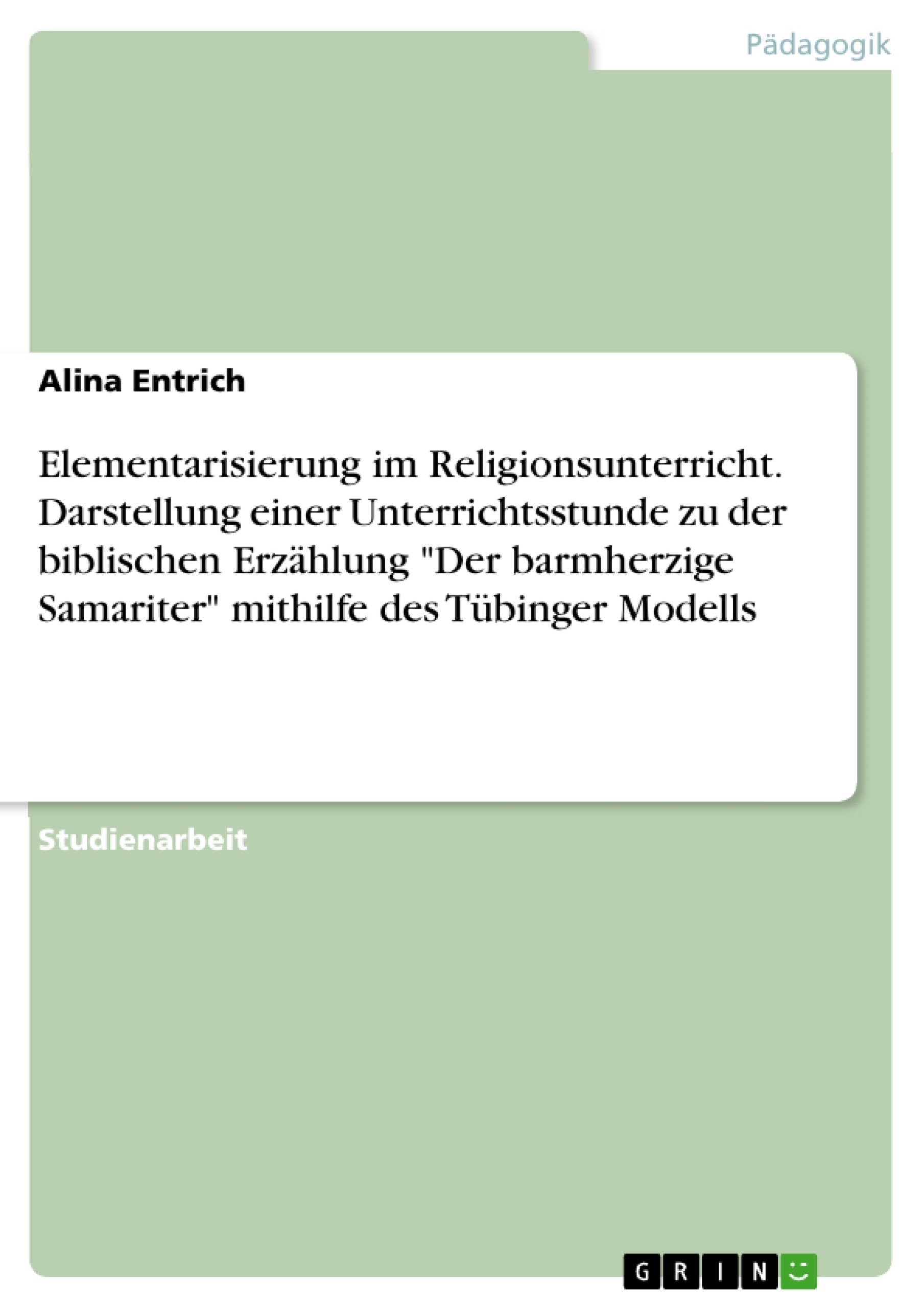In dieser schriftlichen Ausarbeitung wird eine Unterrichtsstunde zum Gleichnis des barmherzigen Samariters gestaltet und mithilfe des Artikulationsschemas didaktisch geplant und strukturiert.
Der chinesische Philosoph Mengzi sagte einst: "Wenn wir stark sind in der Nächsten-liebe und danach handeln: Das ist der Weg zur Vollkommenheit." Dieses Zitat beschreibt die Intention, welche Jesus den Menschen in dem Gleichnis. "Der barmherzige Samariter" vermitteln möchte. Demnach beschäftigt sich diese schriftliche Ausarbeitung mit einem der berühmtesten Gleichnisse aus dem Neuen Testament. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter wird zu dem lukanischen Sondergut gezählt. Die biblische Erzählung und dessen Bedeutung beinhalten für die Christen neben dem Gebot Gott zu achten, auch das Gebot der Nächstenliebe zu ehren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bezug zu den Bildungsstandards
- Vorstellung des Konzepts der Elementarisierung
- Anwendung der Elementarisierung auf das Gleichnis „Der barmherzige Samariter“
- elementare Strukturen
- elementare Erfahrungen
- elementare Zugänge
- elementare Wahrheiten
- Unterrichtsentwurf „Der barmherziger Samariter- Wer ist mein Nächster?“
- Artikulationsschema als Gestaltungsgrundlage
- Unterrichtsplanung
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die didaktische Gestaltung einer Unterrichtsstunde zum Gleichnis des barmherzigen Samariters mithilfe des Tübinger Modells der Elementarisierung. Die Arbeit analysiert die Relevanz des Gleichnisses im Kontext der Bildungsstandards der deutschen Bischofskonferenz und beleuchtet das pädagogische Potenzial des Modells im Religionsunterricht.
- Die Bedeutung des Gleichnisses des barmherzigen Samariters für das christliche Verständnis von Nächstenliebe
- Die Anwendung des Tübinger Modells der Elementarisierung in der Unterrichtsplanung
- Die didaktische Gestaltung einer Unterrichtsstunde zum Thema „Wer ist mein Nächster?“
- Die Verbindung von biblischen Inhalten mit der Lebenswelt der Schüler/innen
- Die Entwicklung von Kompetenzen im Bereich des interreligiösen Dialogs und der sozialen Verantwortung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Gleichnisses des barmherzigen Samariters dar und erläutert die Intention der Arbeit. Kapitel 2 ordnet die Unterrichtsstunde in die Bildungsstandards der deutschen Bischofskonferenz ein. Kapitel 3 bietet eine detaillierte Vorstellung des Tübinger Modells der Elementarisierung und erklärt seine Bedeutung für die Unterrichtsplanung. Kapitel 4 setzt die fünf Dimensionen der Elementarisierung in Bezug zum Unterrichtsentwurf und erläutert ihre Anwendung im Unterricht. Kapitel 5 präsentiert den Unterrichtsentwurf zum Gleichnis des barmherzigen Samariters und zeigt, wie das Artikulationsschema die Unterrichtsplanung strukturiert. Das Fazit fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und reflektiert die Anwendung des Tübinger Modells im Unterricht.
Schlüsselwörter
Nächstenliebe, Gleichnis des barmherzigen Samariters, Tübinger Modell, Elementarisierung, Artikulationsschema, Bildungsstandards, Religionsunterricht, Didaktik, Unterrichtsplanung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Kernbotschaft des Gleichnisses vom barmherzigen Samariter?
Das Gleichnis lehrt das Gebot der Nächstenliebe und zeigt, dass "der Nächste" jeder Mensch in Not sein kann, unabhängig von seiner Herkunft oder Religion.
Was bedeutet "Elementarisierung" im Religionsunterricht?
Elementarisierung ist ein didaktischer Ansatz, der komplexe theologische Inhalte auf ihre wesentlichen, für Schüler verständlichen Kerne reduziert.
Was ist das Tübinger Modell?
Das Tübinger Modell der Elementarisierung nutzt fünf Dimensionen (Strukturen, Erfahrungen, Zugänge, Wahrheiten, Wege), um Unterrichtsstunden didaktisch zu planen.
Wie kann man das Gleichnis lebensweltnah unterrichten?
Indem man die Schüler fragt "Wer ist mein Nächster heute?" und biblische Inhalte mit aktuellen Erfahrungen von Hilfe und Ausgrenzung verknüpft.
Zu welchem Teil der Bibel gehört die Erzählung?
Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter gehört zum lukanischen Sondergut im Neuen Testament.
- Quote paper
- Alina Entrich (Author), 2021, Elementarisierung im Religionsunterricht. Darstellung einer Unterrichtsstunde zu der biblischen Erzählung "Der barmherzige Samariter" mithilfe des Tübinger Modells, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1159191