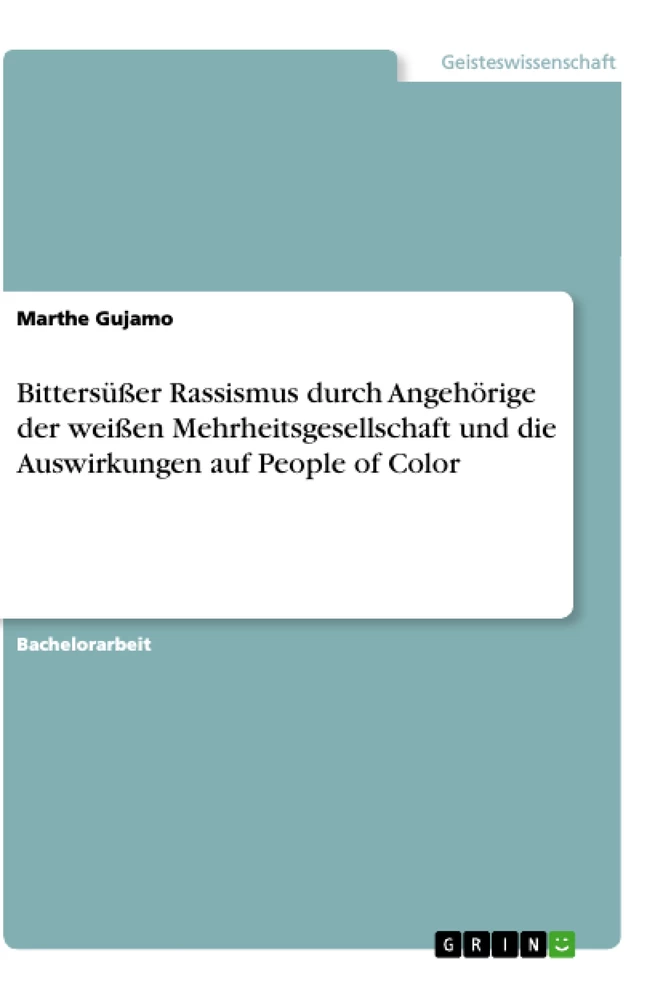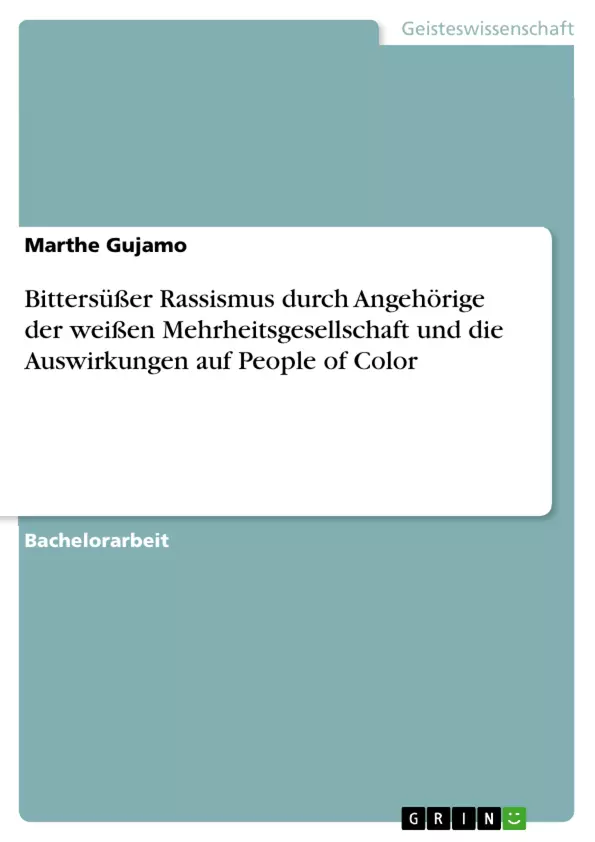Die vorliegende Bachelorarbeit gliedert sich in einen theoretischen und in einen empirischen Teil. Zu Beginn beschäftige ich mich mit den theoretischen Fundamenten von Rassismus, welche eine essentielle Unabdingbarkeit sowie eine bessere Nachvollziehbarkeit meiner Forschungsfrage implizieren. Des Weiteren folgt eine Darlegung der vielschichtigen und facettenreichen Erscheinungsformen von Rassismus und wird mit dem bittersüßen Rassismus abgeschlossen, der die zentrale Rolle in meiner Bachelorarbeit einnimmt.
Im darauffolgenden Kapitel widme ich mich der Begrifflichkeit der Mehrheitsgesellschaft. Da sich meine Sozialisation und Lebensführung auf Deutschland zurückzuführen lässt, beziehe ich mich auf die Mehrheitsgesellschaft in Deutschland und greife im anschließenden Gliederungspunkt den Zusammenhang zwischen Rassismus und
Deutschland auf. Diesbezüglich nehme ich in Anlehnung an die Autorin Tupoka Ogette Bezug auf das Ausblenden beziehungsweise das Nicht-Eingestehen rassistischer Denkstrukturen in der Eigen- sowie Fremdwahrnehmung.
Auf dieser Grundlage, erörtere ich welche Normvorstellungen in einer weißen Mehrheitsgesellschaft wie der deutschen verankert und immer noch gegenwärtig vorzufinden sind. Essentiell dafür ist für mich die thematische Auseinandersetzung mit dem kritischem Weiß-Sein, der einen bedeutungsvollen Aspekt in der Critical Whiteness Studie
einnimmt. Das Ziel, welches damit verfolgt wird, betrifft die reflexive Beschäftigung mit der weißen Norm sowie der eigenen weißen Identität, welche von der Mehrheit einer Bevölkerung nur unzureichend hinterfragt wird.
Im darauffolgenden Kapitel werde ich daher die Lebensrealitäten von Schwarzen Menschen und People of Color in Deutschland näher beleuchten. Es soll darüber Aufschluss geboten werden, wie problematisch der Alltag von rassialisierten Menschen im sozialen Miteinander ist und mit welchen Schwierigkeiten sie sich tagtäglich konfrontiert sehen.
Im Anschluss folgen erste Hypothesen, welche auf Basis der von mir verwendeten Literatur gebildet wurden. Ferner folgt eine Darstellung der ausgewählten Methodik – das Leitfadeninterview. Die von mir durchgeführten Interviews sollen zu einer Beantwortung meiner Fragestellung verhelfen und auf Grundlage der ausgewählten Theorie ausgewertet werden. Anschließend erfolgt ein Zusammentragen der Untersuchungsergebnisse.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- I Theoretischer Teil
- 2 Begriffliche Definition
- 2.1 Der Begriff People of Color
- 2.2 Der Rassenbegriff
- 2.3 Rassismus
- 2.3.1 Die Facetten von Rassismus
- 2.3.2 Der strukturelle Rassismus
- 2.3.3 Der institutionelle Rassismus
- 2.3.4 Der Alltagsrassismus
- 2.3.5 Der bittersüße Rassismus
- 2.4 Der Zusammenhang zwischen Rassismus und Sprache
- 2.4.1 Die Auswirkungen von rassistischer Sprache auf People of Color
- 2.4.2 Der erstrebenswerte Umgang mit rassistischer Sprache
- 3 Die Gesellschaft (in Deutschland)
- 3.1 Mehrheitsgesellschaft gleich Dominanzgesellschaft
- 3.2 Deutschland und Rassismus
- 3.3 Happyland - Eine Welt ohne Rassismus
- 3.4 Die weiße Norm als Mehrheitsgesellschaft
- 3.5 Die kritische Betrachtungsweise der weißen Norm - Critical Whiteness
- 3.6 Die Lebensrealitäten von People of Color in Deutschland
- II Methodischer Teil
- 4 Fragestellung und Forschungsinteresse
- 4.1 Forschungsstand
- 4.1.1 Studie zu Rassismus und Schwarze Menschen/People of Color in Deutschland
- 4.1.2 Auszüge aus einer Fachtagung
- 4.2 Kommentar zum Forschungsstand
- 4.3 Reflexion unter (Forschungs-)ethischen Grundsätzen
- 5 Methodologische Positionierung
- 5.1 Forschungsfeld
- 5.2 Die Erhebungsmethode
- 5.2.1 Das Leitfadeninterview
- 5.2.2 Begründung für den Leitfaden
- 5.2.3 Der Leitfragebogen
- 6 Die Untersuchung, Aufbereitung und Auswertung
- 6.1 Die Stichprobe
- 6.2 Die Vorbereitung der Untersuchung
- 6.3 Die Durchführung der Untersuchungssituation
- 6.4 Die Aufbereitungsmethode
- 6.5 Die Auswertungsmethode
- 7 Ergebnisse der empirischen Untersuchung und Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht den "bittersüßen Rassismus" in der deutschen Gesellschaft und seine Auswirkungen auf People of Color. Die Arbeit zielt darauf ab, dieses subtile und oft übersehene Phänomen zu beleuchten und aufzuzeigen, wie vermeintlich positive Zuschreibungen dennoch rassistische Strukturen aufrechterhalten. Die Autorin verbindet persönliche Erfahrungen mit wissenschaftlicher Analyse.
- Begriffliche Klärung von Rassismus und People of Color
- Analyse verschiedener Formen von Rassismus, insbesondere des "bittersüßen Rassismus"
- Untersuchung der Lebensrealitäten von People of Color in Deutschland
- Empirische Erhebung und Auswertung von Interviews
- Aufzeigen der Auswirkungen rassistischer Sprache und impliziter Vorurteile
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beginnt mit einem Zitat von Martin Luther King Jr. und stellt die Aktualität des Themas Rassismus heraus, insbesondere des subtilen, oft unbewussten Rassismus. Sie führt in die Thematik des "bittersüßen Rassismus" ein, der auch in positiven Zuschreibungen stecken kann und die Autorin motiviert, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
2 Begriffliche Definition: Dieses Kapitel definiert zentrale Begriffe wie "People of Color", "Rasse" und "Rassismus" und differenziert zwischen verschiedenen Formen von Rassismus (strukturell, institutionell, Alltagsrassismus und "bittersüßer Rassismus"). Der Fokus liegt auf der nuancierten Betrachtung des Rassismus und der Bedeutung der Sprache in diesem Kontext.
3 Die Gesellschaft (in Deutschland): Dieses Kapitel beleuchtet die deutsche Gesellschaft als Mehrheitsgesellschaft und deren Umgang mit Rassismus. Es analysiert die "weiße Norm" und den Einfluss von "Critical Whiteness", um die Lebensrealitäten von People of Color in Deutschland zu kontextualisieren. Die Kapitel unterstreichen die Herausforderungen und Diskriminierungen, denen People of Color in Deutschland begegnen.
4 Fragestellung und Forschungsinteresse: Dieses Kapitel beschreibt die Forschungsfrage und das Forschungsinteresse der Arbeit. Es erläutert den Forschungsstand zum Thema Rassismus und People of Color in Deutschland und reflektiert über ethische Aspekte der Forschung.
5 Methodologische Positionierung: Das Kapitel erläutert die methodische Vorgehensweise der Studie. Es beschreibt die gewählte Erhebungsmethode (Leitfadeninterviews) und begründet die Wahl der Methode. Der Aufbau des Leitfadens und des Leitfragebogens wird ebenfalls skizziert.
6 Die Untersuchung, Aufbereitung und Auswertung: Dieses Kapitel beschreibt den Ablauf der empirischen Untersuchung, von der Stichprobenziehung bis zur Auswertung der Daten. Es beleuchtet die Vorbereitung, Durchführung, Aufbereitung und Auswertung der Leitfadeninterviews. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der methodischen Schritte und der Sicherstellung der Datenqualität.
Schlüsselwörter
Bittersüßer Rassismus, People of Color, Rassismus, Mehrheitsgesellschaft, Deutschland, weiße Norm, Critical Whiteness, empirische Untersuchung, Leitfadeninterview, rassistische Sprache, Diskriminierung, Lebensrealitäten.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: "Bittersüßer Rassismus in Deutschland"
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht den "bittersüßen Rassismus" in der deutschen Gesellschaft und seine Auswirkungen auf People of Color. Sie beleuchtet dieses subtile Phänomen, bei dem vermeintlich positive Zuschreibungen rassistische Strukturen aufrechterhalten. Die Autorin verbindet persönliche Erfahrungen mit wissenschaftlicher Analyse.
Welche zentralen Begriffe werden definiert?
Die Arbeit definiert wichtige Begriffe wie "People of Color", "Rasse" und "Rassismus" und differenziert zwischen verschiedenen Formen von Rassismus (strukturell, institutionell, Alltagsrassismus und "bittersüßer Rassismus"). Besonderes Augenmerk liegt auf der Rolle der Sprache im Kontext von Rassismus.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die Lebensrealitäten von People of Color in Deutschland im Kontext des "bittersüßen Rassismus". Sie analysiert die "weiße Norm" und den Einfluss von "Critical Whiteness" und erforscht die Auswirkungen rassistischer Sprache und impliziter Vorurteile.
Welche Methode wurde angewendet?
Die Studie verwendet die Methode des Leitfadeninterviews zur empirischen Datenerhebung. Die Wahl dieser Methode wird begründet und der Aufbau des Leitfadens und des Leitfragebogens wird beschrieben. Der Ablauf der Untersuchung, von der Stichprobenziehung bis zur Datenanalyse, wird detailliert dargestellt.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung und fasst diese in einem Resümee zusammen. Die Auswertung der Leitfadeninterviews liefert Erkenntnisse über die Auswirkungen des "bittersüßen Rassismus" auf die Lebensrealitäten von People of Color in Deutschland.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen methodischen Teil. Der theoretische Teil umfasst die begriffliche Definition von Rassismus und People of Color, sowie eine Analyse der deutschen Gesellschaft und der "weißen Norm". Der methodische Teil beschreibt die Forschungsfrage, die methodologische Positionierung, die Durchführung der Untersuchung und die Auswertung der Ergebnisse.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Bittersüßer Rassismus, People of Color, Rassismus, Mehrheitsgesellschaft, Deutschland, weiße Norm, Critical Whiteness, empirische Untersuchung, Leitfadeninterview, rassistische Sprache, Diskriminierung, Lebensrealitäten.
Welche Gesellschaftliche Relevanz hat diese Arbeit?
Die Arbeit trägt dazu bei, das oft übersehene Phänomen des "bittersüßen Rassismus" zu beleuchten und seine Auswirkungen auf die Lebensrealitäten von People of Color in Deutschland aufzuzeigen. Sie sensibilisiert für subtile Formen von Rassismus und fördert ein kritisches Bewusstsein für die Herausforderungen, denen People of Color begegnen.
- Arbeit zitieren
- Marthe Gujamo (Autor:in), 2019, Bittersüßer Rassismus durch Angehörige der weißen Mehrheitsgesellschaft und die Auswirkungen auf People of Color, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1159210