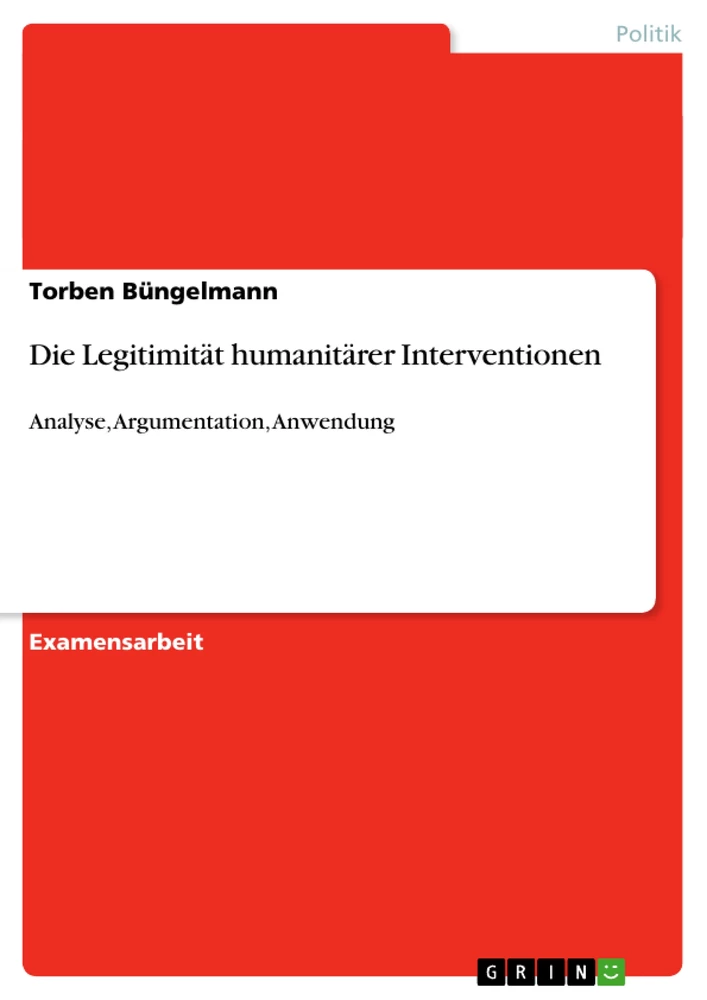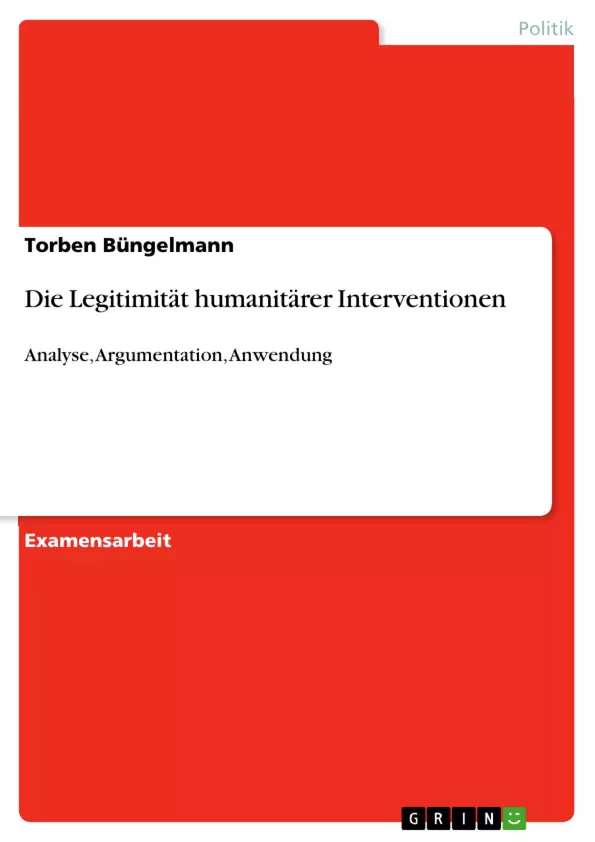Das Eingreifen der NATO in Jugoslawien (1999) hat grelles Licht auf das immer wieder aktuelle Problem der Rechtfertigung gewaltsamer humanitärer Interventionen geworfen. Während die einen darin das gleichermaßen moralisch wie völkerrechtlich gebotene Einschreiten sahen, um Verbrechen, die „das Gewissen der Menschheit schockieren“ (Walzer) zu verhindern, sprachen andere mit Verweis auf das Nichteinmischungsprinzip und wegen der Übergehung des UN-Sicherheitsrates von einem klaren Völkerrechtsverstoß; zudem sei wegen der angeblich leichtfertigen Inkaufnahme ziviler Schäden die Intervention auch moralisch verwerflich gewesen. – Die Einschätzungen könnten also kontroverser nicht sein, und dabei gilt vielen die Kosovointervention noch als Paradebeispiel für humanitäre Interventionen der gegenwärtigen Zeit. Kennzeichen der breiten Debatte über die Zulässigkeit der NATO-Operation und humanitärer Interventionen im Allgemeinen sind die Bezugnahme auf völkerrechtliche Normen auf der einen und moralische Pflichten und Ansprüche auf der anderen Seite. Dabei erweisen sich freilich beide, das Recht wie die Moral, oft als vieldeutig und mehr oder weniger widersprüchlich. Einigermaßen Konsens besteht nur darin, dass das strikte Interventions- und Gewaltverbot der UN nicht das letzte Wort sein kann, wenn der Schutz grundlegender Menschenrechte irgendetwas gilt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 1.1 Fragestellung und theoretischer Rahmen
- 1.2 Aufbau der Arbeit und Argumentation.
- 1.3 Zum Begriff der humanitären Intervention
- 2 Grundlagen und Eckpunkte der Debatte
- 2.1 Die Debatte um humanitäre Interventionen
- 2.2 Die (traditionelle) Lehre vom gerechten Krieg
- 2.2.1 Historischer Abriss: Kein homogenes Gebilde
- 2.2.2 Struktureller Kern: Kriterien des gerechten Krieges
- 2.2.3 Anwendbarkeit auf humanitäre Interventionen
- 2.3 Menschenrechte als gerechter Grund
- 2.3.1 Die universale Gültigkeit der Menschenrechte
- 2.3.2 Was ein Menschenrecht grundlegend macht
- 2.4 Staatssouveränität als gewichtiger Gegengrund
- 2.4.1 Souveränität durch innere Legitimität
- 2.4.2 Souveränität als Bedingung internationaler Stabilität
- 3 Moralphilosophische Analyse
- 3.1 Methode: Abstrakte Moralphilosophie
- 3.2 Interventionen nach dem Konzept der Nothilfe
- 3.2.1 Das Recht zur Hilfe (Ius ad bellum)
- 3.2.2 Restriktionen der legitimen Hilfe (Ius in bello)
- 3.3 Das Dilemma der Tötung Unschuldiger. . .
- 3.3.1 Erste These: Die Abwägungsbedingung genügt schon
- 3.3.2 Zweite These: Die Morallehre vom Doppeleffekt.
- 3.3.3 Dritte These: (Rechtsethische) Umkehr der Beweislast
- 3.4 Das anti-interventionistische Argument vom Staat als Person
- 3.4.1 Die (falsche) Analogie von Person und Staat
- 3.4.2 Moralphilosophische Kritik: Menschenrecht vor Staatsrecht
- 3.4.3 Moralphilosophische Begründung staatlicher Souveränität
- 3.5 Zwischenresümee
- 4 Walzer: Der pragmatische Neuansatz
- 4.1 Methode: Analyse der Alltagsmoral
- 4.1.1 Angewandte Ethik und die Struktur der moralischen Welt
- 4.1.2 Quelle und Universalität moralischer Urteile .
- 4.2 Ius ad bellum: Schutz der Gemeinschaft
- 4.2.1 Menschenrechte, Gemeinschaft und Souveränität
- 4.2.2 Gerechter Grund und Recht zur Intervention
- 4.3 Ein neues Dilemma: Siegen und gut kämpfen
- 4.3.1 Die Grenze der Lehre des Doppeleffektes.
- 4.3.2 Das Recht nicht beugen, sondern übergehen
- 4.4 Kritik des,Utilitarismus der extremen Situation'
- 4.4.1 Tertium Non Datur? - Kritik der Prämissen.
- 4.4.2 Schuld und Sühne: Das Konzept der „Dirty Hands“
- 4.4.3 Utilitarismus: Vorwurf der doppelten Inkonsistenz
- 4.4.4 Anmerkung: Grenzen der Kritik
- 4.5 Zwischenresümee
- 4.1 Methode: Analyse der Alltagsmoral
- 5 Moral und die Zwischenebene politischer Institutionen
- 5.1 Recht und Moral
- 5.1.1 Recht braucht eine moralische Grundlage
- 5.1.2 Recht verbietet nicht das moralisch Gute
- 5.1.3 Die Moral löst den Widerspruch im Völkerrecht
- 5.2 Legitime Autorität und Interventionssubjekt . . .
- 5.2.1 Sicherheitsrat: Hochwürdige, unzulängliche Autorität
- 5.2.2 Staaten (koalitionen): Genuin moralische Autorität
- 5.3 Der Vorwurf des moralischen Exzeptionalismus
- 5.3.1 Intervention ja, positiv-rechtliche Kodifizierung nein
- 5.3.2 Kritik des moralischen Exzeptionalismus.
- 5.3.3 Ausweg gewohnheitsrechtliche Legalisierung‘?
- 5.4 Zwischenresümee
- 5.1 Recht und Moral
- 6 Testfall Kosovointervention (1999)
- 6.1 Vorbemerkungen zum methodischen Vorgehen.
- 6.2 Ius ad bellum: Intervention gerechtfertigt
- 6.2.1 Kriterium gerechter Grund: Erfüllt (Konsens)
- 6.2.2 Kriterium Notwendigkeit (I): Plausibel erfüllt
- 6.2.3 Kriterium legitime Autorität: Klar erfüllt
- 6.2.4 Kriterium rechte Absicht: Ja, soweit erkennbar
- 6.3 Ius in bello: Zweifelhafte Durchführung.
- 6.3.1 Kriterium Notwendigkeit (II): Nicht erfüllt
- 6.3.2 Kriterium Proportionalität: Fraglich
- 6.3.3 Kriterium Non-Kombattanten-Schutz: Ungenügend erfüllt
- 6.4 Zusammenfassende Bewertung
- 7 Ergebnisse und Resümee
- 7.1 Inhaltliche Ergebnisse und Argumentation
- 7.2 Lösungsvorschlag: Ein globaler Ethik- und Interventionsrat?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Legitimität humanitärer Interventionen. Ziel ist es, die ethischen und rechtlichen Argumente für und gegen solche Interventionen zu untersuchen und zu bewerten. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Perspektiven auf die Anwendung von Gewalt in internationalen Beziehungen, insbesondere im Kontext von Menschenrechtsverletzungen.
- Die ethische Dimension der Interventionen und die Frage nach dem Verhältnis von Recht und Moral
- Die Rolle der Staatssouveränität im Konflikt mit dem Schutz von Menschenrechten
- Die Anwendung der Lehre vom gerechten Krieg auf humanitäre Interventionen
- Die moralphilosophische Analyse von Interventionen im Kontext von Nothilfe und dem Dilemma der Tötung Unschuldiger
- Der pragmatische Ansatz von Michael Walzer und die Kritik am „Utilitarismus der extremen Situation“
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Fragestellung und den theoretischen Rahmen der Arbeit ein. Es definiert den Begriff der humanitären Intervention und skizziert den Aufbau der Argumentation. Kapitel zwei beleuchtet die Grundlagen und Eckpunkte der Debatte um humanitäre Interventionen, wobei die traditionelle Lehre vom gerechten Krieg, die Bedeutung von Menschenrechten und die Rolle der Staatssouveränität im Vordergrund stehen. In Kapitel drei wird eine moralphilosophische Analyse von Interventionen durchgeführt, wobei verschiedene ethische Argumente im Kontext von Nothilfe und dem Dilemma der Tötung Unschuldiger diskutiert werden. Kapitel vier beschäftigt sich mit dem pragmatischen Ansatz von Michael Walzer und analysiert seine Kritik am „Utilitarismus der extremen Situation“. Kapitel fünf untersucht die komplexe Beziehung von Recht und Moral im Zusammenhang mit humanitären Interventionen und beleuchtet die Frage nach der legitimen Autorität für Interventionen. Das sechste Kapitel analysiert die Kosovointervention im Jahr 1999 als Testfall für die ethische und rechtliche Legitimität von Interventionen. Schließlich werden in Kapitel sieben die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und ein Lösungsvorschlag für eine gerechtere und effektivere Regelung von Interventionen präsentiert.
Schlüsselwörter
Humanitäre Intervention, gerechter Krieg, Menschenrechte, Staatssouveränität, Moralphilosophie, Nothilfe, Doppeleffekt, Utilitarismus, Michael Walzer, Kosovointervention, Völkerrecht, Legitimität, Autorität, Ethik, Interventionsrat.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine humanitäre Intervention?
Es handelt sich um das militärische Eingreifen in einen fremden Staat, um massiven Menschenrechtsverletzungen wie Völkermord oder Vertreibung Einhalt zu gebieten.
Widerspricht eine Intervention dem Völkerrecht?
Das Völkerrecht schützt primär die Staatssouveränität und verbietet Gewalt. Dennoch besteht ein moralischer Konflikt, wenn der Schutz grundlegender Menschenrechte Vorrang vor staatlicher Souveränität erhält.
War die Kosovointervention 1999 legitim?
Die Arbeit analysiert dies kontrovers: Während ein gerechter Grund vorlag, war die Durchführung ohne UN-Mandat völkerrechtlich höchst umstritten.
Was besagt die Lehre vom „gerechten Krieg“?
Diese traditionelle Lehre definiert Kriterien wie den gerechten Grund (Ius ad bellum) und die Verhältnismäßigkeit der Mittel (Ius in bello), unter denen Gewalt ethisch vertretbar sein kann.
Was ist Michael Walzers „pragmatischer Neuansatz“?
Walzer argumentiert für den Schutz der politischen Gemeinschaft und diskutiert Dilemmata wie den „Utilitarismus der extremen Situation“, bei dem Regeln im Notfall gebeugt werden könnten.
- Citar trabajo
- Torben Büngelmann (Autor), 2007, Die Legitimität humanitärer Interventionen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/115942