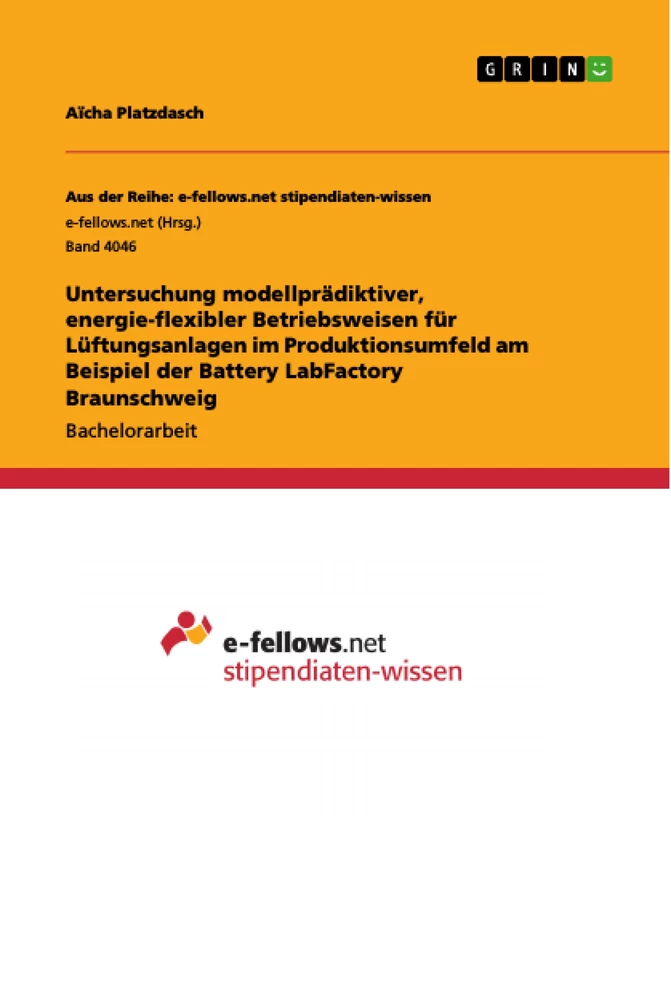Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, ein vorhandenes, validiertes, physikalisches Modell der RLT-Anlage der BLB in der Entwicklungsumgebung Dymola mit der Programmiersprache Modelica um eine energieflexible Regelung zu erweitern. Anschließend wird die energieflexible Betriebsweise der Anlage im Hinblick auf relevante Betriebsgrößen wie die Taupunkttemperatur (TPT) im Trockenraum, die Betriebskosten und die Umweltwirkungen untersucht. Im Zuge einer energieflexiblen Betriebsweise lassen sich zwei Regelungsstrategien anwenden: eine Regelung ohne und eine mit heuristischer Optimierung. In der Regelung ohne Optimierung werden regelbasierte Verfahren zur Steuerung der RLT-Anlage verwendet, wohingegen der Strategie mit heuristischer Optimierung ein mathematisches Optimierungsproblem zugrunde liegt, das mehrere Zielgrößen umfasst. Beide Strategien zählen zu den modellprädiktiven Re-gelungen (MPR). Die Forschungsfrage, die sich in diesem Kontext stellt, lautet: Welche der Regelungsstrategien ist in Anbetracht der Kosten und Umweltauswirkungen, der Erfüllung der raumklimatischen Bedingungen sowie der immanenten Stärken und Schwächen der jeweiligen Regelungsstrategien im betrachteten Anwendungsfall besser geeignet?
Neben der Bewertung der Regelungsansätze nach diesen Gesichtspunkten erfolgt in dieser Arbeit die Ermittlung des Energieflexibilitätspotentials der RLT-Anlage in Form von vier Kennzahlen: Abrufdauer, -häufigkeit, flexibilisierbare Leistung sowie flexibilisierbare Energie.
Diese Arbeit trägt zu einem besseren Verständnis der energieflexiblen Regelung von RLT-Anlagen bei, indem sie Empfehlungen für den betrachteten Anwendungsfall – ein Trockenraum für die Batterieproduktion – gibt. In dieser Arbeit wird ersichtlich, welche Vorteile ein energieflexibler Betrieb aus Betreibersicht hat, aber auch welchen Beitrag RLT-Anlagen zur Netzstabilität leisten können.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Ausgangslage und Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung und Vorgehensweise
- 2 Theoretische Grundlagen
- 2.1 Energieflexibilität
- 2.1.1 Herausforderungen an das bestehende Energieversorgungssystem
- 2.1.2 Angebotsflexibilität
- 2.1.3 Nachfrageflexibilität
- 2.1.4 Speicherflexibilität
- 2.1.5 Transportflexibilität
- 2.1.6 Intersektorale Flexibilität
- 2.1.7 Schlussfolgerung
- 2.2 Lüftungstechnik von Trockenräumen und Produktionsbetrieben
- 2.2.1 Einsatz, Aufbau und Funktionsweise von Lüftungstechnik in Produktionsbetrieben
- 2.2.2 Normen und Arbeitsvorschriften für Lüftungstechnik in Trockenräumen und Produktionsbetrieben
- 2.2.3 Energieflexibler Einsatz von Lüftungstechnik in Trockenräumen
- 2.3 Modell- und Simulationsparadigmen
- 2.3.1 Modelle und ihre Kategorisierung
- 2.3.2 Simulation und ihre Ansätze
- 2.4 Regelungsstrategien
- 2.4.1 Regelungstechnische Grundlagen
- 2.4.2 Gängige Betriebsweisen von RLT-Anlagen
- 2.4.3 Energieflexible Betriebsweisen von Anlagen im Produktionsumfeld
- 2.4.4 Optimierung
- 2.5 Sensitivitätsanalyse und Parameterstudie
- 3 Cyber-physisches System
- 3.1 Physisches System
- 3.2 Datenakquise
- 3.3 Cybersystem
- 3.3.1 RLT-Anlage
- 3.3.2 Lasten im Trockenraum
- 3.3.3 Energiepreise
- 3.3.4 Notwendige Inputs
- 3.4 Entscheidungsunterstützung und kontinuierliche Regelung
- 3.4.1 Exergetische Hot-Spot-Analyse
- 3.4.2 Regelbasierte, energieflexible Regelung mit Modell und ohne Optimierung
- 3.4.3 Energieflexible Regelung mit Modell und heuristischer Optimierung
- 3.4.4 Generierte Outputs
- 3.5 Annahmen des Modells und Unterschiede zum physischen System
- 4 Auswertung
- 4.1 Ergebnisse der verschiedenen Regelungsstrategien
- 4.1.1 Wintermonat November – Kosten, Energie, Taupunkttemperaturen und Emissionen
- 4.1.2 Sommermonat Juli – Energie, Kosten, Emissionen und Taupunkttemperaturen
- 4.1.3 Zwischenfazit
- 4.2 Sensitivitätsanalyse und Parameterstudie
- 4.2.1 Parameterstudie zur Verbesserung der regelbasierten, energieflexiblen Regelung mit Modell und ohne Optimierung
- 4.2.2 Manuelle Sensitivitätsanalyse
- 4.3 Energieflexibilitätspotential der RLT-Anlage
- 4.3.1 Bemessung des Flexibilitätspotentials des Prozessventilators
- 4.3.2 Beurteilung des Flexibilitätsprofils des Prozessventilators
- 4.4 Best Practice in der BLB
- 4.5 Kritische Würdigung
- 5 Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die energieflexible Regelung einer Lüftungsanlage in der Battery LabFactory Braunschweig (BLB). Das Hauptziel ist die Erweiterung eines bestehenden Modells um energieflexible Regelungsstrategien (mit und ohne heuristische Optimierung) und die Bewertung dieser Strategien bezüglich Kosten, Umweltwirkungen und Raumklima.
- Energieflexibilität in industriellen Prozessen
- Modellprädiktive Regelung (MPR) von Lüftungsanlagen
- Optimierung des Energieverbrauchs im Kontext von schwankenden Strompreisen
- Auswirkungen energieflexibler Regelungen auf das Raumklima
- Bewertung des Energieflexibilitätspotentials von RLT-Anlagen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Problemstellung der Energieflexibilität im Kontext der Energiewende und der steigenden Bedeutung erneuerbarer Energien ein. Es beschreibt die Herausforderungen, die sich aus der Volatilität der Stromerzeugung ergeben und die Notwendigkeit von Demand-Side-Management (DSM) Maßnahmen. Die Battery LabFactory Braunschweig (BLB) und ihre raumlufttechnischen Anlagen (RLT) werden als Anwendungsbeispiel vorgestellt. Die Forschungslücke im energieflexiblen Betrieb von RLT-Anlagen in Trockenräumen wird identifiziert und die Zielsetzung der Arbeit wird definiert.
2 Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel vermittelt das notwendige Hintergrundwissen zu Energieflexibilität, ihren verschiedenen Arten (Angebots-, Nachfrage-, Speicher-, Transport- und intersektorale Flexibilität) und den damit verbundenen Herausforderungen und Chancen. Es beschreibt die Funktionsweise von RLT-Anlagen, insbesondere in Trockenräumen für die Batterieproduktion, sowie relevante Normen und Vorschriften. Der Kapitel beinhaltet außerdem einen Überblick über Modell- und Simulationsparadigmen und verschiedene Regelungsstrategien für RLT-Anlagen, wobei der Fokus auf modellprädiktiven Regelungen (MPR) liegt. Schließlich werden die Grundlagen der Sensitivitätsanalyse und Parameterstudie erläutert.
3 Cyber-physisches System: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der Arbeit. Es präsentiert die Battery LabFactory Braunschweig (BLB) und ihre RLT-Anlage als physisches System, die Datenakquise und das Modell. Die entwickelten energieflexiblen Regelungsstrategien (MPR ohne und mit heuristischer Optimierung) und ihre Implementierung im Modell werden detailliert erläutert. Schließlich werden die Annahmen und Vereinfachungen des Modells im Vergleich zum realen System diskutiert.
Schlüsselwörter
Energieflexibilität, Demand-Side-Management (DSM), modellprädiktive Regelung (MPR), raumlufttechnische Anlagen (RLT), Batterieproduktion, Trockenraum, Taupunkttemperatur (TPT), Energiekosten, Treibhausgasemissionen, Sensitivitätsanalyse, Dymola, Modelica, Heuristische Optimierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Energieflexible Regelung einer Lüftungsanlage in der Battery LabFactory Braunschweig
Was ist das Thema der Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die energieflexible Regelung einer Lüftungsanlage (RLT-Anlage) in der Battery LabFactory Braunschweig (BLB). Das Hauptziel ist die Entwicklung und Bewertung energieflexibler Regelungsstrategien hinsichtlich Kosten, Umweltwirkungen und Raumklima.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit erweitert ein bestehendes Modell um energieflexible Regelungsstrategien (mit und ohne heuristische Optimierung) und bewertet diese bezüglich Kosten, Umweltwirkungen (Emissionen) und Raumklima (Taupunkttemperatur). Es wird das Energieflexibilitätspotential der RLT-Anlage analysiert.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Energieflexibilität in industriellen Prozessen, modellprädiktive Regelung (MPR) von Lüftungsanlagen, Optimierung des Energieverbrauchs bei schwankenden Strompreisen, Auswirkungen energieflexibler Regelungen auf das Raumklima und die Bewertung des Energieflexibilitätspotentials von RLT-Anlagen.
Welche theoretischen Grundlagen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Arten der Energieflexibilität (Angebots-, Nachfrage-, Speicher-, Transport- und intersektorale Flexibilität), die Funktionsweise von RLT-Anlagen in Trockenräumen, relevante Normen und Vorschriften, Modell- und Simulationsparadigmen, verschiedene Regelungsstrategien (mit Schwerpunkt auf MPR), sowie Sensitivitätsanalyse und Parameterstudien.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung (Problemstellung, Zielsetzung), Theoretische Grundlagen (Energieflexibilität, RLT-Technik, Modellierung, Regelung), Cyber-physisches System (Modellbeschreibung, Datenakquise, Regelungsstrategien), Auswertung (Ergebnisse der Regelungsstrategien, Sensitivitätsanalyse, Flexibilitätspotential) und Zusammenfassung und Ausblick.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet ein Modell der RLT-Anlage, implementiert energieflexible Regelungsstrategien (mit und ohne heuristische Optimierung), führt Simulationen durch und wertet die Ergebnisse hinsichtlich Kosten, Energieverbrauch, Emissionen und Raumklima aus. Eine Sensitivitätsanalyse und Parameterstudie werden durchgeführt.
Welche Software/Tools werden verwendet?
Die Arbeit erwähnt Dymola und Modelica im Kontext der Modellierung und Simulation. Weitere spezifische Software wird nicht explizit genannt.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert die Ergebnisse verschiedener Regelungsstrategien für einen Winter- und einen Sommermonat (Kosten, Energieverbrauch, Emissionen, Taupunkttemperaturen). Die Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse und Parameterstudie werden ebenfalls dargestellt, ebenso wie das quantifizierte Energieflexibilitätspotential der RLT-Anlage.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen bezüglich des Energieflexibilitätspotentials der untersuchten RLT-Anlage und der Wirksamkeit der entwickelten Regelungsstrategien. Eine kritische Würdigung der Ergebnisse und ein Ausblick auf zukünftige Forschungsarbeiten sind enthalten.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Energieflexibilität, Demand-Side-Management (DSM), modellprädiktive Regelung (MPR), raumlufttechnische Anlagen (RLT), Batterieproduktion, Trockenraum, Taupunkttemperatur (TPT), Energiekosten, Treibhausgasemissionen, Sensitivitätsanalyse, Dymola, Modelica, Heuristische Optimierung.
- Quote paper
- Aïcha Platzdasch (Author), 2021, Untersuchung modellprädiktiver, energie-flexibler Betriebsweisen für Lüftungsanlagen im Produktionsumfeld am Beispiel der Battery LabFactory Braunschweig, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1159457