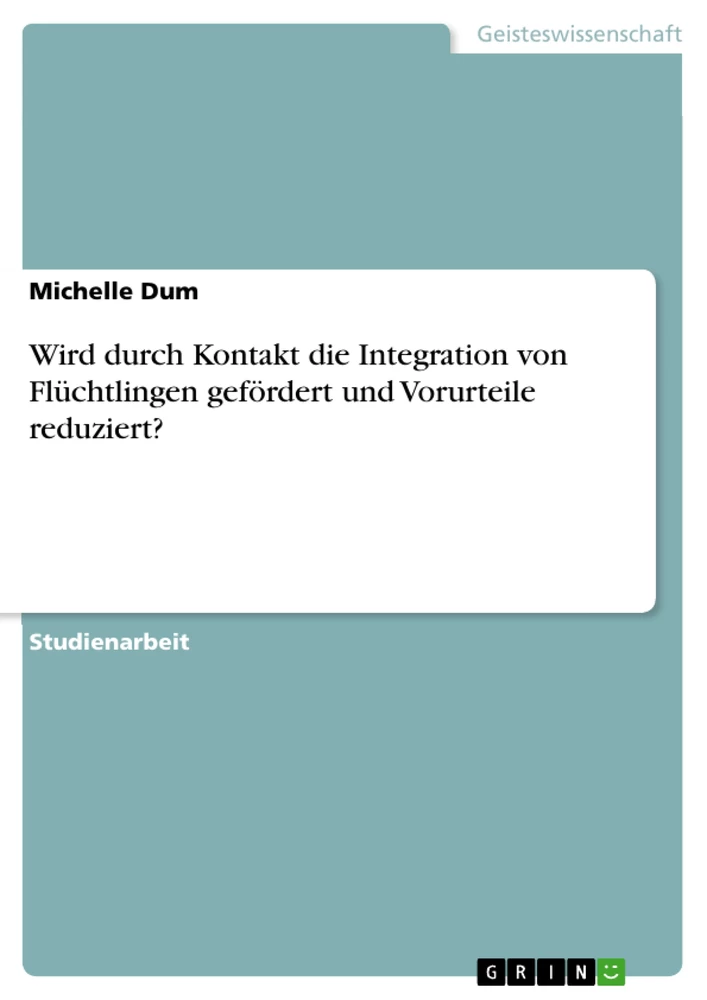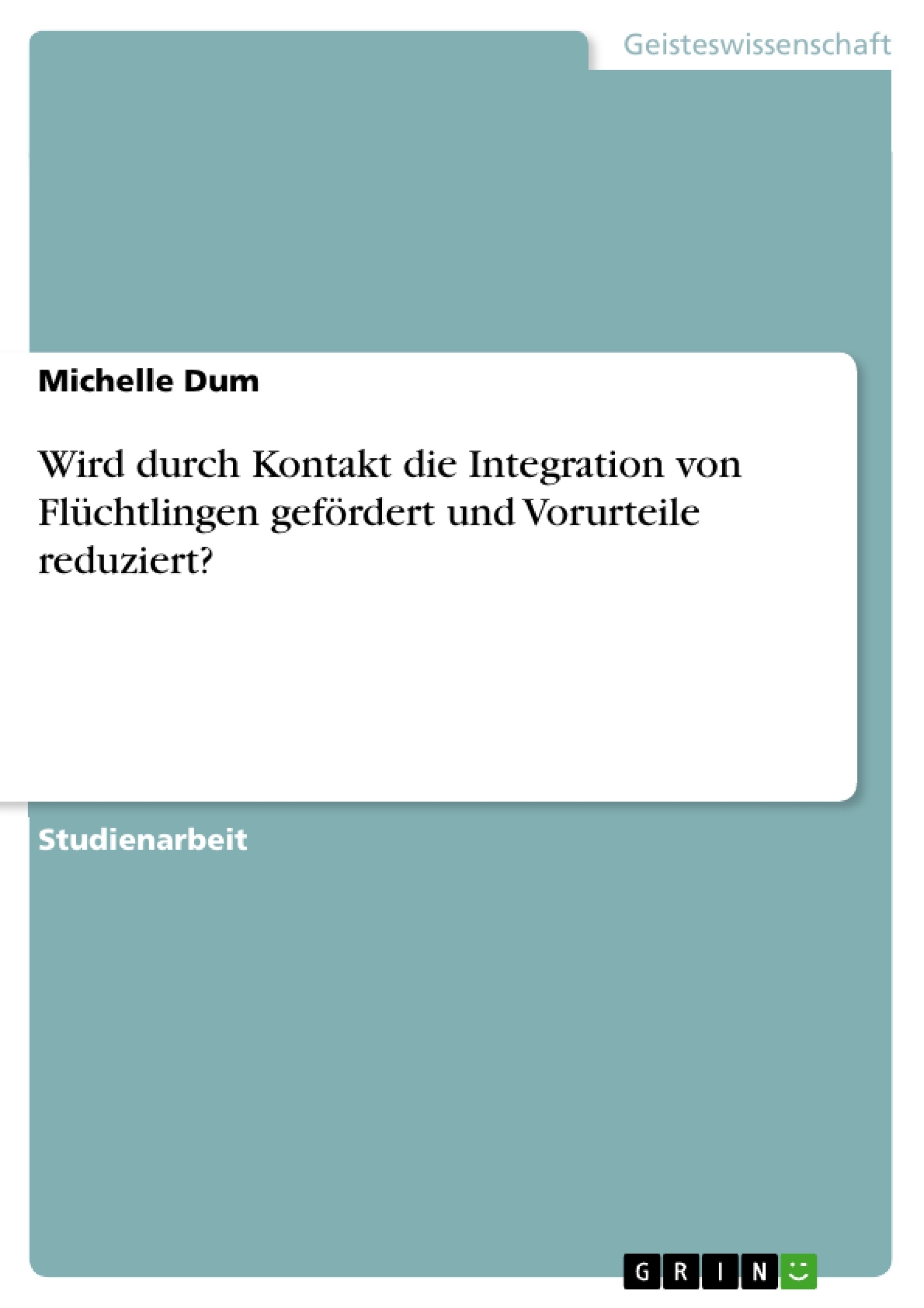Wird durch Kontakt die Integration von Flüchtlingen gefördert und Vorurteile gegenüber diesen reduziert und welche Handlungsempfehlungen für den weiteren Integrationsprozess lassen sich daraus ableiten?
Ziel der Arbeit ist es, die Kontakthypothese nach Allport auf die Integration von Flüchtlingen zu beziehen und Chancen und Grenzen des Intergruppenkontaktes zu erläutern. Gleichzeitig soll die Einstellung der deutschen Bevölkerung gegenüber Kontaktbegegnungen herausgearbeitet werden und der Einfluss des Diversity Management in Unternehmen im Hinblick auf die Integration dargelegt werden. Die Arbeit stützt sich auf literarische Quellen und der Auswertung der ALLBUS-Studie aus dem Jahr 2016.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Theoretische Grundlagen
- Theorie der sozialen Identität
- Vorurteile und Diskriminierung
- Die Kontakthypothese
- Analyse der Kontakthypothese: Integration von Flüchtlingen
- Intergruppenkontakt als Chance für Integration
- Grenzen der Kontakthypothese
- Integrationsförderung durch Diversity Management
- Einstellung zu Kontaktbegegnungen
- Diversity Management
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Anwendbarkeit der Kontakthypothese auf die Integration von Flüchtlingen in Deutschland. Sie untersucht, wie interkultureller Kontakt Vorurteile und Diskriminierung abbauen kann und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen. Die Arbeit beleuchtet zudem die Bedeutung von Diversity Management als Instrument zur Integration von Flüchtlingen in die Arbeitswelt.
- Die Kontakthypothese als theoretisches Konzept zum Abbau von Vorurteilen
- Die Anwendung der Kontakthypothese auf die Integration von Flüchtlingen
- Die Bedeutung von Intergruppenkontakt für die Integration von Flüchtlingen
- Grenzen und Herausforderungen der Kontakthypothese im Kontext von Flüchtlingsintegration
- Die Rolle von Diversity Management bei der Integrationsförderung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und skizziert die Relevanz der Kontakthypothese im Kontext von Vorurteilen gegenüber Flüchtlingen. Das zweite Kapitel erläutert die theoretischen Grundlagen, einschließlich der Theorie der sozialen Identität, Vorurteilen und Diskriminierung sowie der Kontakthypothese selbst.
Kapitel 3 analysiert die Kontakthypothese im Kontext der Integration von Flüchtlingen. Es wird diskutiert, wie Intergruppenkontakt eine Chance zur Integration darstellt und welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit positive Effekte eintreten. Zudem werden die Grenzen der Kontakthypothese beleuchtet.
Kapitel 4 befasst sich mit der Integrationsförderung durch Diversity Management. Es wird die Einstellung zu Kontaktbegegnungen mit Flüchtlingen analysiert und die Rolle von Diversity Management als Instrument zur Integration in die Arbeitswelt dargestellt.
Schlüsselwörter
Kontakthypothese, Vorurteile, Diskriminierung, Flüchtlinge, Integration, Intergruppenkontakt, Diversity Management, Sozialpsychologie
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die Kontakthypothese nach Allport?
Die Hypothese besagt, dass direkter Kontakt zwischen verschiedenen Gruppen Vorurteile abbauen kann, wenn bestimmte Bedingungen (z.B. gleicher Status, gemeinsame Ziele) erfüllt sind.
Fördert Kontakt die Integration von Flüchtlingen?
Die Arbeit zeigt auf, dass Intergruppenkontakt große Chancen für die Integration bietet, aber auch an Grenzen stößt, wenn die Rahmenbedingungen negativ sind.
Welche Rolle spielt Diversity Management in Unternehmen?
Diversity Management dient als Instrument, um Flüchtlinge erfolgreich in die Arbeitswelt zu integrieren und Vorurteile in der Belegschaft abzubauen.
Was sagt die ALLBUS-Studie 2016 aus?
Die Studie wird in der Arbeit genutzt, um die tatsächliche Einstellung der deutschen Bevölkerung gegenüber Kontaktbegegnungen mit Flüchtlingen zu analysieren.
Was sind die theoretischen Grundlagen der Arbeit?
Neben der Kontakthypothese werden die Theorie der sozialen Identität sowie Konzepte zu Vorurteilen und Diskriminierung herangezogen.
- Quote paper
- Michelle Dum (Author), 2021, Wird durch Kontakt die Integration von Flüchtlingen gefördert und Vorurteile reduziert?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1159542