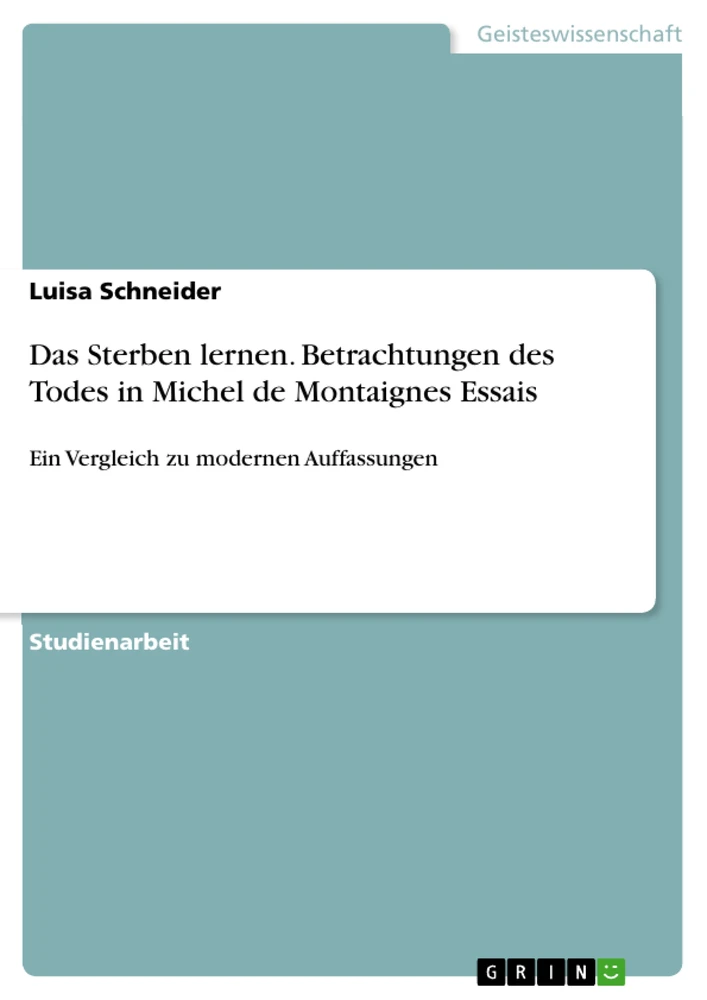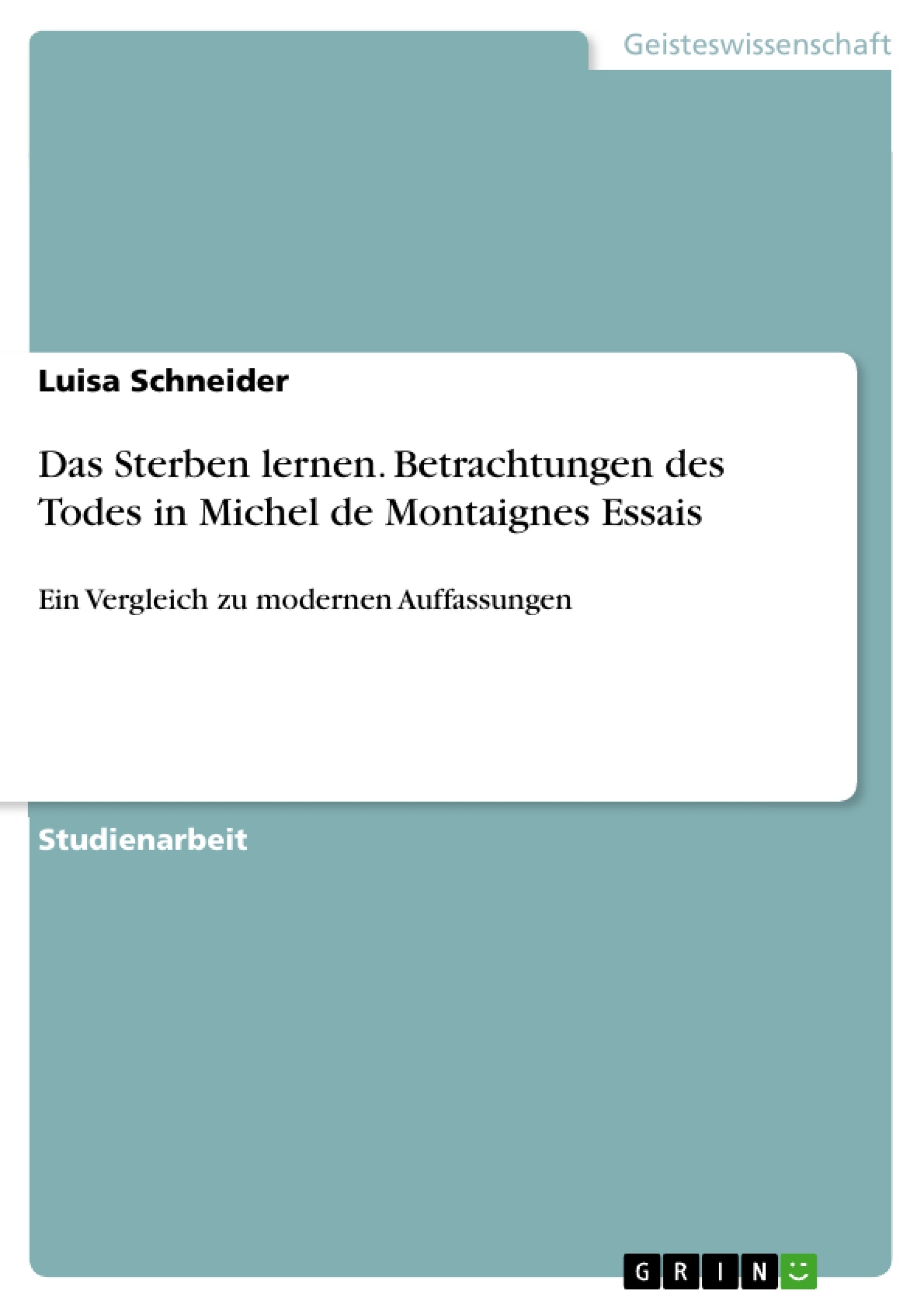Was ist der Tod und wann kommt er? Wie verhält man sich gegenüber dem Tod und hat das Leben im Angesicht des Todes überhaupt einen Sinn? Ob Michel de Montaignes Thesen in einem Gegensatz zu gegenwärtigen Auffassungen bezüglich des Umgangs mit dem Tod stehen, soll in dieser Arbeit analysiert werden. Speziell soll herausgearbeitet werden, ob Montaignes Ideen vom Tod über die Literatur moderner Philosoph*innen hinaus Anschluss an das Denken der Menschen im 21. Jahrhundert gefunden haben.
Die Basis für diesen Vergleich bilden Montaignes Ausführungen aus seinen Essais „Philosophieren heißt sterben lernen“ sowie „über das Üben“ versus aktuelle Literatur über die moderne Todesthematik in Deutschland.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Montaignes Todesbetrachtungen
- 2.1 Der Tod in den Essais
- 2.2 Das Sterben lernen in Montaignes Essai Nr. 20, Buch eins
- 2.3 Die Einübung des Todes in Montaignes Essai Nr. 6, Buch zwei
- 3. Zur Relevanz von Montaignes Ausführungen über den Tod für die Gegenwart
- 3.1 Todesfurcht im 21. Jahrhundert
- 3.2 Die Vorbereitung auf den Tod
- 3.3 Medialisierung und Bebilderung des Todes
- 3.4 Paradoxien im Umgang mit dem Tod im 21. Jahrhundert
- 3.5 Montaignes Betrachtungen des Todes im Vergleich zum Umgang mit dem Tod im 21. Jahrhundert
- 4. Reflexion der Arbeit und Ausblick in die Zukunft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Analyse von Michel de Montaignes Todesbetrachtungen in seinen Essais und deren Relevanz für die Gegenwart. Dabei werden die zentralen Thesen Montaignes zum Sterben lernen und die Einübung des Todes mit modernen Auffassungen zum Umgang mit dem Tod im 21. Jahrhundert verglichen.
- Montaignes Verständnis des Todes als allgegenwärtiges Phänomen
- Die Bedeutung des Sterben Lernens für ein gelingendes Leben
- Montaignes Kritik an der christlichen Todesdeutung
- Der Umgang mit Todesfurcht und die Vorbereitung auf den Tod im 21. Jahrhundert
- Die Medialisierung und Bebilderung des Todes in der heutigen Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einleitung in die Thematik des Todes in Montaignes Essais. Es wird betont, dass der Tod für Montaigne ein allgegenwärtiges Thema ist, das sich in verschiedenen Werken widerspiegelt. Es wird auch auf Montaignes persönliche Erfahrungen mit dem Tod und seine eigene Todesneugier eingegangen.
Kapitel 2.1 widmet sich Montaignes Todesbetrachtungen im Allgemeinen. Die Essais werden als eine ruhige und unaufgeregte Auseinandersetzung mit dem Tod dargestellt. Dabei werden auch zeitgenössische Interpretationen von Montaignes Werk, wie z.B. die Wiederkehr stoischer Todesbewältigung, berücksichtigt.
In den Kapiteln 2.2 und 2.3 werden zwei wichtige Essais von Montaigne genauer beleuchtet: "Philosophieren heißt Sterben lernen" und "Über das Üben". Es werden die zentralen Thesen dieser Essays und Montaignes Ansichten zum Sterben Lernen und der Einübung des Todes herausgearbeitet.
Kapitel 3.1 behandelt die Todesfurcht im 21. Jahrhundert. Es werden aktuelle Erkenntnisse über den Umgang mit dem Tod in der heutigen Gesellschaft vorgestellt.
Kapitel 3.2 beschäftigt sich mit der Vorbereitung auf den Tod. Es werden verschiedene Ansätze und Methoden zur Bewältigung des Todes im 21. Jahrhundert beleuchtet.
Kapitel 3.3 befasst sich mit der Medialisierung und Bebilderung des Todes in der heutigen Zeit. Es wird der Einfluss von Medien auf unsere Vorstellung vom Tod und seine Auswirkungen auf den Umgang mit dem Tod diskutiert.
Kapitel 3.4 bietet eine Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse und zeigt die Paradoxien im Umgang mit dem Tod im 21. Jahrhundert auf.
Kapitel 3.5 vergleicht Montaignes Todesbetrachtungen mit dem Umgang mit dem Tod im 21. Jahrhundert und beantwortet die Forschungsfrage der Arbeit.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Michel de Montaigne, Essais, Sterben lernen, Einübung des Todes, Todesfurcht, Vorbereitung auf den Tod, Medialisierung des Todes, Todesthematik im 21. Jahrhundert, Paradoxien im Umgang mit dem Tod.
Häufig gestellte Fragen
Was meint Montaigne mit dem Satz „Philosophieren heißt sterben lernen“?
Montaigne vertritt die Ansicht, dass die ständige gedankliche Auseinandersetzung mit dem Tod die Furcht davor nimmt und somit erst ein freies und bewusstes Leben ermöglicht.
Wie unterscheidet sich Montaignes Todesbild vom modernen Umgang mit dem Tod?
Während Montaigne den Tod als allgegenwärtigen Teil des Lebens akzeptierte, wird der Tod im 21. Jahrhundert oft medikalisiert, tabuisiert oder in paradoxer Weise durch Medien konsumiert.
Was versteht Montaigne unter der „Einübung des Todes“?
In seinem Essai „Über das Üben“ beschreibt er, wie Grenzerfahrungen oder Krankheiten dazu dienen können, sich dem Phänomen des Sterbens anzunähern und die Angst vor dem Unbekannten zu verlieren.
Wie beeinflussen Medien unsere heutige Vorstellung vom Tod?
Die heutige Zeit ist geprägt von einer „Bebilderung“ des Todes in Nachrichten und Filmen, was jedoch oft nicht zu einer echten persönlichen Vorbereitung auf das eigene Sterben führt.
Ist Montaignes Philosophie heute noch aktuell?
Ja, seine unaufgeregte und stoische Sichtweise bietet auch im 21. Jahrhundert wertvolle Impulse, um der weitverbreiteten Todesfurcht und der Verdrängung des Sterbens entgegenzuwirken.
- Quote paper
- Luisa Schneider (Author), 2020, Das Sterben lernen. Betrachtungen des Todes in Michel de Montaignes Essais, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1159567