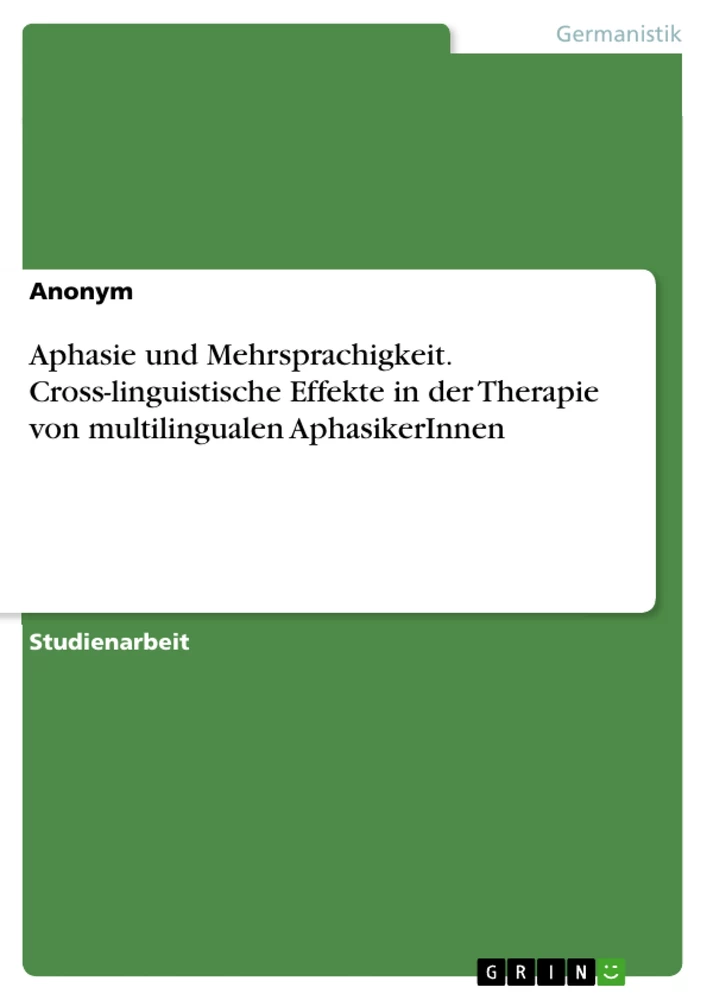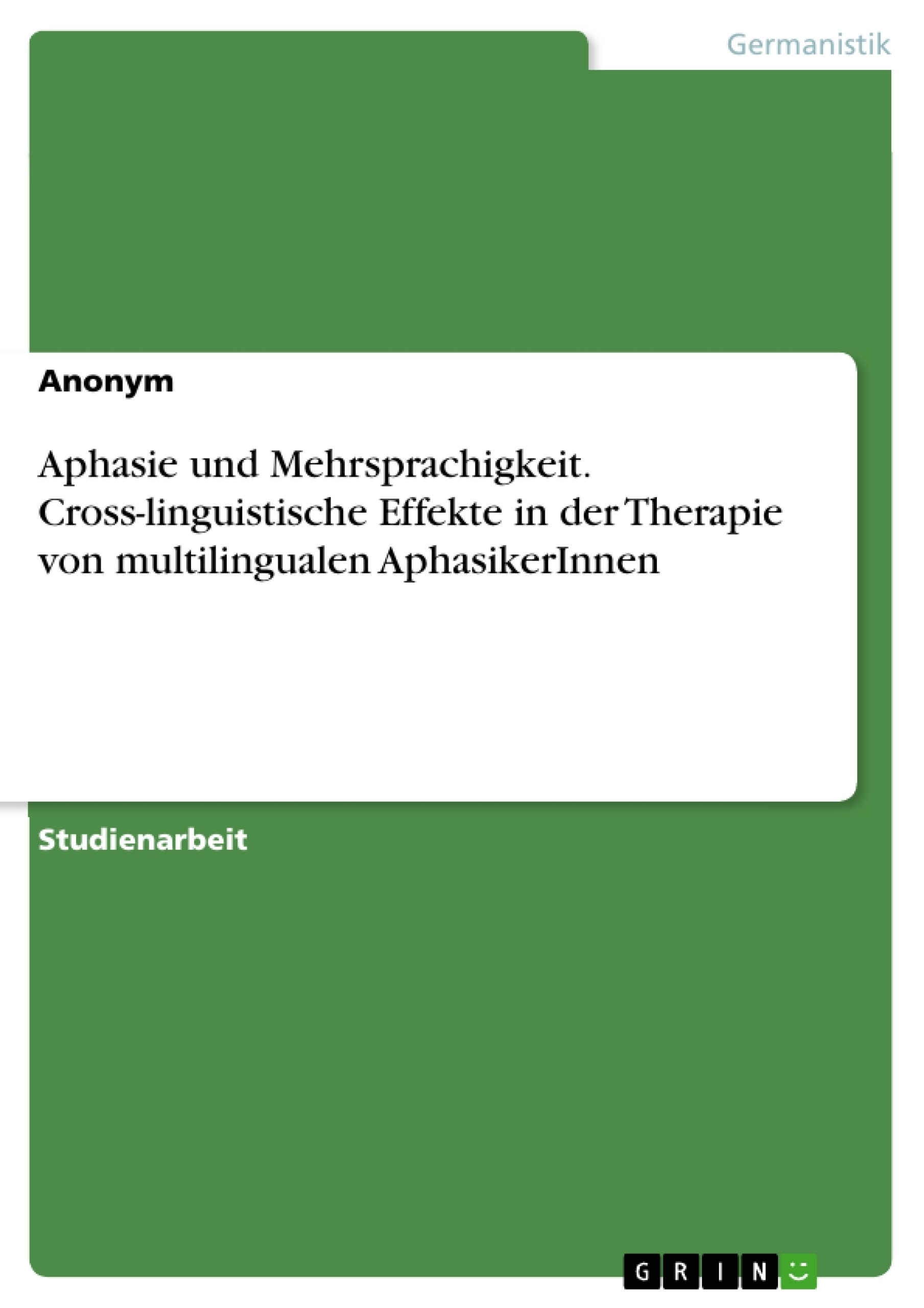Ziel dieser Hausarbeit ist es, Argumente, die für die Existenz des cross-linguistischen Transfers sprechen sowie verschiedene Faktoren, die diesen fördern, herauszuarbeiten und die Vorteile, die in der Therapie mit mehrsprachigen AphasikerInnen durch den CLT entstehen, ausführlich darzustellen.
Eine wichtige Rolle spielen hierbei die sogenannten Cognates, also Wörter, die auf einen gemeinsamen Ursprung zurückzuführen sind. Aus den vorab getätigten Überlegungen ergibt sich folgende These, die am Ende der Hausarbeit rückblickend reflektiert werden soll: „In der Therapie von mehrsprachigen AphasikerInnen nimmt das Training mit Cognates eine Sonderstellung ein, da die etymologische Verwandtschaft von Sprachen cross-linguistische Transfererscheinungen begünstigt.“
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitionen
- Mehrsprachigkeit
- Multilinguale/Bilinguale Aphasie
- Cognates und Non-Cognates
- Diagnose und Therapie
- Bilinguale Aphasie Test (BAT)
- Erste Überlegungen zur Therapie
- Mehrsprachige Gehirne
- Cross-linguistischer Transfer
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Therapie von mehrsprachigen AphasikerInnen und untersucht insbesondere den cross-linguistischen Transfer Effekt (CLT) als vielversprechende Therapiemethode. Die Arbeit analysiert die Argumente, die für die Existenz des CLT sprechen, sowie verschiedene Faktoren, die diesen Effekt fördern.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs der Mehrsprachigkeit im Kontext der Aphasie
- Erläuterung des cross-linguistischen Transfer Effekts und dessen Relevanz für die Sprachtherapie
- Analyse der Rolle von Cognates im therapeutischen Prozess
- Untersuchung verschiedener Sprachszugriffstheorien, die den cross-linguistischen Transfer erklären
- Bewertung der Vorteile, die sich durch den Einsatz des CLT in der Therapie von mehrsprachigen AphasikerInnen ergeben
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema der Hausarbeit vor und verdeutlicht die Relevanz der Forschung zu Aphasie und Mehrsprachigkeit in der heutigen, zunehmend mehrsprachigen Gesellschaft.
- Definitionen: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Definition von Mehrsprachigkeit, Aphasie und den Begriffen Cognates und Non-Cognates. Es wird hierbei deutlich, dass die Definition von Mehrsprachigkeit im Kontext der Aphasie eine besondere Herausforderung darstellt, da die Sprachkenntnisse von AphasikerInnen oft unterschiedlich stark ausgeprägt sind.
- Diagnose und Therapie: In diesem Kapitel werden erste Überlegungen zur Diagnostik und Therapie von mehrsprachigen AphasikerInnen angestellt. Hierbei wird der Bilinguale Aphasie Test (BAT) als standardisiertes Diagnoseverfahren vorgestellt. Die Herausforderungen, die sich aus der Behandlung von multilingualen AphasikerInnen ergeben, werden ebenfalls erläutert.
- Mehrsprachige Gehirne: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Sprachszugriffstheorien, die sich mit der Struktur mehrsprachiger Gehirne auseinandersetzen und als Beleg für den cross-linguistischen Transfer dienen.
- Cross-linguistischer Transfer: Dieses Kapitel stellt den cross-linguistischen Transfer Effekt (CLT) in den Mittelpunkt und beleuchtet dessen Bedeutung für die Therapie von mehrsprachigen AphasikerInnen. Es werden Beweise für die Existenz des CLT vorgestellt und Voraussetzungen für einen erfolgreichen therapeutischen Einsatz des CLT erläutert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe dieser Hausarbeit sind Mehrsprachigkeit, Aphasie, cross-linguistischer Transfer, Cognates, Non-Cognates, Bilinguale Aphasie Test (BAT) und Sprachszugriffstheorien. Diese Begriffe beleuchten die interdependente Beziehung zwischen Sprachen im Gehirn und die Möglichkeiten, diese in der Therapie von mehrsprachigen AphasikerInnen effektiv zu nutzen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der cross-linguistische Transfer (CLT) bei Aphasie?
CLT bezeichnet den Effekt, bei dem Therapieerfolge in einer Sprache (z.B. der Muttersprache) positive Auswirkungen auf die Fähigkeiten in einer anderen Sprache des Patienten haben.
Welche Rolle spielen 'Cognates' in der Sprachtherapie?
Cognates sind Wörter mit gemeinsamem Ursprung (z.B. "Haus" und "House"). Sie fördern den Transfer zwischen Sprachen, da sie im Gehirn oft über gemeinsame Netzwerke verarbeitet werden.
Was ist der Bilinguale Aphasie Test (BAT)?
Der BAT ist ein standardisiertes Diagnoseverfahren, das speziell entwickelt wurde, um die Sprachfähigkeiten von multilingualen Aphasikern in all ihren Sprachen objektiv zu erfassen.
Wie sind mehrsprachige Gehirne strukturiert?
Sprachzugriffstheorien legen nahe, dass Sprachen nicht völlig getrennt, sondern in einem vernetzten System gespeichert sind, was den gegenseitigen Einfluss (Transfer) ermöglicht.
Sollte man in der Therapie alle Sprachen des Patienten einbeziehen?
Die Arbeit argumentiert, dass die Nutzung von Transfererscheinungen durch gezieltes Training (z.B. mit Cognates) die Effizienz der Therapie erheblich steigern kann.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2021, Aphasie und Mehrsprachigkeit. Cross-linguistische Effekte in der Therapie von multilingualen AphasikerInnen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1159590