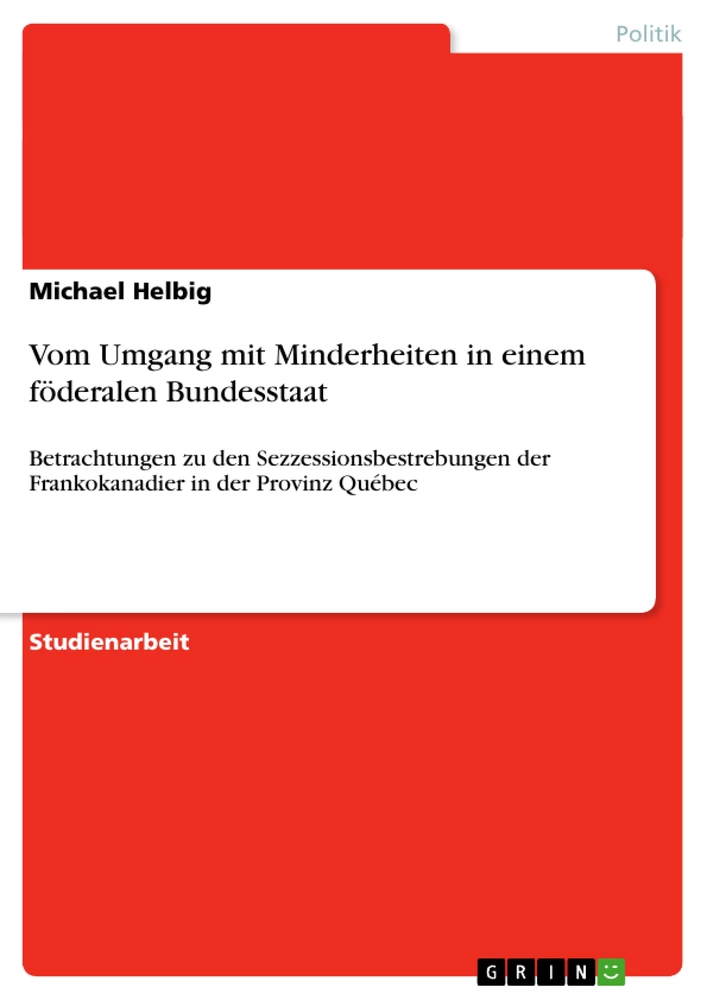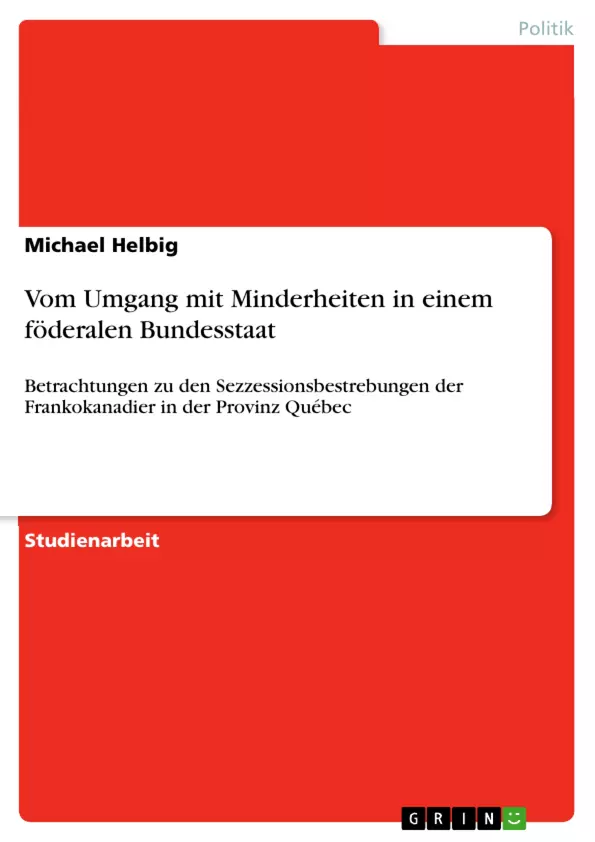Das Gerüst der vorliegenden Ausarbeitung bilden die folgenden Fragen:
Wie sind die historischen Ausgangsbedingungen?
Wo gibt es ähnlich gelagerte Probleme und sind diese vergleichbar?
Wieso entwickelte sich Frankokanada in eine konservative Richtung, während im Mutterland 1789 eine (bürgerlich-liberale) Revolution stattfand? Wieso entwickelte sich Montréal „anglophoner“ als der Rest der Provinz? Welche Rolle spielte die Religion und warum? Wo liegen die Spannungslinien zwischen Québec und der Bundesregierung in Ottawa (vom Beginn der Besiedlung bis zur Gegenwart) ?Wird sich Québec über ein weiteres Referendum abspalten können? Wie könnte sich Gesamtkanada damit weiterentwickeln?
Da das Gebiet Québec seit den ersten Einwanderungswellen in seinem Kern faktisch unverändert ist, eignet es sich gut für eine genauere Betrachtung der politischen Entwicklung unter Einbindung historischer Fakten.
Die patriotischen Spannungen in Québec sind von Interesse, denn heute ist Kanada eine der führenden Industrienationen der westlichen Welt. Somit lässt sich, in der Nachbetrachtung zur Staatsgründung aufzeigen, wie ein demokratischer Staat mit Problemen und Fragen einer Bevölkerungsgruppe – einer Minderheit in Kanada, aber einer Majorität in Québec – umgeht.
Die Ausgangsbedingungen für den Minderheitenstatus der „Québécois“ und die Einordnung des Themas stelle ich am Anfang in einem Überblick, als ersten Schwerpunkt dar. Die Provinz Québec entstand 1867, als Kanada gegründet und als „Dominion“ aus der unmittelbaren kolonialen Abhängigkeit zum Mutterland Großbritannien entlassen wurde.
Die entscheidenden Ereignisse, welche die Weichen für den Minderheitenstatus der Frankokanadier in Nordamerika stellten, liegen aber noch weiter zurück und sind europäisch beeinflusst.
Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit gilt dem Zeitraum seit 1980 und den Entwicklungen, die seit der ersten Volksabstimmung (Referendum) zur Abspaltung zu beobachten sind.
Am Ende der Arbeit, in der politikwissenschaftlichen Bewertung der Ergebnisse und dem Ausblick werden die ausgearbeiteten Punkte gewürdigt.
Im Anhang erfolgt eine ausführliche chronologische Darstellung der Ereignisse; er beinhaltet auch einen Statistikteil.
Zusätzlich werden in Fußnoten auch Übersetzungen aufgezeigt.
Außen vor bleiben in der Hausarbeit Betrachtungen zu Gesamtkanada, insbesondere zu den indigenen Urvölkern und den Inuit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ausgangsbedingungen für den Minderheitenstatus der „Québécois“
- Einordnung vergleichbarer Problemfelder
- Allgemeines zu Minderheiten
- Benennung von Minderheitenproblematiken
- Entstehung einer frankokanadischen Identität in Kanada
- Die Entwicklung bis zur Gründung der Union 1867
- Der Gründungsakt 1867 aus der Sicht Québecs
- Neuere Tendenzen
- Die politischen Entwicklungen in Québec von 1980 bis 1995
- Spannungspunkte zwischen Québec und Ottawa
- Erstes Referendum zur Unabhängigkeit in Québec (1980)
- Constitution Act (1982)
- Volksabstimmung zum Abkommen von Charlottetown (1992)
- Zweites Referendum zur Unabhängigkeit in Québec (1995)
- Die aktuelle Problemlage seit 1995
- Das Meech Lake-Abkommen (1987) und der „Bloc Québécois" (1990)
- Rechtliche Klärung der Separationsfrage Kanadas
- Die Verfassungskonferenz von Calgary (1998)
- Québecs,,Traditionelle Forderungen“
- Mögliche Entwicklungsperspektiven
- Politikwissenschaftliche Bewertung der Ergebnisse der Untersuchung und Ausblick
- Bewertung
- Staatstheoretische Bewertung des Separationswunsches
- Begrifflichkeit des „Québec-Nationalismus“
- Schlussbemerkungen
- Zusammenfassung und Ausblick
- Anhang
- Politisches System Kanadas
- Statistik
- Chronologie
- Quellen- und Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der politischen Identität Québecs und untersucht die Sezessionsbestrebungen der Frankokanadier in der Provinz. Sie analysiert die historischen Ausgangsbedingungen, die Entstehung einer frankokanadischen Identität und die Spannungslinien zwischen Québec und der Bundesregierung in Ottawa. Die Arbeit beleuchtet die politischen Entwicklungen seit 1980, insbesondere die beiden Referenden zur Unabhängigkeit, und untersucht die aktuelle Problemlage. Die Arbeit zielt darauf ab, die Ursachen für den Separationswunsch der Québécois zu verstehen und mögliche Entwicklungsperspektiven aufzuzeigen.
- Die Entstehung und Entwicklung einer frankokanadischen Identität in Kanada
- Die historischen und politischen Spannungen zwischen Québec und der Bundesregierung in Ottawa
- Die Sezessionsbestrebungen der Frankokanadier in Québec und die beiden Referenden zur Unabhängigkeit
- Die aktuelle Problemlage und mögliche Entwicklungsperspektiven
- Die staatstheoretische Bewertung des Separationswunsches und die Begrifflichkeit des „Québec-Nationalismus“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellungen der Hausarbeit vor und erläutert die Relevanz des Themas. Sie beleuchtet die historischen Ausgangsbedingungen für den Minderheitenstatus der „Québécois“ und die Einordnung des Themas in vergleichbare Problemfelder. Die Einleitung führt den Leser in die Thematik ein und gibt einen Überblick über die zentralen Fragen, die in der Arbeit behandelt werden.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Entstehung einer frankokanadischen Identität in Kanada. Es analysiert die Entwicklung bis zur Gründung der Union 1867 und beleuchtet den Gründungsakt aus der Sicht Québecs. Das Kapitel untersucht die historischen Prozesse, die zur Entstehung einer eigenen Identität der Frankokanadier führten und die Herausforderungen, denen sie sich gegenüber sahen.
Das dritte Kapitel behandelt die politischen Entwicklungen in Québec von 1980 bis 1995. Es analysiert die Spannungspunkte zwischen Québec und Ottawa, insbesondere die beiden Referenden zur Unabhängigkeit. Das Kapitel beleuchtet die politischen Ereignisse, die die Beziehungen zwischen Québec und der Bundesregierung prägten und die Sezessionsbestrebungen der Frankokanadier verstärkten.
Das vierte Kapitel befasst sich mit der aktuellen Problemlage seit 1995 und möglichen Entwicklungsperspektiven. Es analysiert die rechtliche Klärung der Separationsfrage Kanadas und die Verfassungskonferenz von Calgary. Das Kapitel untersucht die aktuellen Herausforderungen, denen sich Québec und Kanada gegenübersehen, und diskutiert mögliche Szenarien für die Zukunft.
Die politikwissenschaftliche Bewertung der Ergebnisse der Untersuchung und der Ausblick beleuchten die staatstheoretische Bewertung des Separationswunsches und die Begrifflichkeit des „Québec-Nationalismus“. Die Schlussbemerkungen fassen die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen und geben einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die politische Identität, Minderheiten, Sezessionsbestrebungen, Frankokanadier, Québec, Kanada, Föderalismus, Nationalismus, Referendum, Unabhängigkeit, Spannungslinien, historische Entwicklung, politische Entwicklung, Verfassung, Politikwissenschaft, staatstheoretische Bewertung.
Häufig gestellte Fragen
Warum gibt es in Québec Bestrebungen zur Abspaltung von Kanada?
Die Bestrebungen wurzeln in der frankokanadischen Identität und dem Wunsch nach kultureller, sprachlicher und politischer Souveränität gegenüber dem englischsprachigen Kanada.
Wann fanden die Referenden zur Unabhängigkeit statt?
Es gab zwei große Volksabstimmungen in Québec: das erste Referendum im Jahr 1980 und das zweite im Jahr 1995, welches nur sehr knapp gegen die Abspaltung ausging.
Was ist der "Bloc Québécois"?
Der Bloc Québécois ist eine 1990 gegründete Bundespartei in Kanada, die die Interessen der Provinz Québec auf nationaler Ebene vertritt und die Souveränität fördert.
Welche Rolle spielte die Geschichte für den Minderheitenstatus der Québécois?
Die Eroberung Neufrankreichs durch Großbritannien und der spätere Gründungsakt von 1867 legten die Basis für die Spannungen zwischen der französischsprachigen Minderheit und der anglophonen Mehrheit.
Wie geht der kanadische Bundesstaat mit dem Separatismus um?
Kanada nutzt demokratische Prozesse, Verfassungsabkommen (wie das von Charlottetown) und rechtliche Klärungen durch den Supreme Court, um die Einheit des Staates zu wahren.
- Arbeit zitieren
- Diplom-Verwaltungswirt, Bachelor of Arts Michael Helbig (Autor:in), 2002, Vom Umgang mit Minderheiten in einem föderalen Bundesstaat, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/115960