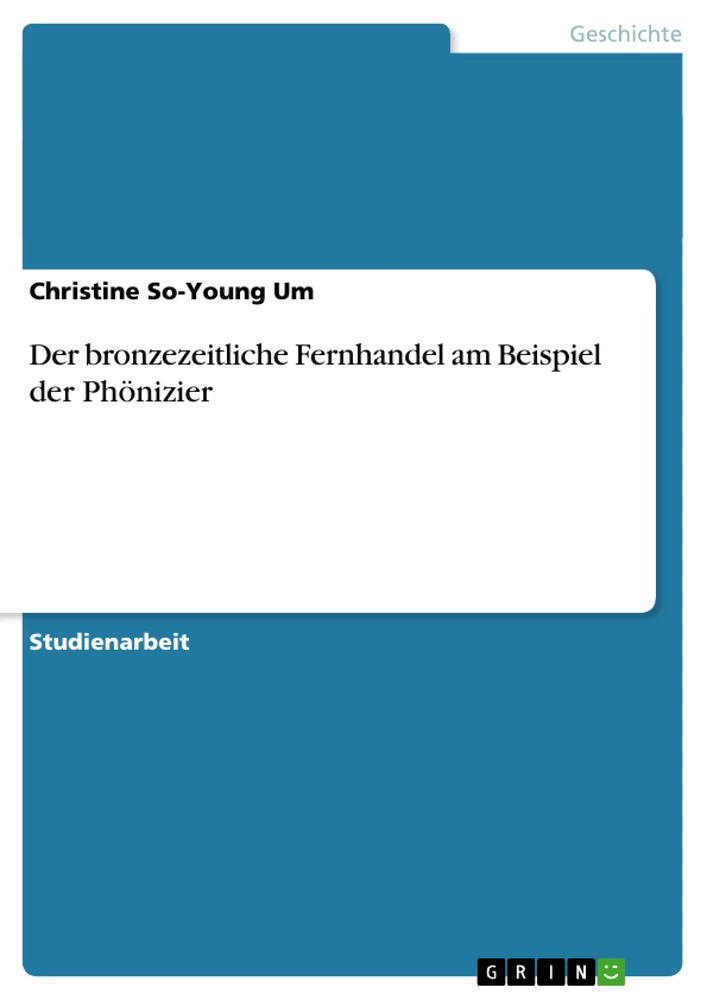Was die vormoderne Zeit betrifft, muss man leider lange und so gut wie
vergebens nach einer brauchbaren Definition des Begriffs „Fernhandel“
recherchieren. Zwar ist die Forschungslage zum Thema Fernhandel dank der
Mediävistik recht vorzeigbar, doch leider ist die Quellenlage zum Altertum
eher dürftig. Man findet viele spezifische Auseinandersetzungen des
vormodernen Fernhandels, jedoch mangelt es an populär-wissenschaftlichen
Gesamtdarstellungen über dieses Materie. Daher sollen die in dieser Arbeit
vorgelegten Definitionsversuche auch als solche, nämlich im wörtlichen Sinne
„Versuche“ angesehen werden. Anhand einer ausgewählten Theorie zum
Thema Fernhandel soll ein konkretes Beispiel behandelt werden: der
interkontinentale Handel der Phöniker.
Zum Schluss soll der Versuch unternommen werden, anhand der
dargelegten Theorie und dem Beispiel einen Abriss über das gesamte
Thema herzustellen. In diesem Zusammenhang soll auch versucht werden,
die Frage des Seminartitels, nämlich „was Historiker daraus lernen können“
zu beantworten. Leider stellte sich die Recherche nach einer Definition des Begriffs
„Fernhandels“ schwieriger (und vor allem auch als weniger zufrieden
stellend) als erwartet war. Das Altertum betreffend scheint es keine
handfeste Begriffsbestimmung zu geben, wenn es auch eine ganze Reihe
von Altertumshistorikern gibt, die sich mit dem Fernhandel
auseinandersetzen. Obwohl Fernhandel bereits im Altertum eine mindestens
genauso wichtige Rolle gespielt hat wie später, findet man erste konkrete
Auslegungen nur in der Mediävistik. Zwar nennt das Lexikon der Antike unter dem Titel „Handel“ charakteristische
Merkmale des Fernhandels, macht hingegen aber keine genauen
Differenzierungen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Der Begriff „Fernhandel"
- Bronzezeit
- Theorie des Fernhandels
- Sahlins' Handelssysteme
- Die vier,,Säulen“ des Handelns
- Fernhandel
- Die Phönizier
- Schlussbetrachtung
- Ergebnisse
- ,,...und was Historiker daraus lernen können."
- Literaturverzeichnis
- Literatur
- Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit dem bronzezeitlichen Fernhandel am Beispiel der Phönizier. Ziel ist es, den Begriff „Fernhandel" im Kontext der Vormoderne zu definieren und anhand einer ausgewählten Theorie, Sahlins' Handelssysteme, die Funktionsweise des Fernhandels zu analysieren. Die Arbeit untersucht die Rolle der Phönizier im interkontinentalen Handel und versucht, anhand der dargelegten Theorie und dem Beispiel einen Abriss über das gesamte Thema herzustellen.
- Definition des Begriffs „Fernhandel" in der Vormoderne
- Analyse des Fernhandels anhand von Sahlins' Handelssystemen
- Die Rolle der Phönizier im interkontinentalen Handel
- Bedeutung des Fernhandels für die Gesellschaft
- Relevanz des Themas für die Geschichtsforschung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Schwierigkeit, den Begriff „Fernhandel" in der Vormoderne zu definieren, da es an handfesten Begriffsbestimmungen mangelt. Die Arbeit stellt fest, dass der ökonomische Aspekt des Handels in der Antike von Altertumsforschern wenig beachtet wurde, obwohl der Fernhandel bereits in früher Zeit eine wichtige Rolle spielte. Die Einleitung führt in die Bronzezeit ein, die als Kulturperiode zwischen Ende des 3. und Anfang des 1. Jahrtausend vor Christus definiert wird und durch die Verwendung von Bronze als wichtiges Rohmaterial gekennzeichnet ist. Die Bronzezeit ist geprägt von großen sozialen und wirtschaftlichen Umwälzungen, die mit der Verwendung von Bronze einhergingen, wie z.B. Bergbau, Verhüttungsmethoden und Serienfertigungen. Die Einleitung stellt fest, dass der Fernhandel während der Bronzezeit eine wichtige Rolle spielte, da er den Transport von Erzen von den Gewinnungsstätten zum Festland ermöglichte.
Der zweite Abschnitt der Arbeit beschäftigt sich mit der Theorie des Fernhandels. Er stellt Sahlins' Handelssysteme vor, die vier verschiedene Handelssysteme beschreiben: das „generalisierte Reziprozitätssystem", das „ausgeglichene Reziprozitätssystem", das „negativ-reziproke System" und das „Markt-System". Die Arbeit erläutert die Funktionsweise dieser Systeme und zeigt, wie sie sich auf den Fernhandel anwenden lassen. Der Abschnitt beleuchtet auch die vier „Säulen“ des Handelns, die Sahlins als Grundlage für den Handel identifiziert: die „Vertrauenssphäre", die „Wertsphäre", die „Austauschsphäre" und die „Kontrollsphäre".
Der dritte Abschnitt der Arbeit widmet sich dem Fernhandel der Phönizier. Er beschreibt die Phönizier als ein Volk, das im 1. Jahrtausend vor Christus im östlichen Mittelmeerraum lebte und für seinen interkontinentalen Handel bekannt war. Die Arbeit beleuchtet die Handelswege der Phönizier, die von der Levante bis nach Spanien und Afrika reichten, und die Waren, die sie transportierten, wie z.B. Metalle, Textilien, Gewürze und Sklaven. Der Abschnitt zeigt, wie der Fernhandel der Phönizier zur Verbreitung von Kultur und Technologie beitrug und die Entwicklung der antiken Welt beeinflusste.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Fernhandel, die Bronzezeit, die Phönizier, Sahlins' Handelssysteme, Reziprozität, Markt-System, interkontinentaler Handel, Kulturtransfer, Wirtschaftsgeschichte und die Vormoderne. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung des Fernhandels in der Bronzezeit und analysiert die Funktionsweise des Handels anhand von Sahlins' Handelssystemen. Der Fokus liegt auf der Rolle der Phönizier im interkontinentalen Handel und deren Beitrag zur Verbreitung von Kultur und Technologie.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Begriff „Fernhandel“ im Altertum?
Die Definition von Fernhandel im Altertum ist schwierig, da schriftliche Quellen oft fehlen. In dieser Arbeit wird Fernhandel als interkontinentaler Austausch von Waren über weite Distanzen betrachtet, wie er beispielsweise von den Phöniziern betrieben wurde.
Welche Rolle spielten die Phönizier im bronzezeitlichen Handel?
Die Phönizier waren im 1. Jahrtausend v. Chr. führend im interkontinentalen Handel. Sie transportierten Metalle, Textilien, Gewürze und Sklaven von der Levante bis nach Spanien und Afrika und trugen so maßgeblich zum Kulturtransfer bei.
Was sind Sahlins' Handelssysteme?
Marshall Sahlins unterscheidet vier Handelssysteme: die generalisierte Reziprozität, die ausgeglichene Reziprozität, das negativ-reziproke System und das Markt-System. Diese Theorien helfen dabei, die Austauschprozesse in der Vormoderne zu analysieren.
Was kennzeichnet die Bronzezeit als Epoche?
Die Bronzezeit (ca. Ende 3. bis Anfang 1. Jahrtausend v. Chr.) ist durch die Verwendung von Bronze als wichtigstem Rohstoff sowie durch soziale Umwälzungen, Bergbau und die Entstehung komplexer Handelswege geprägt.
Warum ist die Quellenlage zum antiken Fernhandel problematisch?
Während die Mediävistik viele Quellen bietet, ist die Quellenlage für das Altertum dürftig. Es gibt wenig populär-wissenschaftliche Gesamtdarstellungen, weshalb Forscher oft auf Definitionsversuche und theoretische Modelle angewiesen sind.
Was können Historiker aus der Analyse des antiken Handels lernen?
Historiker gewinnen Erkenntnisse über die wirtschaftliche Vernetzung, soziale Hierarchien und den technologischen Fortschritt früherer Zivilisationen sowie über die Mechanismen des interkulturellen Austauschs.
- Quote paper
- M.A. Christine So-Young Um (Author), 2005, Der bronzezeitliche Fernhandel am Beispiel der Phönizier, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/115968