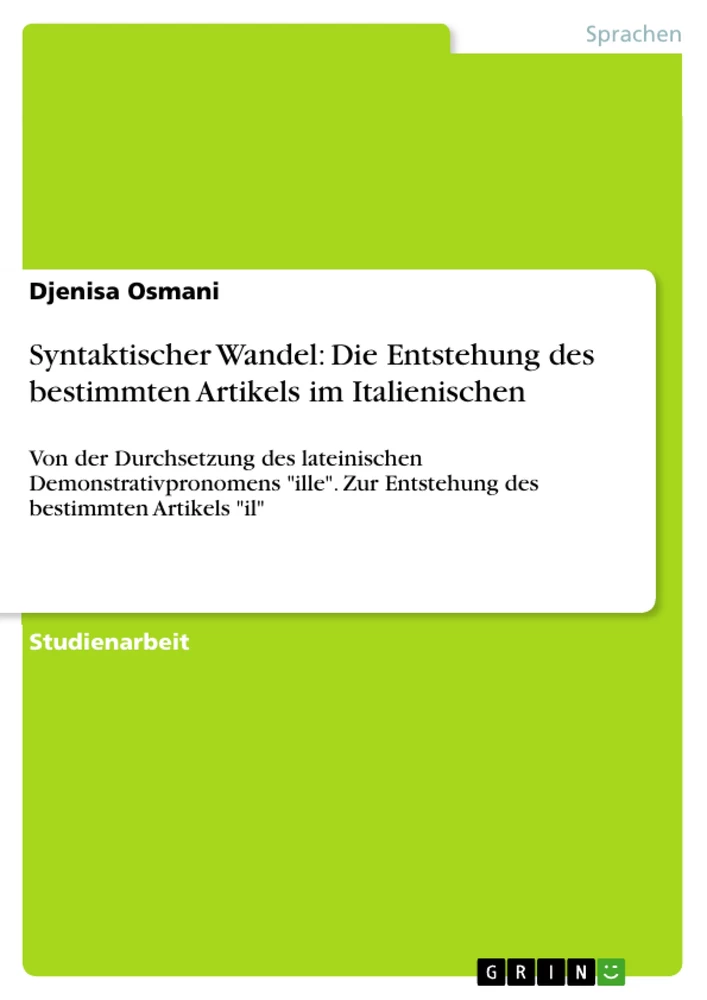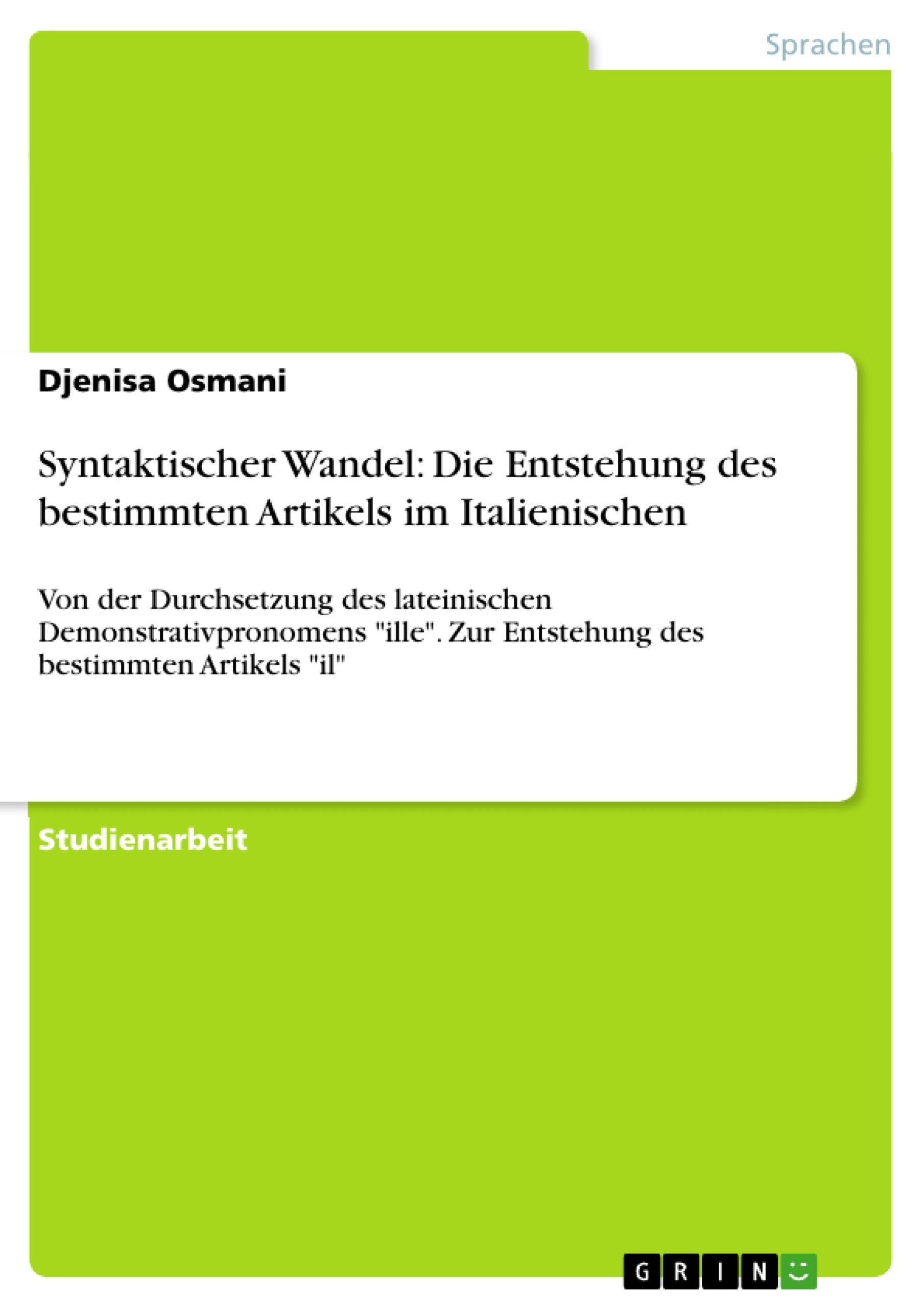Vorerst werden die grundlegenden Begriffe dieses Grammatikalisierungsprozesses definiert und in Verhältnis zueinander gesetzt. Anschließend werden Abgrenzungen in den Kategorien Demonstrativpronomen und Artikel sowie Definitheit und Indefinitheit getroffen. Außerdem wird auf die Phasen des Grammatikalisierungsprozesses der bestimmten Artikel nach Greenberg eingegangen zur Veranschaulichung des Zyklus dieses Phänomens. Der vierte Punkt beschäftigt sich mit den Ursachen und Problematiken der Artikelentstehung. Anschließend wird einzeln auf die Artikelvorläufer aus dem Spätlatein eingegangen. Daraufhin wird die Konkurrenz zwischen ille und ipse näher erläutert und genauer untersucht, wieso sich ille in den meisten romanischen Sprache als Grundlage für die definiten Artikel durchsetzen konnte. Der siebte Punkt beschäftigt sich mit der Artikelentwicklung im Altitalienischen, wobei der Schwerpunkt auf die Grammatikalisierung des bestimmten Artikels im Maskulinum und Singular il gelegt wurde. Der letzte Punkt dieser Arbeit beschäftigt sich mit einer Primärtextanalyse mit der Frage, wie sich das Verhältnis von der Verwendung des Nullartikels und definiten Artikels über die Jahrhunderte geändert hat. Außerdem wird die Frequenz der einzelnen bestimmten maskulinen Artikel im Singular anhand zweier Texte aus zwei verschiedenen Epochen untersucht und miteinander verglichen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grammatikalisierung und Reanalyse
- 2.1 Definitionen und Stufen der Grammatikalisierung
- 2.2 Reanalyse
- 2.3 Bedeutungswandel
- 2.4 Verhältnis zwischen Grammatikalisierung und Reanalyse
- 3. Grundlagen der Grammatikalisierung von bestimmten Artikeln
- 3.1 Abgrenzung von Demonstrativpronomen und bestimmten Artikeln
- 3.2 Abgrenzung von Definitheit und Indefinitheit
- 3.3 Zyklus des Grammatikalisierungsprozesses von bestimmten Artikeln nach Greenberg
- 4. Beobachtungsprobleme und Ursachen der Artikelentstehung
- 5. Die Artikelvorläufer des Spätlateins
- 5.1 Das Identitätspronomen ipse
- 5.2 Das Demonstrativum ille
- 5.3 Das Demonstrativum hic
- 5.4 Das Demonstrativum iste
- 6. Die Durchsetzung des Demonstrativums ille
- 7. Die Grammatikalisierung des bestimmten Artikels il im Altitalienischen
- 8. Primärtextanalyse: Dante Alighieri und Dino Buzzati
- 8.1 Definiter Artikel vs. Nullartikel
- 8.2 Entwicklung der Verwendungsfrequenz von il und lo
- 9. Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung des bestimmten Artikels im Italienischen, ausgehend von der Durchsetzung des lateinischen Demonstrativpronomens ille bis hin zur Entstehung des Artikels il. Die Hauptabsicht ist es, den Grammatikalisierungsprozess dieses linguistischen Wandels zu beleuchten und zu analysieren.
- Grammatikalisierung und Reanalyse als zentrale Prozesse der Artikelentstehung
- Die Rolle von Demonstrativpronomen (ille, ipse, hic, iste) im Spätlatein
- Der Konkurrenz zwischen verschiedenen Demonstrativpronomen und deren Einfluss auf die Entwicklung des bestimmten Artikels
- Die Grammatikalisierung des Artikels il im Altitalienischen
- Eine diachrone Analyse der Verwendung des definiten Artikels im Vergleich zum Nullartikel anhand von Primärtexten.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor: die Entwicklung des bestimmten Artikels in den romanischen Sprachen, speziell im Italienischen. Sie beschreibt den Unterschied zwischen dem Lateinischen, welches keine definiten Artikel kannte, und den modernen romanischen Sprachen. Es wird die Bedeutung der Genus-Kasus-Numerus-Markierung im Lateinischen im Vergleich zu der Entwicklung von Artikelvorläufern im Vulgärlatein herausgestellt. Die Arbeit skizziert den Aufbau und die Methodik der folgenden Kapitel, die sich mit den Definitionen der Grammatikalisierung und Reanalyse, den Artikelvorläufern des Spätlateins, der Durchsetzung von ille und der Grammatikalisierung von il im Altitalienischen befassen, bevor sie mit einer Primärtextanalyse abschließt.
2. Grammatikalisierung und Reanalyse: Dieses Kapitel liefert grundlegende Definitionen und Erläuterungen der Konzepte "Grammatikalisierung" und "Reanalyse". Es werden verschiedene Stufen der Grammatikalisierung nach verschiedenen Linguisten (Meillet, Kuryłowicz, Hopper/Traugott, Givón, Diewald) erläutert und anhand von Beispielen (z.B. die Entwicklung des Verbs "haben" im Deutschen) veranschaulicht. Der Fokus liegt auf dem Verständnis des Prozesses als graduelle und langfristige Veränderung, die nicht auf einen einzelnen Zeitpunkt festgelegt werden kann. Die Beziehung zwischen Grammatikalisierung und Reanalyse wird ebenfalls diskutiert, um den Rahmen für die Analyse der Artikelentstehung zu schaffen.
5. Die Artikelvorläufer des Spätlateins: Das Kapitel analysiert die verschiedenen Artikelvorläufer im Spätlatein: ipse, ille, hic und iste. Es werden die sprachlichen Eigenschaften und die jeweiligen Funktionen dieser Demonstrativpronomen untersucht, die später als Basis für die Entwicklung des bestimmten Artikels dienten. Der Abschnitt legt den Grundstein für das Verständnis der komplexen Entwicklung, indem er die verschiedenen Kandidaten für den Ursprung des Artikels vorstellt und ihre spezifischen Merkmale herausarbeitet, die ihre Eignung als Artikelvorläufer unterschiedlich stark erscheinen lassen.
6. Die Durchsetzung des Demonstrativums ille: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Durchsetzung des Demonstrativpronomens ille als Grundlage des bestimmten Artikels in den meisten romanischen Sprachen. Es untersucht die sprachlichen und soziolinguistischen Faktoren, die zum Erfolg von ille im Vergleich zu anderen Demonstrativpronomen wie ipse führten. Die Analyse beleuchtet den Wettbewerb zwischen den verschiedenen Formen und die Faktoren, welche zur Dominanz von ille beigetragen haben. Es wird die Entwicklung von ille zu einem definiten Artikel in mehreren romanischen Sprachen erörtert.
7. Die Grammatikalisierung des bestimmten Artikels il im Altitalienischen: Das Kapitel konzentriert sich auf die Grammatikalisierung des bestimmten Artikels il (maskulin, Singular) im Altitalienischen. Es analysiert den Prozess der phonologischen und morphologischen Veränderungen, die ille durchlaufen hat, um sich zu dem modernen italienischen bestimmten Artikel zu entwickeln. Die Analyse vertieft sich in die spezifischen Veränderungen des italienischen Artikels und die Unterschiede zu anderen romanischen Sprachen. Dieser Teil beleuchtet die Feinheiten der Entwicklung speziell im Italienischen und zeigt die Besonderheiten des Grammatikalisierungsprozesses in dieser Sprache auf.
Schlüsselwörter
Grammatikalisierung, Reanalyse, bestimmter Artikel, Italienisch, Demonstrativpronomen, ille, ipse, hic, iste, Spätlatein, Altitalienisch, Bedeutungswandel, Primärtextanalyse, Dante Alighieri, Dino Buzzati, Nullartikel, Diachronie.
FAQ: Entstehung des bestimmten Artikels im Italienischen
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entstehung des bestimmten Artikels im Italienischen. Sie verfolgt den Weg vom lateinischen Demonstrativpronomen ille bis zum modernen italienischen Artikel il und beleuchtet den Grammatikalisierungsprozess dieses linguistischen Wandels.
Welche Konzepte werden behandelt?
Zentrale Konzepte sind Grammatikalisierung und Reanalyse. Die Arbeit erklärt diese Prozesse und ihre Bedeutung für die Artikelentstehung. Weitere Themen sind Bedeutungswandel, die Abgrenzung von Demonstrativpronomen und bestimmten Artikeln, sowie die Unterschiede zwischen Definitheit und Indefinitheit.
Welche Artikelvorläufer werden untersucht?
Die Arbeit analysiert die verschiedenen lateinischen Demonstrativpronomen, die als Artikelvorläufer in Frage kommen: ipse, ille, hic und iste. Es wird untersucht, welche sprachlichen Eigenschaften und Funktionen diese Pronomen hatten und wie sie sich im Laufe der Zeit entwickelten.
Welche Rolle spielt das Demonstrativpronomen "ille"?
Das Demonstrativpronomen ille spielt eine entscheidende Rolle. Die Arbeit untersucht dessen Durchsetzung als Grundlage des bestimmten Artikels in den romanischen Sprachen, insbesondere im Italienischen. Es werden die sprachlichen und soziolinguistischen Faktoren analysiert, die zum Erfolg von ille führten.
Wie wird die Grammatikalisierung von "il" im Altitalienischen beschrieben?
Die Arbeit beschreibt die Grammatikalisierung von ille zu il im Altitalienischen detailliert. Sie analysiert die phonologischen und morphologischen Veränderungen und vergleicht die Entwicklung des italienischen Artikels mit der anderer romanischer Sprachen.
Welche Primärtexte werden analysiert?
Die Arbeit beinhaltet eine Primärtextanalyse anhand von Werken von Dante Alighieri und Dino Buzzati. Der Fokus liegt auf dem Vergleich zwischen definitem Artikel und Nullartikel sowie der Entwicklung der Verwendungsfrequenz von il und lo.
Welche Methodik wird verwendet?
Die Arbeit kombiniert diachrone Analyse mit der Untersuchung von Grammatikalisierung und Reanalyse. Die Primärtextanalyse dient zur empirischen Überprüfung der theoretischen Ansätze.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Grammatikalisierung, Reanalyse, bestimmter Artikel, Italienisch, Demonstrativpronomen, ille, ipse, hic, iste, Spätlatein, Altitalienisch, Bedeutungswandel, Primärtextanalyse, Dante Alighieri, Dino Buzzati, Nullartikel, Diachronie.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Einleitung, Grammatikalisierung und Reanalyse, Grundlagen der Grammatikalisierung von bestimmten Artikeln, Beobachtungsprobleme und Ursachen der Artikelentstehung, Die Artikelvorläufer des Spätlateins, Die Durchsetzung des Demonstrativums ille, Die Grammatikalisierung des bestimmten Artikels il im Altitalienischen, Primärtextanalyse: Dante Alighieri und Dino Buzzati und Schlusswort.
Wo finde ich mehr Informationen?
(Hier könnte ein Hinweis auf die vollständige Arbeit eingefügt werden, z.B. eine URL oder bibliographische Angaben)
- Arbeit zitieren
- Djenisa Osmani (Autor:in), 2021, Syntaktischer Wandel: Die Entstehung des bestimmten Artikels im Italienischen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1159944