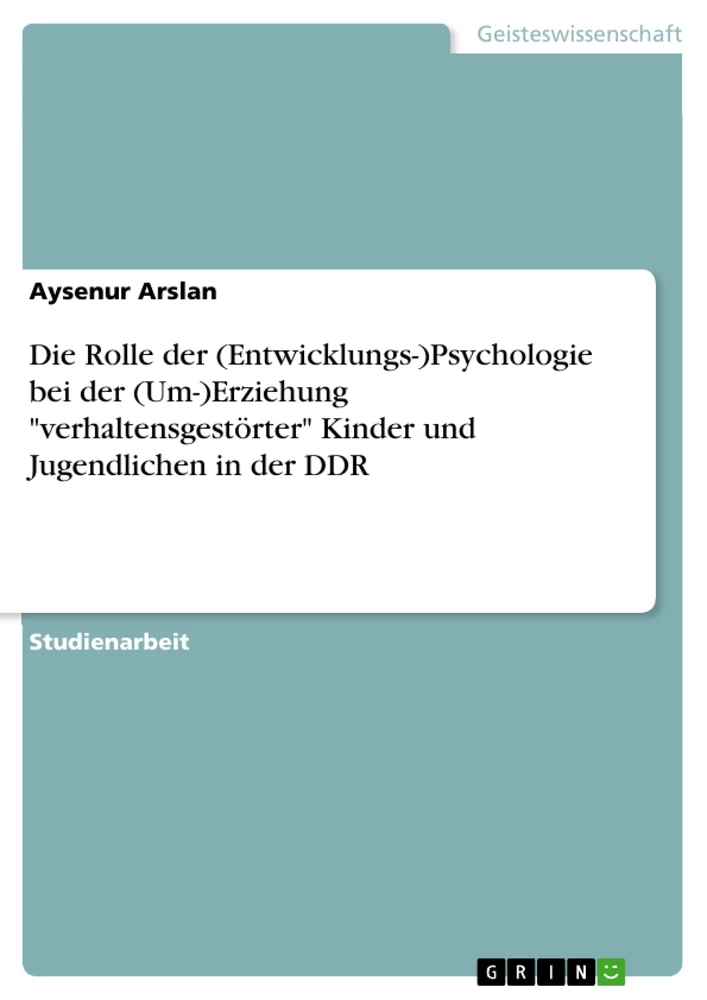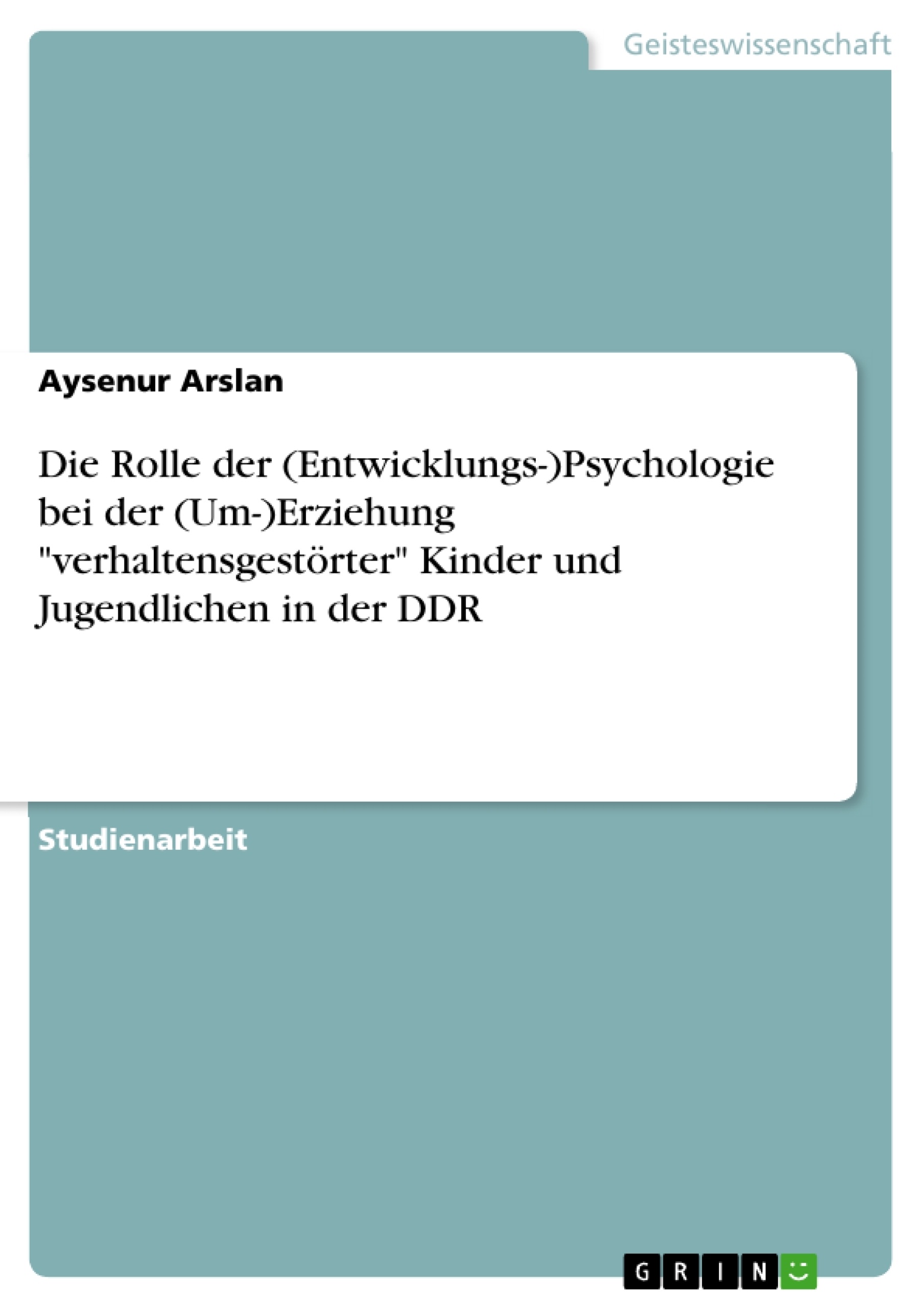In der folgenden schriftlichen Ausarbeitung wird sich mit dem Thema der Heimerziehung in der DDR und der psychologischen Handlungsansätze innerhalb dieser beschäftigt. Schwerpunkt hierbei ist es, folgende Fragen anhand inhaltlicher und historischer Auseinandersetzungen mit dem Themenbereich des DDR-Heimsystems zu beantworten, um somit die damaligen Ansichten mit denen der heutigen zu vergleichen: Wie wurde Psychologie – insbesondere in den Heimen – verstanden und umgesetzt? Gab es in Bezug auf der „zu bekämpfenden“ Verhaltensweisen der Eingewiesenen den (erwünschten) Erfolg oder haben sich die Handlungsweisen des Erziehungssystems negativ auf die Psyche bzw. die Entwicklung ausgewirkt?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsbestimmungen in der DDR
- Abweichendes Verhalten
- Schwererziehbarkeit
- Das Heimsystem der DDR
- Das Spezialheimsystem
- Methoden zur (Um-)Erziehung der Kinder und Jugendlichen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Heimerziehung in der DDR und die psychologischen Ansätze innerhalb dieses Systems. Sie analysiert die damaligen Auffassungen von Psychologie in Heimen und vergleicht sie mit heutigen Perspektiven. Die Arbeit beleuchtet, ob die Maßnahmen zur „Bekämpfung“ abweichenden Verhaltens erfolgreich waren oder negative Auswirkungen hatten.
- Begriffsbestimmungen von „abweichendem Verhalten“ und „Schwererziehbarkeit“ in der DDR
- Das DDR-Heimsystem: Struktur, Ziele und Arten von Heimen
- (Entwicklungs-)psychologische Methoden der (Um-)Erziehung in der DDR
- Die Rolle der Psychologie, therapeutische Ansätze und Strafen in den Heimen
- Vergleich der damaligen und heutigen Ansichten zu Heimerziehung und abweichendem Verhalten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Fokus der Arbeit: die Untersuchung der Heimerziehung in der DDR und der dazugehörigen psychologischen Handlungsansätze. Sie stellt zentrale Forschungsfragen, wie das Verständnis und die Umsetzung von Psychologie in Heimen, sowie die Auswirkungen der Erziehungsmethoden auf die Psyche der Kinder und Jugendlichen. Die Einleitung umreißt den Aufbau der Arbeit, der mit der Definition relevanter Begriffe beginnt, um dann das Heimerziehungssystem und die angewandten Methoden zu beleuchten, bevor schließlich ein Fazit gezogen wird. Der Vergleich der damaligen mit den heutigen Ansichten bildet den roten Faden der Arbeit.
Begriffsbestimmungen in der DDR: Dieses Kapitel definiert die in der DDR verwendeten Begriffe „abweichendes Verhalten“ und „Schwererziehbarkeit“. „Abweichendes Verhalten“, zunächst als Folge des Nationalsozialismus und des Krieges betrachtet, wurde später auch mit hirnorganischen Schäden in Verbindung gebracht. „Schwererziehbarkeit“ beschreibt eine schwerwiegendere Form abweichenden Verhaltens, gekennzeichnet durch Aggressionen, Undiszipliniertheit und kriminelle Handlungen. Beide Begriffe verdeutlichen die ideologisch geprägte Sichtweise der DDR auf Kinder und Jugendliche, deren Verhalten nicht den gesellschaftlichen Normen entsprach. Das Kapitel betont die fehlende einheitliche Definition und die anhaltende Diskussion um die Ursachen abweichenden Verhaltens.
Das Heimsystem der DDR: Dieses Kapitel beschreibt das Heimerziehungssystem der DDR, das als Reaktion auf die Folgen des Zweiten Weltkriegs entstand. Es werden die zwei Hauptarten von Heimen, Normalheime und Spezialheime, erläutert. Die Spezialheime waren für besonders schwer erziehbare Kinder und Jugendliche bestimmt. Das Kapitel betont die weitverbreitete Unterbringung von Kindern in Heimen, selbst bei Funktionärskindern. Das Ziel des Systems war die Übernahme der Erziehungsaufgaben durch den Staat, um eine „sozialistische Persönlichkeit“ zu formen. Die Heime arbeiteten mit strengen Regeln und basierten auf sozialistischer Pädagogik und Kollektiverziehung.
Das Spezialheimsystem: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf das Spezialheimsystem der DDR, das neben Spezialheimen auch Jugendwerkhöfe und Durchgangsheime umfasste. Er beschreibt die Gründe für die Einweisung, die von gesellschaftlich abweichendem Verhalten bis hin zu Fluchtversuchen reichten. Die breite Definition der „Schwereziehbarkeit“ führte zu einer hohen Anzahl an Einweisungen. Um mit den schwierigen Fällen umzugehen, wurde ein autoritärer Erziehungsstil mit strenger Planung und Organisation in homogenen Gruppen eingesetzt. Die hohen Anforderungen führten zu einem Paradigmenwechsel in der SED, weg von der rein ideologischen Erklärung abweichenden Verhaltens hin zur Annahme physisch-psychischer Defekte.
Schlüsselwörter
Heimerziehung, DDR, abweichendes Verhalten, Schwererziehbarkeit, Sozialismus, Kollektiverziehung, Psychologie, (Entwicklungs-)psychologische Methoden, Spezialheime, Normalheime, Jugendhilfe, sozialistische Pädagogik, Makarenko.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Heimerziehung in der DDR
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Heimerziehung in der DDR und die psychologischen Ansätze innerhalb dieses Systems. Sie analysiert die damaligen Auffassungen von Psychologie in Heimen und vergleicht sie mit heutigen Perspektiven. Ein Schwerpunkt liegt auf der Erfolgsmessung der Maßnahmen zur „Bekämpfung“ abweichenden Verhaltens und deren Auswirkungen.
Welche Begriffe werden in der Arbeit definiert?
Die Arbeit definiert die in der DDR verwendeten Begriffe „abweichendes Verhalten“ und „Schwererziehbarkeit“. „Abweichendes Verhalten“ wurde in der DDR vielschichtig interpretiert, u.a. in Verbindung mit den Folgen des Nationalsozialismus, des Krieges und hirnorganischen Schäden. „Schwererziehbarkeit“ bezeichnete eine schwerwiegendere Form, gekennzeichnet durch Aggressionen, Undiszipliniertheit und kriminelle Handlungen. Die fehlende einheitliche Definition und die Diskussion um die Ursachen werden hervorgehoben.
Wie war das Heimsystem der DDR strukturiert?
Das DDR-Heimsystem umfasste Normalheime und Spezialheime. Spezialheime waren für besonders schwer erziehbare Kinder und Jugendliche bestimmt. Die Unterbringung von Kindern in Heimen war weit verbreitet, selbst bei Funktionärskindern. Ziel war die Übernahme der Erziehungsaufgaben durch den Staat zur Formung einer „sozialistischen Persönlichkeit“. Die Heime arbeiteten mit strengen Regeln und basierten auf sozialistischer Pädagogik und Kollektiverziehung.
Was ist über das Spezialheimsystem bekannt?
Das Spezialheimsystem umfasste neben Spezialheimen auch Jugendwerkhöfe und Durchgangsheime. Einweisungskriterien reichten von gesellschaftlich abweichendem Verhalten bis hin zu Fluchtversuchen. Die breite Definition der „Schwereziehbarkeit“ führte zu vielen Einweisungen. Es wurde ein autoritärer Erziehungsstil mit strenger Planung und Organisation in homogenen Gruppen eingesetzt. Die hohen Anforderungen führten in der SED zu einem Paradigmenwechsel weg von rein ideologischen Erklärungen hin zur Annahme physisch-psychischer Defekte.
Welche Methoden der (Um-)Erziehung wurden angewendet?
Die Arbeit beleuchtet die (Entwicklungs-)psychologischen Methoden der (Um-)Erziehung in der DDR, die Rolle der Psychologie, therapeutische Ansätze und Strafen in den Heimen. Ein Vergleich der damaligen und heutigen Ansichten zu Heimerziehung und abweichendem Verhalten wird durchgeführt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Heimerziehung, DDR, abweichendes Verhalten, Schwererziehbarkeit, Sozialismus, Kollektiverziehung, Psychologie, (Entwicklungs-)psychologische Methoden, Spezialheime, Normalheime, Jugendhilfe, sozialistische Pädagogik, Makarenko.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu Begriffsbestimmungen in der DDR (inkl. „Abweichendes Verhalten“ und „Schwererziehbarkeit“), das DDR-Heimsystem (inkl. Spezialheimsystem), die Methoden zur (Um-)Erziehung und ein Fazit. Die Einleitung beschreibt den Fokus der Arbeit, die Forschungsfragen und den Aufbau. Jedes Kapitel fasst die wesentlichen Inhalte zusammen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Heimerziehung in der DDR und deren psychologische Ansätze. Sie analysiert die damaligen Auffassungen von Psychologie in Heimen im Vergleich zu heutigen Perspektiven und beleuchtet die Auswirkungen der Erziehungsmethoden auf die Psyche der Kinder und Jugendlichen.
- Quote paper
- Aysenur Arslan (Author), 2021, Die Rolle der (Entwicklungs-)Psychologie bei der (Um-)Erziehung "verhaltensgestörter" Kinder und Jugendlichen in der DDR, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1159976