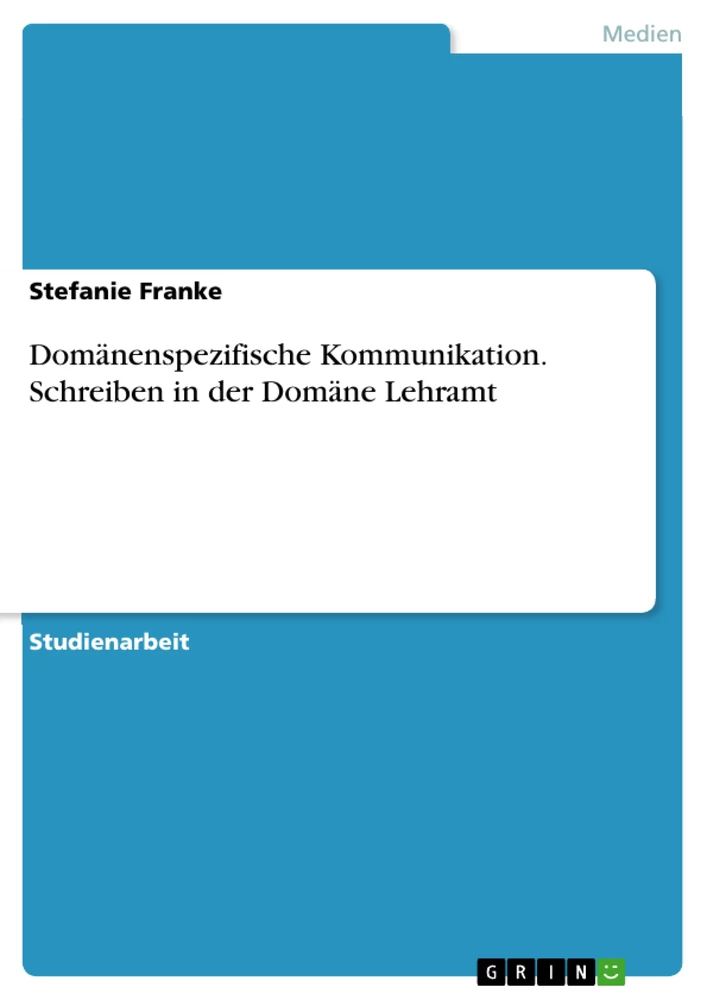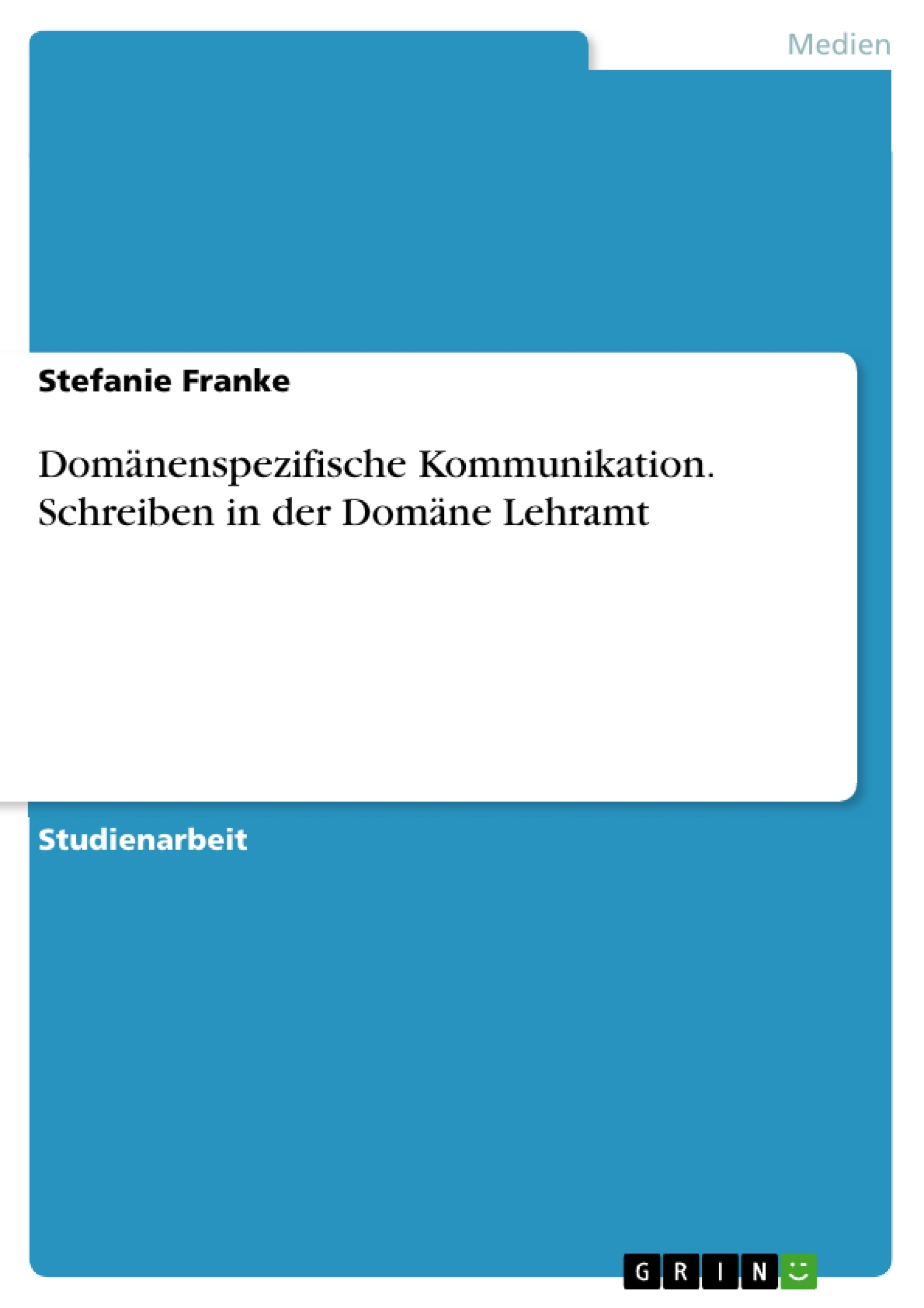Das Schreiben am Arbeitsplatz wurde vor allem in den letzten Jahren zunehmend untersucht. Dennoch blieben bisher einige Bereiche unbeachtet, unter anderem die Domäne Lehramt. Dieses Defizit motivierte mich, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Das Schreiben am Arbeitsplatz innerhalb der Domäne Lehramt wird anhand zweier Transkripte unter der folgenden Fragestellung untersucht:
Worin liegen die Unterschiede zwischen Schreiben im Studium und Schreiben im Beruf innerhalb der Domäne Lehramt und wodurch sind diese bedingt?
Die Analyse findet auf Grundlage des von Philipp Mayring herausgegebenen Werkes „Qualitative Inhaltsanalyse“ (Mayring 1983) statt, woraus insbesondere das Kapitel zur Strukturierung hinzugezogen wird.
Die Transkripte beruhen auf einem von der Projektgruppe „Lehramt“ im Rahmen der Veranstaltung „Domänenspezifische Kommunikation“ entwickelten Fragebogen. Die Gruppe bestand aus fünf Studentinnen, die jeweils zwei Interviews mit Lehrern, Lehramtsstudenten oder Referendaren führten. Die Tonaufzeichnungen wurden anschließend auf Grundlage des GAT transkribiert (vgl. Selting 1998) und im Seminar kurz präsentiert. Die in dieser Arbeit verwendeten Interviews sollen im Folgenden als Transkript FrLe1 für das Transkript der Lehrerin und FrSt2 für das Transkript der Studentin genannt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hintergrundinformationen
- Vorgehensweise
- Stand der Forschung
- Methoden
- Analyse
- Textsorten
- Kooperatives Schreiben und Reviewprozesse
- Adressaten
- Quellen für die Schreibprozesse
- Vorbereitung auf die im Arbeitsalltag zu bewältigenden Schreibaufgaben
- Anwendung
- Inklusionsmodell
- Vergleich mit Lehnen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Unterschiede zwischen dem Schreiben im Studium und im Beruf innerhalb der Domäne Lehramt. Die Hauptfragestellung lautet: Worin liegen die Unterschiede zwischen Schreiben im Studium und Schreiben im Beruf innerhalb der Domäne Lehramt und wodurch sind diese bedingt? Die Analyse basiert auf zwei Transkripten von Interviews mit einer Lehrerin und einer Lehramtsstudentin.
- Schreiben im Kontext des Lehramts
- Vergleich von Schreibpraktiken im Studium und Beruf
- Anwendung des Inklusionsmodells von Prof. Jakobs
- Vergleich mit den Ergebnissen von Prof. Lehnen
- Vorbereitung von Lehramtsstudenten auf berufsspezifische Schreibaufgaben
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Schreiben im Berufsfeld Lehramt ein und begründet die Relevanz der Untersuchung aufgrund bisheriger Forschungslücken in diesem Bereich. Die Forschungsfrage wird formuliert, die methodische Vorgehensweise skizziert und die verwendeten Transkripte kurz vorgestellt. Es wird auf die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring verwiesen, die als methodische Grundlage dient. Die Interviews wurden mit einer Lehrerin und einer Lehramtsstudentin geführt, um unterschiedliche Perspektiven zu gewinnen.
Stand der Forschung: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über den bisherigen Forschungsstand zum Thema „Writing at Work“, insbesondere die Arbeiten von Prof. Dr. Eva-Maria Jakobs und deren Inklusionsmodell. Es wird auf die Arbeit von Prof. Dr. Katrin Lehnen zum Schreiben im Lehrerberuf und die Studie von Kirsten Schindler zum fachunabhängigen Schreiben von Studierenden im Berufsleben eingegangen. Der methodische Beitrag von Philipp Mayring zur qualitativen Inhaltsanalyse wird ebenfalls hervorgehoben, ebenso wie die Erweiterung dieses Ansatzes durch Gläser und Laudel bezüglich der Transkriptanalyse.
Methoden: Das Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise der Analyse. Die beiden Transkripte werden zunächst verglichen, um geeignete Kategorien für die Analyse zu identifizieren. Es werden induktive Kategoriendefinitionen nach Mayring verwendet, die sich an den Fragestellungen des Interviewleitfadens orientieren. Die relevanten Textstellen werden extrahiert und strukturiert, um die wesentlichen Informationen herauszuarbeiten.
Analyse: Die Analyse untersucht die Transkripte anhand der zuvor festgelegten Kategorien. Die einzelnen Unterkapitel (Textsorten, kooperatives Schreiben, Adressaten, Quellen, Vorbereitung auf Schreibaufgaben im Arbeitsalltag) befassen sich jeweils mit einem spezifischen Aspekt des Schreibens im Lehramt, wobei Textbeispiele aus den Transkripten zur Illustration verwendet werden.
Anwendung: In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Analyse in das Inklusionsmodell von Prof. Jakobs eingeordnet und mit den Ergebnissen der Studie von Prof. Lehnen verglichen. Die Einordnung in das Inklusionsmodell dient der Einbettung der Ergebnisse in einen breiteren theoretischen Rahmen. Der Vergleich mit Lehnen dient dazu, die eigenen Ergebnisse im Kontext der bestehenden Forschung zu verorten und zu diskutieren.
Schlüsselwörter
Schreiben im Lehramt, qualitative Inhaltsanalyse, Inklusionsmodell, Berufspraktiken, Studium-Beruf-Vergleich, Domänenspezifische Kommunikation, Textlinguistik, Prof. Jakobs, Prof. Lehnen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Schreiben im Lehramt - Unterschiede zwischen Studium und Beruf
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Unterschiede zwischen dem Schreiben im Studium und im Beruf im Kontext des Lehramts. Die zentrale Forschungsfrage lautet: Worin liegen die Unterschiede zwischen Schreiben im Studium und Schreiben im Beruf innerhalb der Domäne Lehramt und wodurch sind diese bedingt?
Welche Methoden wurden verwendet?
Die Analyse basiert auf zwei Interviews (Transkripten) mit einer Lehrerin und einer Lehramtsstudentin. Als methodische Grundlage dient die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring. Die Analyse verwendet induktive Kategoriendefinitionen, die sich an den Fragestellungen des Interviewleitfadens orientieren. Die relevanten Textstellen wurden extrahiert und strukturiert.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Schreiben im Kontext des Lehramts, Vergleich von Schreibpraktiken im Studium und Beruf, Anwendung des Inklusionsmodells von Prof. Jakobs, Vergleich mit den Ergebnissen von Prof. Lehnen und die Vorbereitung von Lehramtsstudenten auf berufsspezifische Schreibaufgaben. Die Analyse betrachtet Aspekte wie Textsorten, kooperatives Schreiben, Adressaten, Quellen und die Vorbereitung auf Schreibaufgaben im Arbeitsalltag.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf das Inklusionsmodell von Prof. Dr. Eva-Maria Jakobs und die Arbeiten von Prof. Dr. Katrin Lehnen zum Schreiben im Lehrerberuf. Der methodische Beitrag von Philipp Mayring zur qualitativen Inhaltsanalyse und dessen Erweiterung durch Gläser und Laudel bezüglich der Transkriptanalyse werden ebenfalls berücksichtigt.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Überblick über den Stand der Forschung, ein Kapitel zu den Methoden, die Analyse selbst, ein Kapitel zur Anwendung der Ergebnisse (inkl. Einordnung ins Inklusionsmodell und Vergleich mit Lehnen) und ein Fazit. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel sind ebenfalls enthalten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Schreiben im Lehramt, qualitative Inhaltsanalyse, Inklusionsmodell, Berufspraktiken, Studium-Beruf-Vergleich, Domänenspezifische Kommunikation, Textlinguistik, Prof. Jakobs, Prof. Lehnen.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse der Analyse werden im Kapitel "Analyse" detailliert dargestellt und anhand von Textbeispielen aus den Transkripten illustriert. Im Kapitel "Anwendung" werden die Ergebnisse im Kontext des Inklusionsmodells von Prof. Jakobs eingeordnet und mit den Ergebnissen von Prof. Lehnen verglichen.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Lehramtsstudierende, Lehrende im Bereich Schreibdidaktik und Wissenschaftler*innen, die sich mit dem Thema Schreiben im Berufsfeld und dem Übergang vom Studium in den Beruf befassen.
- Arbeit zitieren
- Stefanie Franke (Autor:in), 2008, Domänenspezifische Kommunikation. Schreiben in der Domäne Lehramt, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/116014