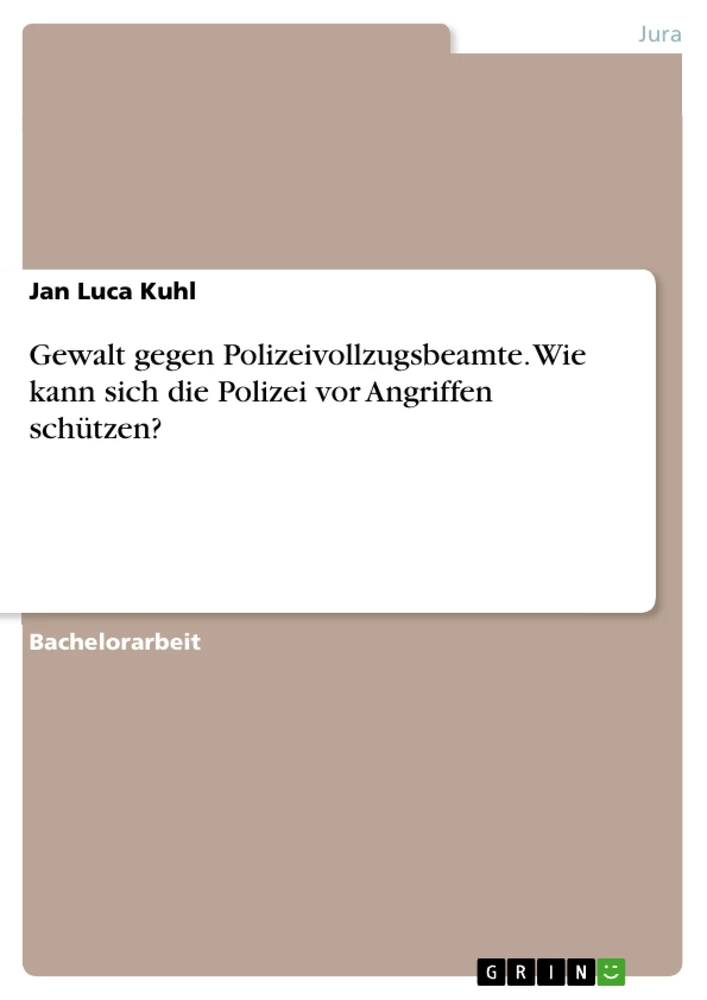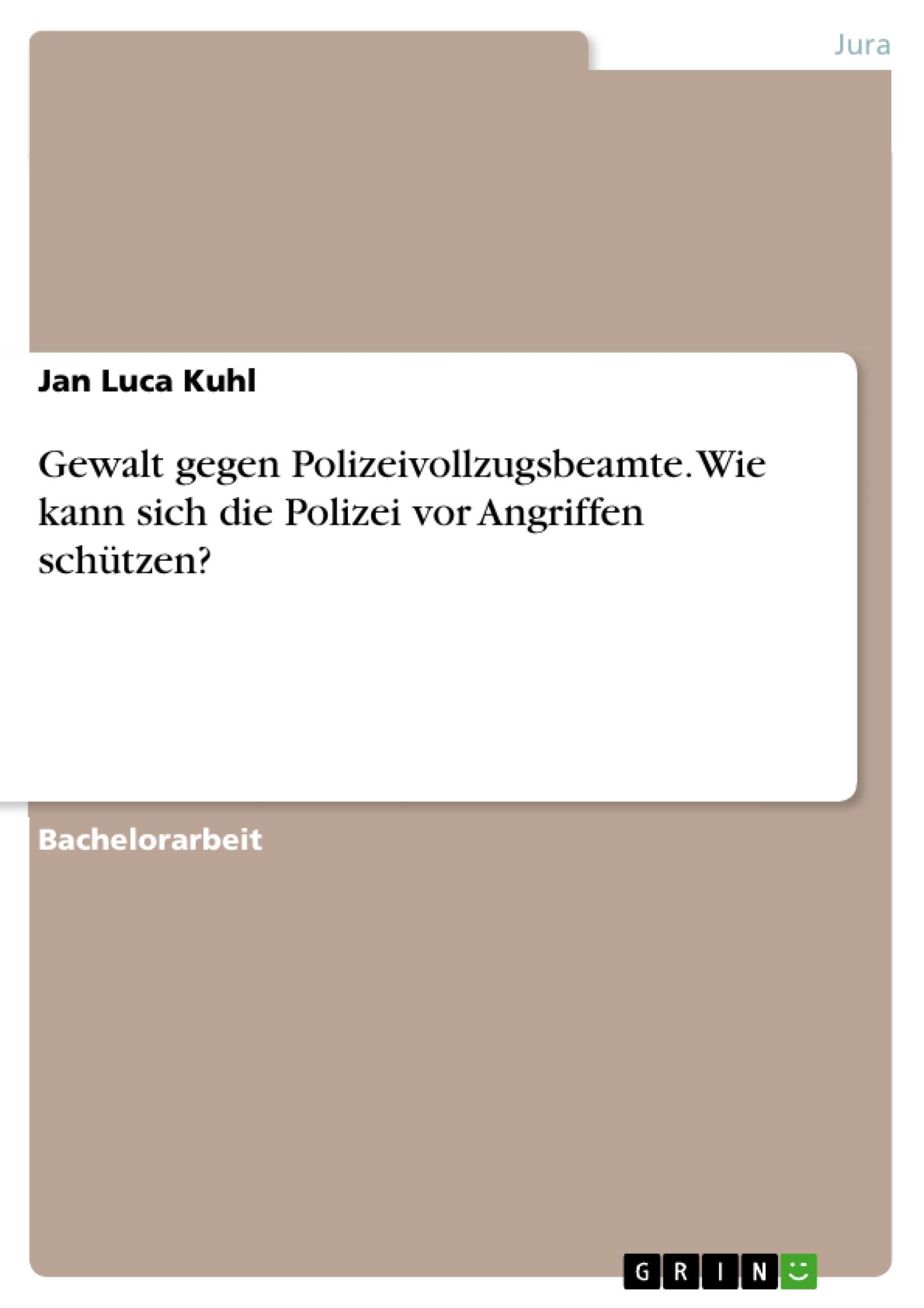Wie kann es sein, dass ein Polizist bei einem alltäglichen Einsatz schwer verletzt wird? Und wie können Situationen derart eskalieren, dass sich Polizisten plötzlich gegen mehrere hundert Personen verteidigen müssen? Ist die Polizei solchen Situationen gewachsen?
Um dies zu beurteilen, werden in dieser Arbeit mögliche Schutzmaßnahmen der Polizei aufgezeigt. Insbesondere die Bodycam und das Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) werden dafür als neuere Technologien bei der Polizei NRW erläutert und bewertet. In diesem Zusammenhang werden zudem die Aus- und Fortbildung eine wichtige Rolle spielen. Zunächst ist es jedoch notwendig, die rechtlichen Grundlagen und das Vorkommen der Gewalttaten zu klären. Auch die Frage nach den potenziellen Tätern und der dahinterstehenden Motivation muss geklärt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Was ist Gewalt?
- 3 Rechtliche Normen
- 3.1 Der Widerstand (§113 StGB)
- 3.2 Der tätliche Angriff (§114 StGB)
- 4 Gewalttaten gegen Polizeivollzugsbeamte
- 4.1 Aufgetretene Fälle
- 4.2 Tätertypologie
- 4.3 Ursachen der Gewalttaten
- 5 Schutzmaßnahme: Die Bodycam
- 5.1 Aktuelle Verbreitung der Bodycam
- 5.2 Rechtliche Grundlagen für den Einsatz der Bodycam
- 5.3 Wirkung der Bodycam
- 5.4 Problematik und Kritik der Bodycam
- 6 Schutzmaßnahme: Das Distanzelektroimpulsgerät
- 6.1 Aktuelle Verbreitung des DEIG
- 6.2 Rechtliche Grundlagen für den Einsatz des DEIG
- 6.3 Wirkung des DEIG
- 7 Zusammenfassung der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Gewalt gegen Polizeivollzugsbeamte in Nordrhein-Westfalen und analysiert mögliche Schutzmaßnahmen. Das Hauptziel ist die Bewertung der Effektivität von Bodycams und Distanzelektroimpulsgeräten (DEIG) als präventive Maßnahmen. Die Arbeit beleuchtet auch die rechtlichen Grundlagen des Einsatzes dieser Technologien.
- Gewalt gegen Polizeivollzugsbeamte: Häufigkeit, Kontext und Auswirkungen
- Rechtliche Rahmenbedingungen für den Einsatz von Gewalt durch und gegen Polizeibeamte
- Bewertung der Bodycam als Schutzmaßnahme
- Bewertung des DEIG als Schutzmaßnahme
- Analyse von Ursachen und Täterprofilen bei Gewalttaten gegen Polizeibeamte
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung präsentiert aktuelle Fallbeispiele von Gewalt gegen Polizeibeamte, um die Relevanz des Themas zu verdeutlichen und die Forschungsfrage nach effektiven Schutzmaßnahmen zu formulieren. Die Arbeit fokussiert sich auf die Analyse von Bodycams und DEIGs in diesem Kontext, wobei die rechtlichen Grundlagen und die Täterprofile eine wichtige Rolle spielen.
2 Was ist Gewalt?: Dieses Kapitel beleuchtet die komplexe Definition von Gewalt, unterscheidet zwischen strafrechtlicher und gesellschaftlicher Definition und begründet die Fokussierung dieser Arbeit auf physische Gewalt im Kontext von Angriffen gegen Polizeibeamte. Die Schwierigkeit, eine eindeutige Definition zu finden, wird hervorgehoben, wobei die Arbeit eine pragmatische Definition für den vorliegenden Kontext wählt.
3 Rechtliche Normen: Hier werden die wichtigsten strafrechtlichen Normen, insbesondere §113 und §114 StGB (Widerstand und tätlicher Angriff gegen Vollstreckungsbeamte), detailliert dargestellt. Der Fokus liegt auf der Relevanz dieser Paragraphen für die statistische Erfassung von Gewalttaten gegen Polizeibeamte im Vergleich zu anderen Gewaltdelikten. Die subjektive Wahrnehmung von Gewalt durch Polizeibeamte wird im Kontext der objektiven rechtlichen Definition diskutiert.
4 Gewalttaten gegen Polizeivollzugsbeamte: Dieses Kapitel präsentiert eine Analyse von Gewalttaten gegen Polizeibeamte. Es umfasst die Darstellung von Fallbeispielen, die Untersuchung von Täterprofilen und eine Auseinandersetzung mit den Ursachen dieser Gewalttaten. Es liefert somit die empirische Basis für die Bewertung der im Folgenden diskutierten Schutzmaßnahmen.
5 Schutzmaßnahme: Die Bodycam: Das Kapitel befasst sich umfassend mit Bodycams als Schutzmaßnahme für Polizeibeamte. Es analysiert deren aktuelle Verbreitung, die rechtlichen Grundlagen für ihren Einsatz, die potentielle Wirkung als Abschreckungsmittel und präventive Maßnahme, und diskutiert kritische Punkte und potenzielle Problemfelder in Zusammenhang mit Datenschutz und Akzeptanz.
6 Schutzmaßnahme: Das Distanzelektroimpulsgerät: Analog zu Kapitel 5 wird hier das DEIG als Schutzmaßnahme für Polizeibeamte detailliert untersucht. Es werden die Verbreitung, die rechtlichen Grundlagen, die Wirkung und die Problematik des Einsatzes dieser Technologie analysiert. Die Kapitel 5 und 6 stellen jeweils eine umfassende Bewertung der jeweiligen Technologie dar und ziehen Vergleiche.
Schlüsselwörter
Gewalt gegen Polizeivollzugsbeamte, Bodycam, Distanzelektroimpulsgerät (DEIG), §113 StGB, §114 StGB, Schutzmaßnahmen, Prävention, Rechtliche Grundlagen, Tätertypologie, Polizeiausbildung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studie: Gewalt gegen Polizeivollzugsbeamte
Was ist der Gegenstand dieser Studie?
Die Studie untersucht Gewalt gegen Polizeivollzugsbeamte in Nordrhein-Westfalen und analysiert die Effektivität von Bodycams und Distanzelektroimpulsgeräten (DEIGs) als präventive Maßnahmen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den rechtlichen Grundlagen des Einsatzes dieser Technologien und der Analyse von Ursachen und Täterprofilen.
Welche Themen werden in der Studie behandelt?
Die Studie umfasst folgende Themen: Häufigkeit, Kontext und Auswirkungen von Gewalt gegen Polizeibeamte; rechtliche Rahmenbedingungen für den Einsatz von Gewalt durch und gegen Polizeibeamte; Bewertung von Bodycams und DEIGs als Schutzmaßnahmen; Analyse von Ursachen und Täterprofilen; die rechtlichen Grundlagen (§113 und §114 StGB) im Kontext von Widerstand und tätlichen Angriffen gegen Vollstreckungsbeamte.
Welche Schutzmaßnahmen werden untersucht?
Die Studie konzentriert sich auf zwei Schutzmaßnahmen: Bodycams und Distanzelektroimpulsgeräte (DEIGs). Für beide werden die aktuelle Verbreitung, die rechtlichen Grundlagen des Einsatzes, die Wirkung (Abschreckung, Prävention) und mögliche Problemfelder (Datenschutz, Akzeptanz) detailliert analysiert und verglichen.
Welche rechtlichen Grundlagen werden betrachtet?
Die Studie behandelt insbesondere die Paragraphen §113 und §114 StGB (Widerstand und tätlicher Angriff gegen Vollstreckungsbeamte). Die Relevanz dieser Paragraphen für die statistische Erfassung von Gewalttaten gegen Polizeibeamte und die subjektive Wahrnehmung von Gewalt im Kontext der objektiven rechtlichen Definition werden diskutiert.
Wie ist die Studie aufgebaut?
Die Studie ist in mehrere Kapitel gegliedert: Einleitung, Definition von Gewalt, rechtliche Normen (§113 und §114 StGB), Gewalttaten gegen Polizeibeamte (Fallbeispiele, Täterprofile, Ursachen), Bewertung von Bodycams als Schutzmaßnahme, Bewertung von DEIGs als Schutzmaßnahme und eine Zusammenfassung der Ergebnisse. Ein Inhaltsverzeichnis bietet einen detaillierten Überblick.
Welche Ergebnisse liefert die Studie?
Die Studie liefert eine umfassende Analyse der Gewalt gegen Polizeibeamte, bewertet die Effektivität von Bodycams und DEIGs als präventive Maßnahmen und beleuchtet die damit verbundenen rechtlichen und ethischen Aspekte. Die Zusammenfassung der Ergebnisse fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen.
Wer sind die Zielgruppen dieser Studie?
Die Studie richtet sich an ein akademisches Publikum, insbesondere an Wissenschaftler, Studenten und Praktiker im Bereich der Kriminalistik, Polizeiarbeit und Rechtswissenschaft. Sie ist für alle relevant, die sich mit dem Thema Gewalt gegen Polizeibeamte und präventiven Maßnahmen auseinandersetzen.
Wo finde ich Schlüsselwörter zur Studie?
Schlüsselwörter zur Studie umfassen: Gewalt gegen Polizeivollzugsbeamte, Bodycam, Distanzelektroimpulsgerät (DEIG), §113 StGB, §114 StGB, Schutzmaßnahmen, Prävention, Rechtliche Grundlagen, Tätertypologie, Polizeiausbildung.
- Quote paper
- Jan Luca Kuhl (Author), 2021, Gewalt gegen Polizeivollzugsbeamte. Wie kann sich die Polizei vor Angriffen schützen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1160290