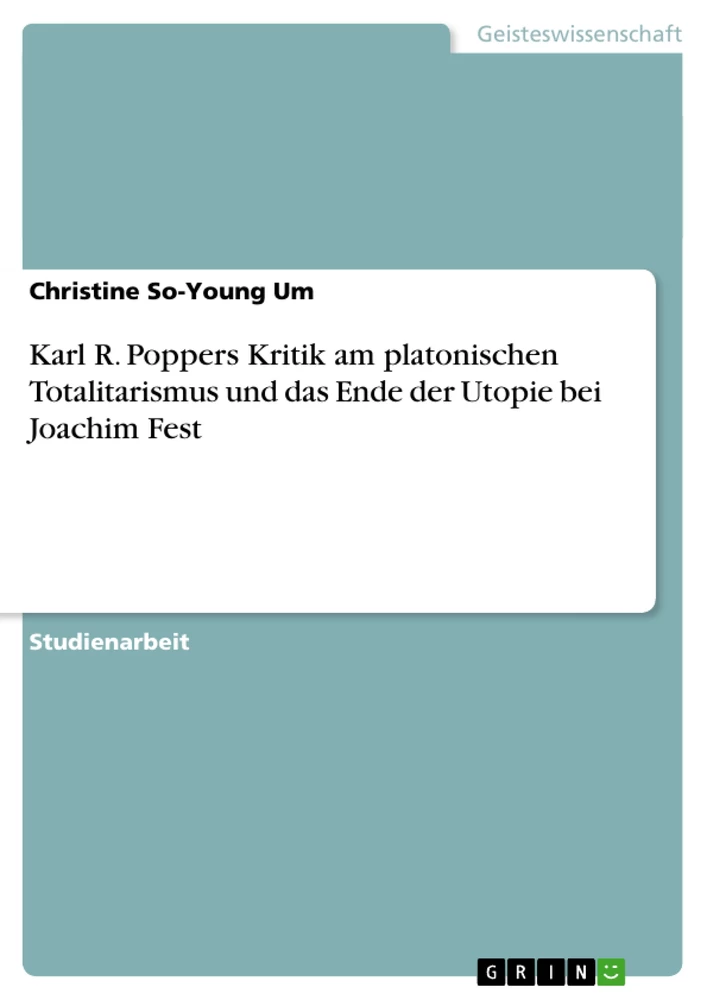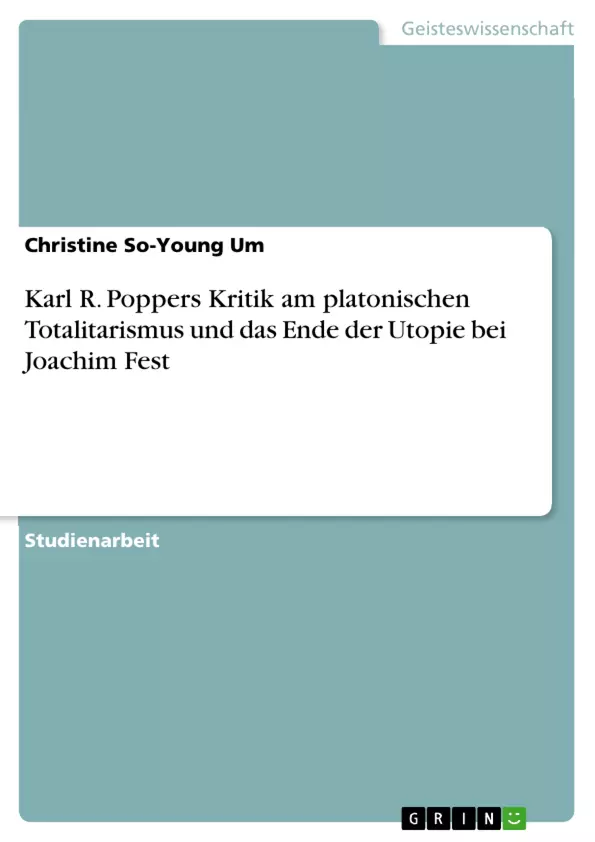Karl Poppers „die offene Gesellschaft und ihre Feinde“ war bereits zu seinen Lebezeiten ein Klassiker und gilt heute als politisch-philosophisches Standardwerk. Sein Entschluss, dieses Buch zu schreiben, fiel am 13. März 1938: dem Tag, an dem Hitlers Truppen in Poppers Heimatland Österreich einmarschierten. Popper befand sich damals in Neuseeland, wo er eine Dozentur angenommen hatte. Er selbst sagte über das Entstehen der „offenen Gesellschaft“, dass er einen Beitrag zum Krieg leisten wollte, die Freiheit verteidigen und außerdem „eine Verteidigung gegen totalitäre und autoritäre Ideen und als eine Warnung vor den Gefahren des historizistischen
Aberglaubens“ schaffen wollte.
Popper beendete die erste Niederschrift 1942, welche zunächst von
verschiedenen Verlagen abgelehnt wurde, dann aber in London während Hitlers Angriff durch seine so genannten „Vergeltungswaffen“ in Druck ging. Die erste Auflage erschien 1945, als der Krieg in Europa sein Ende fand. Popper begibt sich in diesem Werk auf eine Art „Spurensuche“ in der Geschichte: von Hitler zurück zu Platon, den er als ersten großen politischen Ideologen (Klassen- und Rassendenken) ansieht; von Stalin zurück zu Karl Marx (Kritik an Marx auch als Eigenkritik, da Popper in seiner Jugend selbst Marxist gewesen war). Die Tendenz seines Buches ist klar gefasst: gegen Hitler (anti-Nazismus) und gegen Stalin .
Der erste Band, „der Zauber Platons“, beinhaltet Poppers Kritik an Platon, besonders an der platonischen Staatsphilosophie und der Theorie der Formen und Ideen, kurz genannt die Ideenlehre. Er weist ausdrücklich darauf hin, dass er nicht die gesamte platonische Philosophie behandelt, sondern lediglich Platons Historizismus und seinen „besten Staat“. Popper ist der Ansicht, dass der
Historizismus nicht nur unzulänglich, sondern sogar schädlich sei. Es ist vornehmlich die totalitäre Tendenz in Platons politischer Philosophie, die Popper kritisiert. Es enthält die wichtigsten Aspekte der Popperschen Utopiekritik und seiner Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Typen des politischen Totalitarismus. Er untersucht die gegensätzlichen Richtungen der „offenen Gesellschaft“, die er mit der abendländischen Demokratie definiert und der „geschlossenen Gesellschaft“, die er wegen ihres Kollektivismus und der staatlichen Alleinherrschaft ablehnt. Für Popper führt eine Art „roter Faden“ von Platon zu Hitler und Stalin. Für Popper steht Platon in einem feindlichen Gegensatz zur offenen Gesellschaft der Demokratie.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Karl Popper: die offene Gesellschaft und ihre Feinde, Band 1 der Zauber Platons
- Entstehungsgeschichte und Bedeutung
- Platons Lehre
- Platons Zeitalter und Ursprünge seiner Philosophie
- Platons politisches Ziel und seine Ideenlehre
- Platonische Soziologie und die Demokratie bei Platon
- Utopisches Programm oder Vergangenheit?
- Platons „bester Staat“ und seine Ansichten über die herrschende Klasse
- Poppers Kritik an Platons Totalitarismus
- Der Totalitarismus in Platons politischem Programm
- Die totalitäre Gerechtigkeit
- Die Gefahr des platonischen Utopismus
- Offene und geschlossene Gesellschaft
- Der Zauber Platons
- Vom Ende der Utopie bei Joachim Fest
- Joachim Fest und die Utopien
- Entwicklungsgeschichte der Utopien
- Utopie des Nationalsozialismus und des Sozialismus
- Scheitern der Utopien
- Das Ende der Utopien
- Literaturangaben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Kritik von Karl R. Popper am platonischen Totalitarismus und untersucht, wie Joachim Fest das Ende der Utopie beschreibt. Der Fokus liegt auf der Analyse der politischen Philosophie Platons, Poppers Kritik an der „geschlossenen Gesellschaft“ und Fests Betrachtung der Entwicklung und des Scheiterns von Utopien.
- Platons politische Philosophie und die Idee des „besten Staates“
- Poppers Kritik am Historizismus und der totalitären Tendenz in Platons Philosophie
- Die Unterscheidung zwischen offener und geschlossener Gesellschaft
- Die Entwicklung und das Scheitern von Utopien im historischen Kontext
- Fests Analyse der Utopien des Nationalsozialismus und des Sozialismus
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Entstehungsgeschichte und Bedeutung von Karl Poppers „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“, insbesondere des ersten Bandes „Der Zauber Platons“. Es werden die zentralen Aspekte von Platons politischer Philosophie und Ideenlehre beleuchtet.
Im zweiten Kapitel wird Poppers Kritik am platonischen Totalitarismus im Detail analysiert. Dabei werden die totalitäre Tendenz in Platons politischem Programm, die Vorstellung von totalitärer Gerechtigkeit und die Gefahr des platonischen Utopismus beleuchtet. Das Kapitel schließt mit Poppers Unterscheidung zwischen offener und geschlossener Gesellschaft.
Das dritte Kapitel befasst sich mit Joachim Fests Analyse des Endes der Utopie. Es werden die Entwicklung der Utopien, die Utopien des Nationalsozialismus und des Sozialismus sowie die Gründe für das Scheitern von Utopien behandelt.
Schlüsselwörter
Platon, Totalitarismus, offene Gesellschaft, geschlossene Gesellschaft, Historizismus, Utopie, Nationalsozialismus, Sozialismus, Joachim Fest, Karl Popper, politischer Idealismus, Demokratie, Staatsphilosophie.
Häufig gestellte Fragen
Was kritisiert Karl Popper an Platons Staatsphilosophie?
Popper sieht in Platon den ersten großen Ideologen des Totalitarismus, der durch sein Klassen- und Rassendenken die „geschlossene Gesellschaft“ befürwortete.
Was ist der Unterschied zwischen einer offenen und einer geschlossenen Gesellschaft?
Die offene Gesellschaft ist durch Demokratie, Individualismus und Freiheit geprägt, während die geschlossene Gesellschaft auf Kollektivismus und staatlicher Alleinherrschaft basiert.
Welche Rolle spielt der Historizismus in Poppers Kritik?
Popper lehnt den Historizismus ab, da dieser vorgibt, historische Gesetze zu kennen, was oft als Rechtfertigung für totalitäre Herrschaft und die Unterdrückung der Freiheit dient.
Was beschreibt Joachim Fest mit dem „Ende der Utopie“?
Fest analysiert das Scheitern großer politischer Utopien wie des Nationalsozialismus und des Sozialismus und beschreibt die Ernüchterung nach deren Zusammenbruch.
Wann verfasste Popper sein Werk „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“?
Popper schrieb das Buch im Exil in Neuseeland ab 1938 als Reaktion auf den Einmarsch Hitlers in Österreich; es erschien erstmals 1945.
- Quote paper
- M.A. Christine So-Young Um (Author), 2004, Karl R. Poppers Kritik am platonischen Totalitarismus und das Ende der Utopie bei Joachim Fest, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/116044