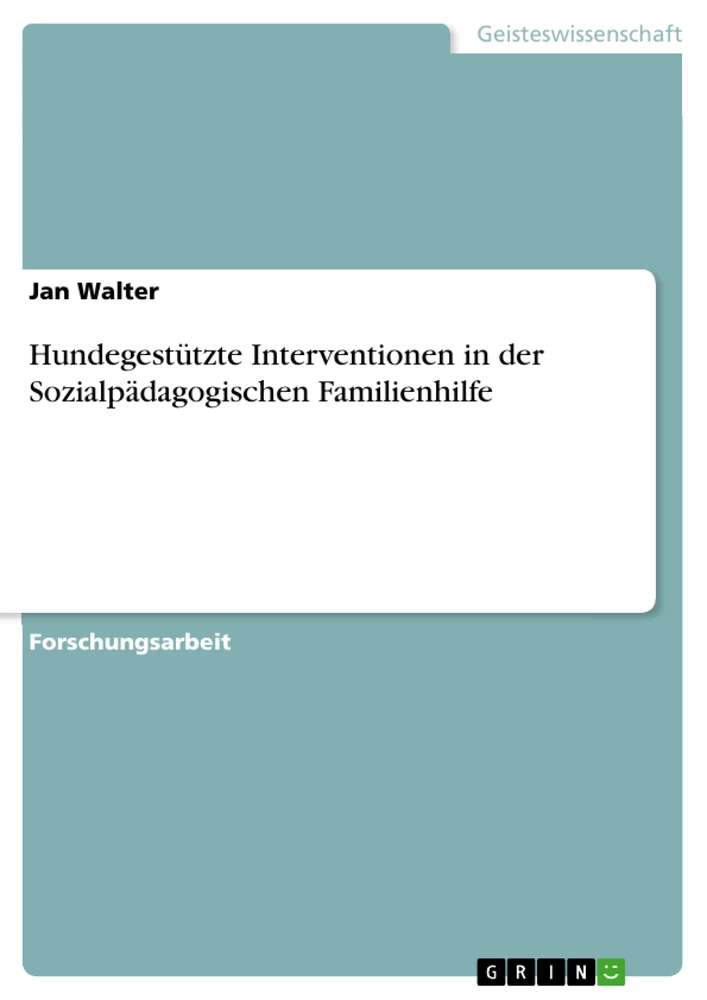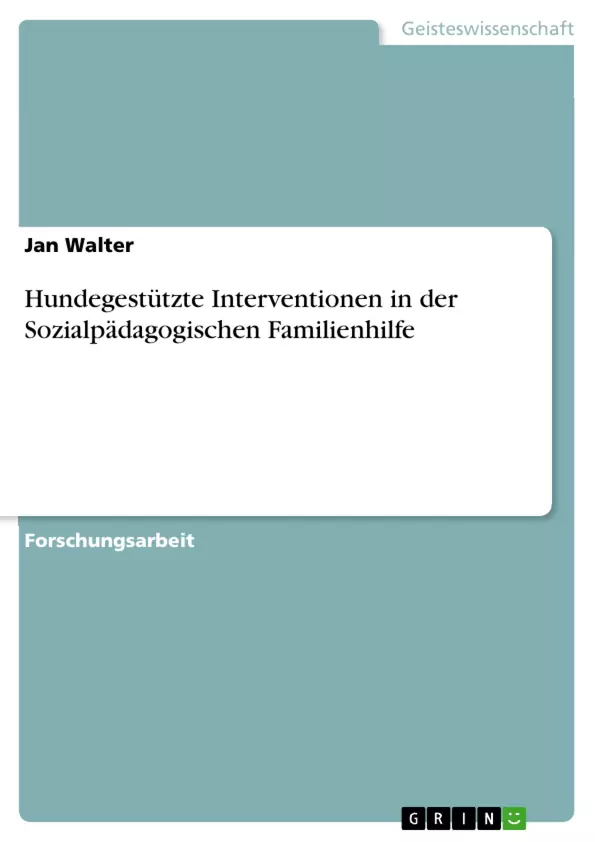Tiergestützte Interventionen mit Hunden werden in der Fachliteratur zwar zunehmend für die Felder der Medizin, Psychologie sowie der Heil- und Sonderpädagogik thematisiert. Gleichwohl mangelt es an empirischen Studien zu tiergestützten Interventionen. Insbesondere für die Profession Soziale Arbeit existieren diesbezüglich kaum Forschungsaktivitäten, die aber notwendig wären zur Schärfung des Verständnisses, was eigentlich die spezifische Rolle des in der Sozialen Arbeit eingesetzten Hundes sein könnte und für die Erarbeitung theoretisch fundierter Konzepte hundegestützter Interventionen in den Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit.
Im Hinblick auf diese Fragen widmet sich die vorliegende Arbeit dem Einsatz von Hunden im Arbeitsfeld der Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH). Die qualitative Studie geht auf Grund von zwei ausführlichen Experteninterviews der Frage nach, was Fachkräfte konkret tun, wenn Sie den Hund in der SPFH einsetzen. Welche Situationen stellen Fachkräfte mit dem Hund her? Wie agieren Sie in diesen Situationen? Wie nutzen Sie das, was in diesen Situationen interaktiv geschieht, für Ihre Arbeit, also für die konkreten Ziele mit dem Familienmitglied? Wie bauen Sie den Hund also in ihr indi-viduelles konzeptionelles Vorgehen mit einer Familie ein? – zusammengefasst in der Forschungsfrage: Wie führen Fachkräfte der Sozialpädagogischen Familienhilfe hundegestützte Interventionen durch?
Durch offen gehaltene Leitfragen wurden weitgehend selbstläufige und umfangreiche Schilderungen erlangt und systematisch dahingehend ausgewertet, wie Fachkräfte der SPFH konkret ihr sozialpädagogisches Handeln mit der hundegestützten Intervention verknüpfen und wie sich die Rolle des Hundes in diesem spezifischen Arbeitsfeld beschreiben lässt. Des Weiteren wurden durch die leitfadengestützte Erhebung Erkenntnisse gewonnen, wie die Fachkräfte mit den Rahmenbedingungen umgehen, die sich aus dem Arbeitsfeld der SPFH und aus allgemeinen fachlichen Anforderungen der tiergestützten Intervention ergeben.
Damit könnte die Arbeit einen Beitrag zur konzeptionellen Erschließung dieses Angebots darstellen.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Hinführung zu Forschungsfrage und Ziel der Studie
- Theoretischer Rahmen
- Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)
- Tiergestützte Intervention
- Methodisches Vorgehen
- Datenerhebung mittels Experteninterview und Dokumentation
- Datenauswertung mittels inhaltlich strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse
- Deduktiv angewendete Kategorien
- Induktiv gebildete Kategorien
- Ergebnisse der Schlüsselkategorien
- Besonderheiten des Arbeitsfeldes Sozialpädagogische Familienhilfe
- Sozialpädagogische Aktivitäten mit dem Hund
- Der Hund als Sozialpartner mit Eigensinn
- Deutung der Ergebnisse
- Diskussion
- Thesen, Bedarfe, Konsequenzen
- Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
- Anhang: Kategoriensystem mit Ankerbeispielen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende qualitative Studie befasst sich mit der Anwendung hundegestützter Interventionen im Bereich der Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH). Das Ziel der Arbeit ist es, die konkrete Praxis von Fachkräften in der SPFH bei der Einbindung von Hunden in ihre Arbeit zu untersuchen und die spezifische Rolle des Hundes in diesem Arbeitsfeld zu beleuchten. Die Studie soll einen Beitrag zur konzeptionellen Erschließung dieses Angebots leisten.
- Die Studie untersucht die spezifischen Herausforderungen und Möglichkeiten, die sich aus der Kombination von SPFH und hundegestützter Intervention ergeben.
- Sie analysiert die Rolle des Hundes in der SPFH als sozialer Partner und dessen Einfluss auf die Interaktion zwischen Fachkraft, Familienmitglied und Hund.
- Die Studie beleuchtet, wie Fachkräfte in der SPFH hundegestützte Interventionen in ihr individuelles konzeptionelles Vorgehen mit Familien integrieren.
- Sie betrachtet die Rahmenbedingungen, die sich aus dem Arbeitsfeld der SPFH und allgemeinen Anforderungen tiergestützter Interventionen ergeben.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Studie beginnt mit einer Einführung in die Forschungsfrage und Zielsetzung. Im theoretischen Rahmen werden die Sozialpädagogische Familienhilfe und tiergestützte Interventionen näher erläutert. Das methodische Vorgehen der Studie, das auf Experteninterviews und einer qualitativen Inhaltsanalyse basiert, wird im dritten Kapitel beschrieben.
Die Kapitel 4 und 5 präsentieren die Ergebnisse der Untersuchung und diskutieren diese. Die Ergebnisse der Schlüsselkategorien, wie die Besonderheiten des Arbeitsfeldes SPFH, die sozialpädagogischen Aktivitäten mit dem Hund und die Rolle des Hundes als Sozialpartner, werden vorgestellt und analysiert.
Schließlich werden die Ergebnisse der Studie in der Schlussbetrachtung zusammengefasst und ihre Bedeutung für die Praxis diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH), tiergestützte Interventionen (TGI), Hundegestützte Interventionen, qualitative Forschung, Experteninterviews, qualitative Inhaltsanalyse, Sozialpartner, Familienhilfe, Fachkräfte, Praxis.
Häufig gestellte Fragen
Was ist hundegestützte Intervention in der Familienhilfe?
Es ist der gezielte Einsatz eines Hundes durch Fachkräfte der Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH), um pädagogische Ziele mit Familienmitgliedern besser zu erreichen.
Welche Rolle spielt der Hund als „Sozialpartner“?
Der Hund fungiert als Eisbrecher, Motivator und Interaktionspartner, der durch seinen „Eigensinn“ neue Kommunikationswege in der Familie eröffnet.
Wie gehen Fachkräfte bei der hundegestützten Arbeit konkret vor?
Die Studie zeigt durch Experteninterviews, dass Fachkräfte den Hund situativ einbinden, um z.B. Vertrauen aufzubauen oder Verantwortungsbewusstsein bei Kindern zu fördern.
Gibt es empirische Studien zu diesem Arbeitsfeld?
Die Arbeit stellt fest, dass es bisher kaum Forschungsaktivitäten speziell für die Soziale Arbeit gibt, weshalb diese qualitative Studie zur konzeptionellen Schärfung beiträgt.
Welche Rahmenbedingungen müssen beachtet werden?
Neben dem Tierschutz müssen hygienische Aspekte, die Eignung des Hundes und die spezifischen Anforderungen des häuslichen Umfelds der Familien berücksichtigt werden.
Welche Methoden wurden für die Studie genutzt?
Es wurden ausführliche Experteninterviews geführt und mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet.
- Arbeit zitieren
- Jan Walter (Autor:in), 2021, Hundegestützte Interventionen in der Sozialpädagogischen Familienhilfe, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1160716