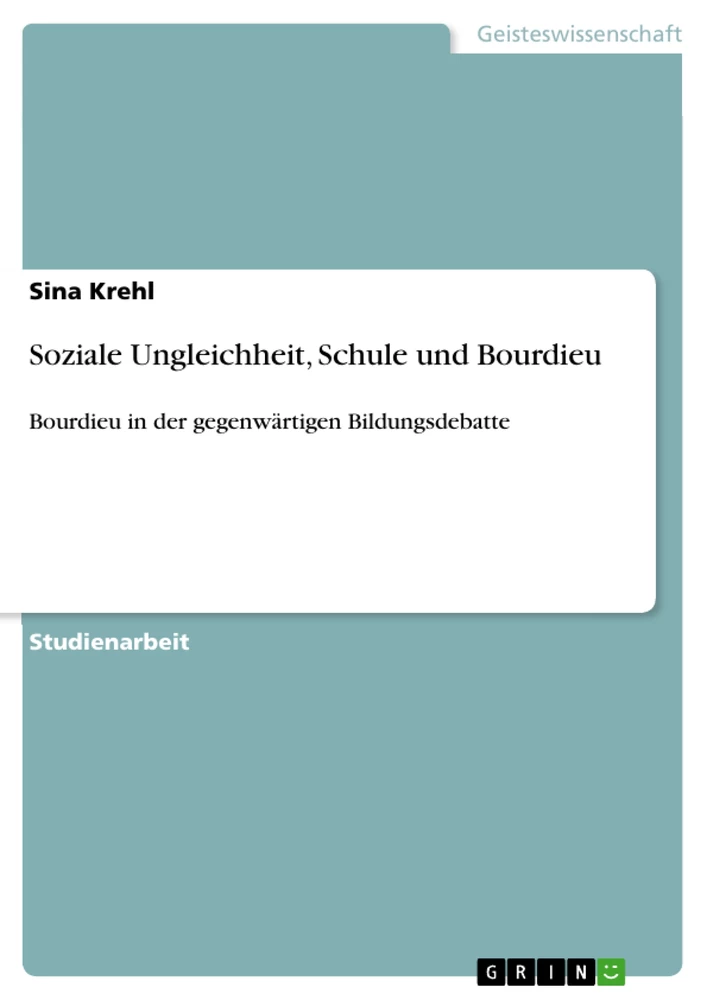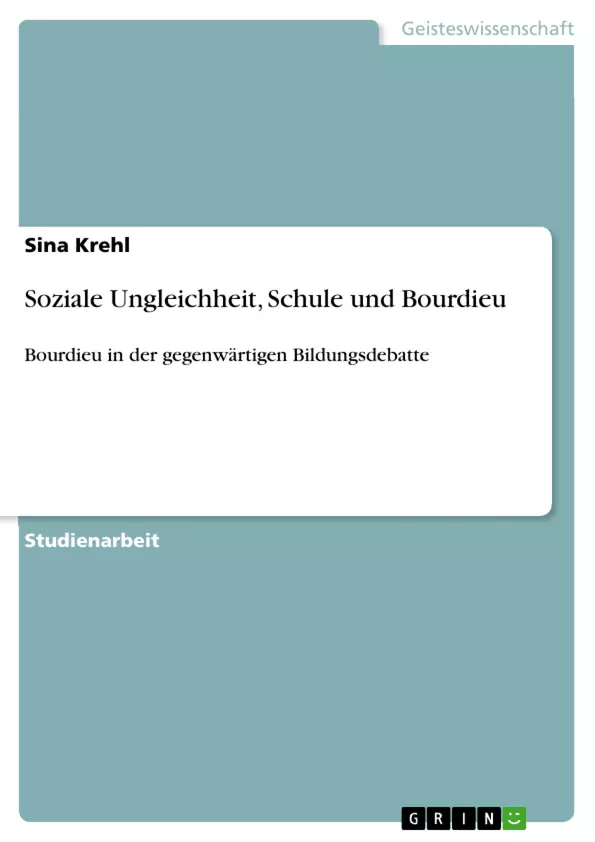Was ist soziale Ungleichheit, wo finden wir diese in unserem Bildungssystem und was hat Pierre Bourdieu damit zu tun?
Die vorliegende Ausarbeitung befasst sich mit der Theorie Pierre Bourdieus im Zusammenhang mit sozialer Ungleichheit im deutschen Bildungssystem. Es folgt ein Versuch, die wissenschaftliche Arbeit Bourdieus in den Kontext der Ungleichheitsforschung einzuordnen. Es macht Sinn, sich zunächst den Begriff der sozialen Ungleichheit einmal genauer anzusehen. Was versteht man in der Wissenschaft unter sozialer Ungleichheit und welchen Blickwinkel nimmt hier Bourdieu im Zusammenhang mit Bildung ein? In Punkt 3. wird die Institution Schule als soziales Feld auf den Grundlagen der Feldtheorie Bourdieus grob skizziert. In wieweit Bourdieu heute noch aktuell ist, wird in 4. herausgearbeitet. Ein kurzes Fazit im Schlussteil beleuchtet die wesentlichen Erkenntnisse des Erlernten und rundet die Ausführungen ab.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Soziale Ungleichheit
- Versuch einer Einordnung Bourdieus in den Kontext der Ungleichheitsforschung
- Schule als soziales Feld
- Aktualität
- Fazit
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung befasst sich mit der Theorie Pierre Bourdieus im Kontext sozialer Ungleichheit im deutschen Bildungssystem. Sie untersucht, wie Bourdieus Theorien die Bildungs- und Ungleichheitsdebatte beeinflussen und welche Relevanz sie in der gegenwärtigen Situation haben.
- Soziale Ungleichheit und ihre Ursachen
- Pierre Bourdieus Theorie der sozialen Ungleichheit
- Die Rolle der Schule als soziales Feld
- Die Aktualität von Bourdieus Theorien in der heutigen Bildungslandschaft
- Der Einfluss von Kapitalformen auf Bildungschancen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext der Ausarbeitung dar und erläutert das Forschungsfeld, welches sich mit der Theorie Pierre Bourdieus im Zusammenhang mit sozialer Ungleichheit im deutschen Bildungssystem befasst. Sie verdeutlicht die Komplexität der Themengebiete und gibt einen Überblick über die behandelten Aspekte.
Soziale Ungleichheit: Dieses Kapitel definiert den Begriff der sozialen Ungleichheit und stellt die unterschiedlichen Ansätze zur Erklärung und Analyse dar. Es beleuchtet die Bedeutung von ungleichen Zugang zu sozialen Positionen und den damit verbundenen Handlungs- und Lebensbedingungen.
Versuch einer Einordnung Bourdieus in den Kontext der Ungleichheitsforschung: Dieser Abschnitt widmet sich der Einordnung von Pierre Bourdieus Theorie in den Kontext der Ungleichheitsforschung. Er analysiert Bourdieus Konzept von Klassengesellschaften und die Bedeutung von kulturellen Praktiken für die soziale Ungleichheit.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Ausarbeitung befasst sich mit dem Thema der sozialen Ungleichheit und fokussiert insbesondere auf die Theorien von Pierre Bourdieu. Im Mittelpunkt stehen Konzepte wie Habitus, Feld, Kapital und die Rolle von Kultur in der Reproduktion sozialer Ungleichheit. Die Analyse der Schule als soziales Feld und die Relevanz von Bourdieus Theorien für die gegenwärtige Bildungsdebatte bilden weitere Schwerpunkte.
- Quote paper
- Sina Krehl (Author), 2020, Soziale Ungleichheit, Schule und Bourdieu, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1160876