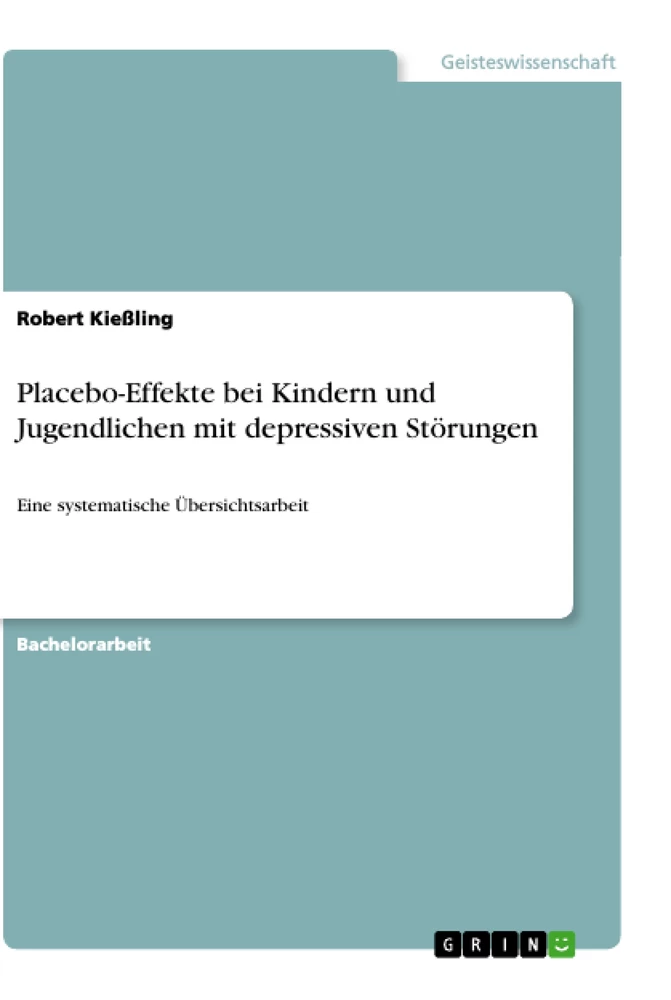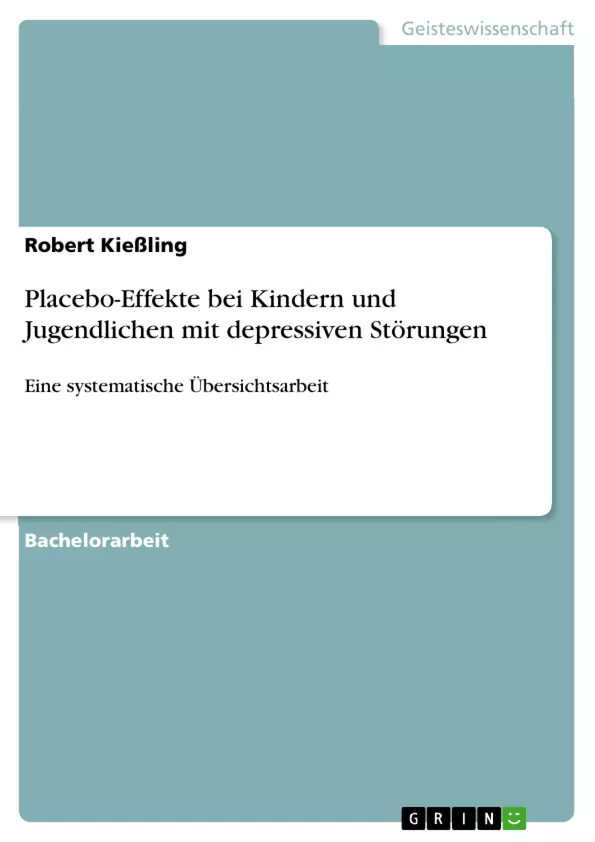Diese Arbeit eruiert die aktuellen Placebo-Modelle, die Rolle von Placebo-Effekten bei Kindern und Jugendlichen mit depressiven Störungen sowie die beeinflussenden Variablen. Auf dieser inhaltlichen Grundlage soll die Frage nach dem Nutzen von Placebos zu therapeutischen Zwecken in der Behandlung depressiver Störungen bei Kindern und Jugendlichen betrachtet werden.
Dafür wurden in den Datenbanken Psychology and Behavioral Sciences, PsycINFO, Psyndex, MEDLINE und der Universitätsbibliothek der Helmut-Schmidt-Universität 25 Studien bis zum 15. Dezember 2020 identifiziert.
Wirksamkeitsstudien zu Antidepressiva bei Kindern und Jugendlichen mit depressiven Störungen ergeben regelmäßig starke Placebo-Effekte. Mit der zunehmenden Untersuchung von Open-Label-Placebo und durch den Mangel an schonenden, alternativen Interventionen zur Therapie von Depressionen im Kinder- und Jugendbereich rückt das Placebo immer mehr in den medizinischen Fokus.
Inhaltsverzeichnis
Zusammenfassung
Abstract
Abkürzungsverzeichnis
Einleitung
1 Placebo
1.1 Wirkmechanismen
1.2 Einsatz als Kontrollvariable
1.3 Einsatz in der kurativen Praxis
1.4 Open-Label-Placebo
2 Depressive Störungen
2.1 Diagnostik
2.2 Epidemiologie
2.3 Therapie
2.4 Effektivität
2.5 Nebenwirkungen
2.6 Depressive Störungen bei Kindern und Jugendlichen
3 Methode
4 Ergebnisse
5 Forschungsperspektiven
6 Diskussion
Literaturverzeichnis
Zusammenfassung
Wirksamkeitsstudien zu Antidepressiva bei Kindern und Jugendlichen mit depressiven Störungen ergeben regelmäßig starke Placebo-Effekte. Mit der zunehmenden Untersuchung von Open-Label-Placebo und durch den Mangel an schonenden, alternativen Interventionen zur Therapie von Depressionen im Kinder- und Jugendbereich rückt das Placebo immer mehr in den medizinischen Fokus. Diese Arbeit eruiert die aktuellen Placebo-Modelle, die Rolle von Placebo-Effekten bei Kindern und Jugendlichen mit depressiven Störungen sowie die beeinflussenden Variablen. Auf dieser inhaltlichen Grundlage soll die Frage nach dem Nutzen von Placebos zu therapeutischen Zwecken in der Behandlung depressiver Störungen bei Kindern und Jugendlichen betrachtet werden. Dafür wurden in den Datenbanken Psychology and Behavioral Sciences, PsycINFO, Psyndex, MEDLINE und der Universitätsbibliothek der Helmut-Schmidt-Universität 25 Studien bis zum 15. Dezember 2020 identifiziert. Zur Erklärung von Placebo-Effekten werden die Modelle der klassischen Konditionierung, der Erwartungstheorie und des Placebo-by-Proxy herangezogen. Placebo-Effekte spielen bei Kindern und Jugendlichen mit Depressionen eine herausragende Rolle, insbesondere im Vergleich mit anderen Störungen und Altersklassen. Die Differenz der Placebo- und Interventions-Response liegt in etwa bei 10 Prozentpunkte. Medikamente sind in der Regel nicht signifikant wirksamer als Placebos, bei gleichzeitig signifikanten Nebenwirkungen. Kinder reagieren tendenziell stärker auf Placebos als Jugendliche. Des Weiteren sind die Effekte bei leichten Verläufen größer als bei schweren Krankheitsphasen. Beeinflusst wird der Effekt durch die Anzahl der Orte, an denen eine Studie durchgeführt wird, den sozialen Status und die Häufigkeit der therapeutischen Kontakte zwischen Patienten und Personal. Die Ergebnisse lassen eine gute Wirksamkeit von Open-Label-Placebos bei depressiven Störungen erwarten. Sie könnten insbesondere für Kinder mit leichten Depressionen wirksam sein.
Schlagwörter: Placebo; Kinder; Jugendliche; Depression; Open-label-Placebo
Abstract
Efficacy trials for antidepressants in children and adolescents with depression often yield high placebo effects. With increasing research in the field of Open-label placebo and because of the shortage of gentle therapies, the placebo is gaining consideration. This thesis investigates current placebo theories, the role of placebo effects in children and adolescents with depressive disordes and the affecting variables, to answer the question if placebos could be used therapeutically. Until the 15th december 2020, 25 studies were found in the databases Psychology and Behavioral Sciences, PsycINFO, Psyndex, MEDLINE and in the university library of the Helmut-Schmidt-University. For the explanation of placebo effects classical conditioning, the expectancy theory and the theory of placebo-by-proxy are used. Placebo effects are important in children and adolescents with depressive disorders, more particularly in comparison with other age classes and disorders. The difference in response between placebo and intervention is about 10 percentage points. Drugs are in general not significant superior to placebo but induce significant more side effects compared to placebo. Children tend to respond stronger than adolescents. The effects are greater in mild severities than in severe cases. The effect is affected by the number of study sites, the social status and the frequency of interactions between patients and clinical staff. The results give reason to expect Open-Label-Placebos to be efficient in depressions. They could especially be efficient in children with mild depressions.
Keywords: placebo; children; adolescents; depression; open-label placebo
Abkürzungsverzeichnis
Bzw. – beziehungsweise
Lat. – lateinisch
o.ä. – oder ähnliches
insb. – insbesondere
etc. – et cetera
o.g. – oben genannt
OLP – Open-Label-Placebo
P.E. – Placebo-Effekt
KuJ – Kinder und Jugendliche
ICD-10 – International Classification of Diseases Revision 10
DSM-V – Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders Volume 5
ca. – circa
d.h. – das heißt
Einleitung
Placebos und Placebo-Effekte sind keine Phänomene der Neuzeit. Größte Bedeutung kam dem Placebo bisher als Kontrollvariable in Wirksamkeitsstudien für Medikamente zu. Jedoch haben neben der pharmazeutischen Forschung auch andere Bereiche wie das Marketing das Placebo für sich entdeckt (McClure et al., 2004). Neuere Ergebnisse legen nahe, dass P.E. auch ohne Täuschung möglich sind, gerade als Open-Label-Placebo. Mit dem Überholen des alten Paradigmas gehen umfangreichere Erklärungsmodelle einher. Niedrige Differenzen von Placebo- und Medikamentenwirksamkeit bei gleichzeitig hohen Effektstärken in den Placebogruppen legen die Verwendung von Placebos als Kontrollvariable hinaus als Behandlungsalternative nahe (Kaptchuk & Miller, 2018). Dies betrifft insbesondere subjektive und psychosomatische Krankheitsbilder, bei denen die Wirksamkeit bzw. die Beeinflussung größer ist als bei objektiven Krankheiten für dessen Diagnostik und Therapie es wenig bis keiner Zuarbeit des Patienten bedarf (Emanuel & Miller, 2001). Das bedeutet, dass sich schwere Krankheiten wie Krebserkrankungen nur schwer mit Placebo behandeln lassen aber sehr wohl die Symptome, wie das Fatigue-Syndrom, das mit einer Krebserkrankung einhergeht. Besonders stark tritt dies bei depressiven Störungen beziehungsweise bei Wirksamkeitsstudien für Antidepressiva auf. Hier können Placebos bis zu 80% der Wirkung des Medikaments erreichen (Kelley et al., 2012). Der Vorteil einer Behandlung mit Placebos ist das Ausbleiben der pharmakologischen Nebenwirkungen. Nachteilig ist die verschleierte Gabe eines Placebos, denn durch das damit verbundene Vorenthalten einer pharmakologisch wirksamen Therapie ergeben sich ethische Probleme. (Lenk, 2014). Zur Vermeidung dieser Schwierigkeit bieten sich OLP an. Ein OLP ist ein Placebo, das offen als solches verabreicht wird. Nebenwirkungen sind nur durch Nocebo-Effekte zu erwarten. Antidepressiva hingegen bringen oft starke Nebenwirkungen mit sich. Kinder und Jugendliche mit depressiven Störungen leiden unter diesen Nebenwirkungen, die durch ihre Art das Potenzial für Folgeschäden mit sich bringen.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Modellen zur Erklärung von Placebos. Des Weiteren wird auf die Fragen eingegangen, welche Rolle P.E. bei Kindern und Jugendlichen mit Depressionen spielen und welche Variablen durch P.E. beeinflussbar sind. Übergeordnete Forschungsfrage ist, ob OLP eine schonende Therapie-Alternative in einem Stepped-Care-Plan für Kinder und Jugendliche sein kann. Im Anschluss wird zum theoretischen Hintergrund in das Placebo und in depressive Störungen eingeführt.
1 Placebo
Der Begriff Placebo entstammt dem lateinischen Verb „placere“ und bedeutet „ich werde gefallen“. Zu einem Begriff für ein Phänomen der Psychologie und Medizin wurde „Placebo“ durch die Bibel. So kommt es in Psalm 116 vor, welcher während dem späten Mittelalter häufig zu Beerdigungen gesungen wurde. Zu der Zeit war es üblich Schauspieler als falsche Trauernde zu engagieren, welche dann den Psalm 116 als Trauerlied sangen. Solche bezahlten Trauergäste wurden als Placebo bezeichnet (Rehn, 2019). Placebos erzielten also ihre Wirkung, ohne „echt“ zu sein. So wie beim gleichnamigen Effekt Präparate ohne pharmakologische Substanzen eine Wirkung hervorrufen, ohne „echt“ zu sein. Doch längst ist das Placebo nicht nur Gegenstand der Psychologie und Medizin. Auch wirtschaftliche Zweige, hier insbesondere das Marketing, haben den Placebo-Effekt für sich entdeckt. So lassen sich z.B. Produkteigenschaften beim Konsumenten durch den Anschein und die Erwartung realisieren. Dadurch kann der Genuss eines Produkts deutlich vom Preis abhängen (Springer, 2017). Im nachfolgenden werden Placebos und deren Effekte in der Therapie beleuchtet. Neben dem medikamentösen Ansatz werden auch andere Placebo-Behandlungen vorgenommen, wie etwa Placebo-Operationen. Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem medikamentösen Placebo.
Das Placebo wird definiert als Präparat, das seinem Anschein und seiner Beschaffenheit nach (Form, Farbe, Größe, Geschmack und Geruch) herkömmlichen Medikamenten gleicht, allerdings ohne pharmakologisch wirksame Substanzen zu enthalten. Positive Veränderungen und Nebenwirkungen, die auf die Einnahme von Placebos zurückzuführen sind, sind Placebo-Effekte. Das Gegenteil vom Placebo ist das Nocebo (lat. nocere, 1. Person Singular Futur, zu Deutsch „ich werde schaden). Der Mechanismus ist hier umgekehrt: einem pharmakologisch unwirksamen Präparat oder einer Scheinbehandlung werden schädliche Eigenschaften zugeschrieben. Bei Anwendung führt ein Nocebo dann in Folge eines Nocebo-Effekts zu Schäden, bzw. zu einer Verschlechterung.
Versteht man den Einsatz von Placebos als Behandlungsansatz, bei dem eine Wirkung ohne Vorliegen eines pharmakologischen Wirkstoffs oder medizinische Eingriffe erzielt werden soll, so lassen sich große Teile der Medizin vom Mittelalter bis zur Neuzeit als Placebo erklären (Furnham, 2010). Beispiele dafür sind Aderlass, Schröpfen oder auch Akupunktur. Therapie-Formen, die über Jahrhunderte populär waren und es teilweise immer noch sind. Sie haben gemein, dass sie keine signifikante Wirkung im Sinne der Schulmedizin aufweisen (mit einigen Ausnahmen wie die Funktion des Aderlasses bei Polycythameia vera, eine Erkrankung, die zu einer Überproduktion der Blutzellen führt). Nach dem heutigen Verständnis sind diese Verfahren unter den richtigen Umständen wirksam, allerdings nicht durch ihrer selbst, sondern vorrangig durch ihre Funktion als Placebo.
1.1 Wirkmechanismen
Im klassischen Placebo-Paradigma ist Täuschung die zentrale Bedingung für das Auftreten eines Placebo-Effekts. Durch die Täuschung beziehungsweise durch die Erwartung eines Medikaments werden verschiedene Mechanismen aktiviert. Die bisherigen zwei Grundmodelle, die über die meisten Quellen hinweg auftauchen, sind die klassische Konditionierung und die Erwartungstheorie (Leblanc, 2015). Zusätzliche Ansätze befassen sich zunehmend mit neurobiologischen Mechanismen.
In der Theorie der klassischen Konditionierung ist der Placebo-Effekt die erlernte Antwort auf einen bekannten Reiz (Pawlow, 1927). Ein unbewusster Prozess, bei dem das Verhalten mit dem vorhergehenden Reiz assoziiert wird. Es ist anzunehmen, dass Patienten in der Vorgeschichte gelernt haben, dass auf die Medikamenteneinnahme in einer therapeutischen Situation eine physiologische Reaktion des Körpers zu folgen hat. Die körperlichen Veränderungen führen die Patienten auf das Wissen um die pharmakologischen Inhaltsstoffe zurück. Bleiben Situation und Reize unverändert, wird jedoch der pharmakologische Wirkstoff weggelassen, reagiert der Körper trotzdem mit seiner gelernten Reaktion. Nicht nur die Präparate, sondern auch situationsspezifische Reize wie Ärztekittel und medizinische Räumlichkeiten tragen hier zur Konditionierung bei (Oeltjenbruns & Schäfer, 2008). Konditionierung als Entstehungsbedingung für Placebo-Effekte ist robust und vielfach nachgewiesen (Voudouris NJ, Peck CL, Coleman G, 1985, 1989, 1990). Besonders gut lassen sich konditionierte Placebo-Effekte in Tierversuchen nachweisen, denn hier können andere Variablen wie Instruktion und Erwartungshaltung ausgeschlossen werden (Herrnstein, 1962). Allerdings stößt dieses Erklärungsmodell an seine Grenzen, wenn die Personen über keine persönliche Lerngeschichte verfügen und noch keine Erfahrungen mit dem Medikament gemacht haben, welches sie vermeintlich bekommen (Rehn, 2019). Zusätzlich erklärt es nicht, wie andere Variablen, die das Modell der klassischen Konditionierung nicht berühren, das Auftreten eines Placebo-Effekts signifikant beeinflussen. So erhöhen Instruktionen, die gezielt höhere Erwartungen an die Therapie wecken, deutlich stärkere Placebo-Effekte (Benedetti, 2014). Es bedarf also einem weiteren Modell zur Erklärung dieser Variablen des Placebo-Effekts. Das führt zur Erwartungstheorie.
Die Erwartungstheorie nimmt in Ergänzung zur Konditionierung psychologische Variablen wie die Instruktion vor der Therapie, persönliche Erfahrungen und Einstellungen oder die Therapeuten-Patienten-Beziehung in die Erklärung mit auf. „Erwartung meint die Antizipation, d. h. die gedankliche (bewusste) Vorwegnahme eines zukünftigen Ereignisses.“ (Oeltjenbruns & Schäfer, 2008, S. 456) Demnach ist der Placebo-Effekt eine Antwort auf die Erwartungshaltung, eine Verbesserung würde bei Einnahme eines Placebos eintreten und hängt somit von einstellungsmodulierenden Variablen ab (Ross & Olson, 1981). Das Auftreten eines Effekts hängt davon ab, wie sehr die Person eine Verbesserung erwartet beziehungsweise wie hoch die Verbesserung erwartet wird.
Auf die wichtigsten modulierenden Variablen (Instruktion, Suggestibilität, „Locus-of-control“ und Therapie-Motivation) wird im Folgenden eingegangen. Die Variablen stehen dabei nicht einzeln, sondern bedingen sich gegenseitig. Die Instruktion ist besonders wichtig zur Erwartungserzeugung. Von ihr hängt der Placebo-Effekt durch die instruierte Erfolgswahrscheinlichkeit der Therapie (empirische Beweise der Wirksamkeit, etc.) ab (Amanzio & Benedetti, 1999), die Darstellung (zum Beispiel die Kleidung) und subjektive Sympathie des Instrukteurs und damit verbunden die wahrgenommene Kompetenz des Behandlers, der Länge der Instruktion und ähnliche Variablen beeinflussen die Erwartungshaltung. Des Weiteren können psychologische Effekte wie die Assoziation eines hohen Preises mit hoher Qualität und darüber auch mit hoher Wirksamkeit die Stärke von Placebo-Effekten beeinflussen. Werden Versuchspersonen die Placebos als besonders kostspielig angepriesen, so fällt auch der Effekt stärker aus, als wenn es sich um ein vermeintliches günstiges Medikament handelt (Waber et al., 2008). Insgesamt wirkt die Instruktion durch Suggestion. Daraus folgt, dass der Therapieerfolg eines Placebo-Einsatzes von der Suggestibilität der einzelnen Personen abhängt (Pascalis et al., 2002). Unter Suggestibilität ist die Empfänglichkeit oder Beeinflussung von Personen zu verstehen, die Informationen der Instruktion als gegeben anzunehmen, ohne diese zu hinterfragen.
„Locus-of-control“ ist eine Persönlichkeitseigenschaft, die aussagt, wem oder was Personen wie viel Kontrolle zuschreiben. Im Alltag bedeutet das, dass Menschen mit internalen locus-of-control berufliche Erfolge in Zusammenhangen mit der eigenen Anstrengung und Leistung betrachten. Während Menschen mit externalem locus-of-control Erfolg dem Glück oder dem Zufall zuschreiben (Myers, 2014). Eine internale Kontrollüberzeugung korreliert positiv mit Erfolg und Stressmanagement und damit prinzipiell auch mit Gesundheit (Ng et al., 2006). Auf den Placebo-Effekt hat es dahingehend Einfluss, dass Personen, die hinsichtlich ihrer Gesundheit eine internale Kontrollüberzeugung aufweisen, stärkere Effektstärken berichten (Reynaert et al., 1995). Dabei geht es zum einen um die Überzeugung die Person selbst könne ihre Gesundheit beeinflussen, als auch die Überzeugung, dass die Therapie Verbesserung bewirken kann. Durch die Kontrollüberzeugung wird eine weitere Variable beeinflusst, die Therapie-Motivation. Aigner und Svanum (2014) gaben in ihrer Arbeit eine positive Korrelation zwischen Motivation und Placebo-Effekt an. Der Einfluss der Motivation auf den Placebo-Effekt wird vor allem durch gesteigerte Aufmerksamkeit bestimmt. Durch die höhere Therapie-Motivation sind die Personen aufmerksamer und achtsamer für ihre Symptome und nehmen subjektive Veränderungen stärker wahr (Jensen & Karoly, 1991). Nebenbei kann die Therapie-Motivation durch weitere Variablen wie die den Hawthorne-Effekt und die soziale Erwünschtheit die Effektstärken beeinflussen, wobei diese beiden sich bedingen. Der Hawthorne-Effekt beschreibt die Verzerrung von Untersuchungen. Dabei wird davon ausgegangen, dass nicht die Manipulation selbst, sondern die Tatsache, dass die Personen an einer Untersuchung teilnehmen und beobachtet werden, zu Veränderungen führen (Myers, 2014). Eine mögliche Erklärung dafür ist die soziale Erwünschtheit. Darunter ist zu verstehen, dass Patienten von einer Verbesserung unter Placebo berichten, weil sie glauben eine positive Rückmeldung würde von ihnen erwartet werden (Gelfand et al., 1965).
Die Erklärung des Placebo-Effekts durch die Erwartungstheorie mittels oben genannter Variablen ist allerdings limitiert. Aktuelle Ergebnisse lassen sich nicht mit der Erwartungstheorie vereinbaren. Denn Konditionierung kann in der klassischen Auffassung nicht wirken, wenn keine Vorerfahrung besteht. An dieser Stellte hilft die Erwartungstheorie aus. Allerdings findet die Erwartungstheorie hauptsächlich Bezug auf Erwachsene doch reicht nicht mehr aus bei der Betrachtung von Placebo-Effekten bei Kindern und Jugendlichen, sowie Tieren ohne Vorerfahrung. In diesen Fällen fehlen die Bedingungen für die Erwartungstheorie teilweise oder gänzlich, da gerade (Klein-)Kinder noch nicht die Entwicklungsreife für Konzepte wie Therapie-Erwartung oder Therapie-Motivation erfüllen (Wild & Möller, 2015). Dennoch sind Placebo-Effekte auch bei diesen Individuen nachweisbar (Czerniak et al., 2020). Es müssen zusätzliche Mechanismen existieren, die bei der Placebo-Anwendung wirken.
Dazu gehört die etwas ältere Variable Therapeut-Patienten-Beziehung und das jüngere Placebo-by-proxy. Die Therapeut-Patienten-Beziehung moduliert nicht nur die Anwendung von Placebos, sondern jede Art von Behandlung. Die Dauer, die Häufigkeit des Kontakts und die subjektiv empfundene soziale Wärme im Kontakt des Patienten mit dem Arzt, Therapeut oder Untersuchers ist positiv mit dem Placebo-Effekt korreliert (Su et al., 2007). Grundsätzlich kann jeder Kontakt mit einem Behandler zu einer Verbesserung im Sinne eines Placebos führen (Hrobjartsson, 1996). Denkbar ist dabei zum Beispiel der therapeutische Effekt eines Aufnahmegesprächs für eine Psychotherapie. Objektiv betrachtet enthält ein Aufnahmegespräch keine therapeutischen Strategien und führt dennoch sehr häufig zu einem entlastenden Gefühl beim Patienten.
Da sich diese Arbeit den Placebo-Effekten bei Kindern und Jugendlichen widmet, wird hier einer der jüngsten Erkenntnisse besonders wichtig: der Effekt des „Placebo-by-proxy“. Darunter versteht man die Wirkung des Placebos auf Nahestehende, meistens die Eltern oder gegebenenfalls die Betreuer eines Kindes, welches mit Placebo behandelt wird. Der Begriff wurde von Grelotti und Kaptchuk (2011) eingeführt und bekommt seitdem wachsende Beachtung. Der Effekt wird als potentielle Erklärung für den Erfolg von Homöopathie bei Kindern und heilenden Ritualen der Alternativmedizin erachtet (Kaptchuk, 2002). Wenn ein Kind mit Placebo behandelt wird, dann kann diese Therapie durch bereits genannte Mechanismen wie Erwartungshaltung zum Placebo-Effekt bei den Eltern führen. Das wiederum führt über zwei mögliche Wege zur Verbesserung beim Kind. Auf dem Weg A übertragen die „Proxys“, also in diesem Fall die Eltern, ihre Erwartungen auf das Kind in Form veränderten Umgangs. Das Kind nimmt diese Verhaltensänderung im günstigsten Fall positiv wahr und spiegelt die Stimmung und Erwartung der Eltern. Daraus kann eine Verbesserung resultieren. Weg B führt primär zu einer Verzerrung. Dem Entwicklungsstand von Kindern und Jugendlichen entsprechend werden die Symptome, besonders bei Kindern durch die Eltern erhoben. Eine bekannte Situation: eine Mutter geht mit ihrem Kind zum Arzt. Der Kinderarzt oder die Kinderärztin wird in der Regel mit steigendem Alter des Kindes auch das Kind selbst befragen aber gerade in den ersten Lebensjahren, bevor das Kind die Fähigkeit des Sprechens erlangt, muss der Arzt zwangsläufig die Mutter befragen. Sind die Proxys von der Therapie ihres Kindes überzeugt und haben eine positive Erwartungshaltung, werden sie ihr Kind beziehungsweise dessen Symptome unter dem Bias ihres eigenen Placebo-Effekts wahrnehmen. Gegebenenfalls werden dadurch stärkere Symptomverbesserungen angegeben als von Eltern mit neutraler oder negativer Erwartung. Sekundär kann auch Weg B zu einer Verbesserung der Symptome des Kindes führen. Untersuchungen haben gezeigt: das Ansprechen von Kindern auf Placebo-Anwendungen korreliert mit der Stimmung und den Überzeugungen ihrer erwachsenen Proxys (Whalley & Hyland, 2013). Nicht nur Angehörige oder Nahestehende, wie Eltern oder Betreuer, fungieren als Proxys. Auch die Behandler, Untersucher, Ärzte oder Therapeuten selbst können über Placebo-by-proxy den Therapie-Erfolg beeinflussen. Dieser Mechanismus lässt sich ebenfalls auf das Gegenteil, das „Nocebo-by-proxy“, anwenden (Czerniak et al., 2020). Wie schon zu Beginn der Arbeit erwähnt, können Nocebo-Effekte einen negativen Einfluss auf Therapien ausüben. Demnach können negative Erfahrungen mit Medikamenten, wie unangenehme Nebenwirkungen, oder negative Überzeugungen bei Patienten oder Proxys zu einer Verschlechterung ohne externe Ursachen führen. Folglich können auch bei klassischen, pharmakologisch wirksamen, medikamentösen Therapien Nebenwirkungen auftreten, die durch die Wirkstoffe nicht erklärbar sind (Barsky et al., 2002).
Grundsätzlich sind die bisher beschriebenen Theorien und Modelle nicht in Konkurrenz zu sehen. Vielmehr ist der Placebo-Effekt ein Gebäude mit mehreren Säulen. Mit mehreren Säulen in Form der klassischen Konditionierung, der Erwartungstheorie oder des Placebo-by-proxy, die je nach Situation mal mehr und mal weniger zum gesamten Effekt beitragen. Oft ist es schwierig bis unmöglich die Mechanismen zu trennen. Die Überprüfung durch Isolation eines Mechanismus, durch Entfernung einer Grundbedingung (beispielsweise ausreichende Vorerfahrung bei der klassischen Konditionierung), ist bei realitätsnahen Untersuchungen oft kaum bis gar nicht umzusetzen.
Neben psychologischen, spielen auch medizinische Aspekte eine Rolle. Vermuten lassen sich neurobiologische Top-down-Prozesse, bei denen u.a. die Physiologie durch das Gehirn beeinflusst wird. Maßgebend und schon relativ alt ist hierbei das Placebo-Analgesie Paradigma, die Schmerzlösung durch Placebo. Grundlage dessen ist die Erkenntnis, dass die Placebo-Applikation das endogene Opioid-System aktivieren kann. Körpereigene Schmerzmittel werden ausgeschüttet, die nicht in höheren Hirnstrukturen wie dem präfrontalen Kortex, sondern lokalanästhetisch wirken. Das Paradigma geht auf Levine und Kollegen zurück, die 1978 feststellten, dass sich analgetische Placebo-Effekte durch Opioid-Antagonisten aufheben lassen (J. Levine et al., 1978). Nach einer schmerzstillenden Reaktion verabreichten sie Naloxon, was den Schmerz wieder ansteigen ließ. Dieser Versuch konnte zahlreich repliziert werden (Amanzio & Benedetti, 1999) und lässt sich auch auf andere Krankheitsbilder wie die Parkinson-Krankheit übertragen (Benedetti et al., 2005). Allerdings sind die neurobiologischen Erkenntnisse bisher noch beschränkt und endogene Opioid-Agonisten sind für die Therapie für von depressiven Störungen von untergeordneter Rolle.
1.2 Einsatz als Kontrollvariable
Ein Placebo kann nicht wirken, es enthält keinen Wirkstoff. Man testet zwei Gruppen, wobei Gruppe A den Wirkstoff und Gruppe B das Placebo erhält. Die Wirkung des Wirkstoffes zeigt sich dann in der Differenz des Therapie-Erfolgs beider Gruppen. Das ist der klassische Goldstandard von pharmakologischen Wirksamkeitsstudien. Das Paradigma wurde über die Zeit immer wieder angepasst und verbessert. Um Erwartungs-Effekte und ähnliche Variablen zu kontrollieren wurde erst die einfache Verblindung, dann die doppelte Verblindung eingeführt. Der Grundsatz: eine Placebo-Therapie ist keine Therapie.
Grundsätzlich muss unterschieden werden, in welchem Bereich die Wirksamkeit untersucht wird. Beim Paradigma der Placebo-Analgesie geht es um akute Anwendungen. Zeitlich stark begrenzt und einfach unter kontrollierten Bedingungen durchführbar. Das erleichtert die Kontrolle von Stör- und Drittvariablen drastisch. Ander sieht das bei Paradigmen aus, die langfristig und kompliziert sind. Eine schwergradige Major Depression dauert nicht selten von der Genese bis zur Remission 1 Jahr. Oftmals teilremittiert sie nur oder heilt als rezidivierende Störung nie ganz. Psychische Störungen wie die Major Depression sind oft langlebig, andere wie Persönlichkeitsstörungen lebenslänglich (Falkai & Döpfner, 2015). Das verbindet eine Therapie, sofern medikamentös behandelt wird, oft mit sehr langen Einnahmen von Arzneimitteln. Zusätzlich schlagen die meisten Antidepressiva erstmalig nach 3 Wochen andauernder Einnahme an (Benkert & Hippius, 2019). Offensichtlich ist hier die Placebo-Kontrolle wesentlich schwieriger. Die große zeitliche Variable erhöht naturgemäß die Stichproben-Mortalität und die Komplexität vergrößert den Einfluss von Dritt- und Störvariablen. Je komplexer die Untersuchung ist, desto schwieriger wird es, den tatsächlichen Placebo-Effekt zu bestimmen. Es hilft eine Gruppe C einzuführen, die gar keine Therapie erhält. Unter außeracht lassen der ethischen Aspekte bekommt man so einen Einblick in die Anteile der Verbesserung, die nicht durch das Placebo oder das Medikament verursacht wurden. Ein nicht unwesentlicher Teil der Verbesserung wird durch Spontanremission und Regression zur Mitte herbeigeführt (Benedetti & Colloca, 2005). Spontanremission beschreibt den kurativen Prozess, der ohne Therapie von statten geht. Regression zur Mitte ist ein statistisches Phänomen bei dem Patienten dazu tendieren ihre Symptome bei einem späteren Erhebungszeitpunkt schwächer als bei der ersten Erhebung anzugeben. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der, dass die Mechanismen wie Erwartungshaltung etc., die auch beim Placebo zum Tragen kommen, ebenfalls bei einer pharmakologischen Therapie Auswirkungen haben können. Demzufolge kann ein Medikament wirken und in seiner Wirkung verstärkt werden, wenn der Patient von dem Mittel überzeugt ist oder dem Arzt in seiner Arbeit vertraut. Daraus resultiert eine Schwäche des Placebos als Kontrollvariable. Um diese Problematik zu reduzieren, wäre eine Ergänzung der Wirksamkeitsstudien um weitere Paradigmen sinnvoll. Die Bedeutung des Placebos sinkt als Kontrollvariable, wenn zum Beispiel andere Studiendesigns (offene und versteckte Gabe eines Präparates) miteinander verglichen werden. Der Fokus würde dadurch auf alternative Anwendungszwecke, allen voran in der Therapie, verschoben werden.
1.3 Einsatz in der kurativen Praxis
Schon längst gehören Placebos zum breiten Repertoire vieler Mediziner und Pflegekräfte (Fässler et al., 2010). Eine Befragung von 679 nordamerikanischen Internisten und Rheumatologen ergab: 46-58 % der Ärzte nutzen regelmäßig Placebos für ihre Behandlungen. Ein Großteil derer halten sogar deren Einsatz für ethisch vertretbar (Tilburt et al., 2008). Es handelt sich jedoch nicht nur um Placebos im herkömmlichen Sinne, wie Tabletten ohne Wirkstoff und Kochsalzlösung. Es werden auch Nahrungsergänzungsmittel, wie Vitamine eingesetzt. Besonders bedenklich ist der Einsatz von Arzneien, die für die jeweilige Störung nicht gedacht sind und keinen erwartbaren, physiologischen Mehrwert bieten. Dieser Einsatz von Schmerzmitteln oder Antibiotika belastet den Patienten unnötig. Der Patient wird hierbei dem unnötigen Risiko von Nebenwirkungen und Resistenzentwicklungen ausgesetzt. Doch selbst bei der Anwendung von Placebos, die keinen Wirkstoff innehaben, bleiben ethische Einwände, genauso wie im Folgenden.
Ein weiterer Ansatz zum therapeutischen Einsatz von Placebos ist die Kombination mit pharmakologisch wirksamen Medikamenten, wodurch es zu einer partiellen Verstärkung der bestehenden Therapie kommen soll (Weimer et al., 2013). Denkbar ist die Einstellung eines Patienten auf ein Medikament, hier im Besonderen ein Antidepressivum. Nach dem Anschlagen des Präparats wird nach einer Gewöhnungszeit stellenweise das Präparat mit dem Wirkstoff durch ein identisch anmutendes Placebo ersetzt. Dabei nimmt im Laufe der Behandlung das Verhältnis von Placebo zu Medikament zu und das Medikament wird dabei besonders schonend ausgeschlichen. Hier würde der Effekt durch die Konditionierung profitieren. Allerdings bringt dieser Ansatz erhebliche Probleme mit sich. Ein solcher Therapie-Plan ist ethisch nicht vertretbar und auch praktisch schwer umzusetzen. Es müssten spezielle Chargen produziert werden, mit unterschiedlichem Placebo-Anteil, der von außen nicht ersichtlich ist. Zusätzlich müssten die Präparate in einer festen Reihenfolge eingenommen werden und es besteht erhebliche Verwechslungsgefahr, die fahrlässig wäre.
1.4 Open-Label-Placebo
Die Wirkmechanismen des Placebo-Effekts zeigen: Täuschung ist keine essenzielle Bedingung für das Auftreten eines Placebo-Effekts. Entscheidender sind die Instruktion, persönliche Erfahrungen und Einstellung, sowie Therapie-Motivation. Gerade bei Kindern und Jugendlichen sind zusätzlich die Einstellungen und Eigenschaften der Proxys, meistens der Eltern, relevant. Instruiert nun ein Arzt glaubhaft das Therapie-Potential eines Placebos einem Patienten und erfüllt der Patient grundlegende Bedingungen (Offenheit für Alternativen, besagte Motivation, Vertrauen in den Arzt, etc.), sind dann nicht wichtige Variablen erfüllt? Ist dann nicht trotz Offenlegung des Placebos ein Effekt bzw. ein Therapie-Erfolg zu erwarten? Das führt zum Open-Label-Placebo Paradigma. OLP beschreibt die Anwendung von Placebos, bei denen auf Verschleierung verzichtet wird, das heißt werden offen als solche gekennzeichnet. Sie stehen in Konflikt mit dem etablierten Ansatz, dass Placebos ohne Täuschung wirkungslos sind. Diese Annahme konnte durch jüngste Ergebnisse widerlegt werden. OLP ist längst kein theoretisches Konstrukt mehr. In verschiedenen Bereichen konnten signifikante Therapie-Erfolge durch den Einsatz von Open-Label-Placebos erreicht werden (Nestoriuc & Kleine-Borgmann, 2020). Die Wirksamkeit wurde zuerst bei ADHS (Sandler & Bodfish, 2008), später für das Reizdarmsyndrom (Kaptchuk et al., 2010) und Depression (Kelley et al., 2012) untersucht. Zuletzt erfolgten Erhebungen bei der Therapie von Migräne (Kam-Hansen et al., 2014), Rhinitis (Schaefer et al., 2016), Rückenschmerzen (Carvalho et al., 2016) und das onkologisch bedingte Fatiguesyndrom (E. S. Zhou et al., 2019). Allerdings weisen OLPs deutliche Limitationen auf. Wie von Nestoriuc und Kleine-Borgmann zusammengefasst, werden bei den oben angeführten OLP-Wirksamkeitsstudien subjektive Outcomes erfasst. Das Outcome wurde entweder in der erlebten Symptomlast oder Schmerzintensität erhoben. Beides sind subjektive Größen und somit abhängig von der Aufmerksamkeit und beeinflusst von bereits erläuterten Mechanismen. Für objektive Outcomes, wie die Geschwindigkeit von Wundheilungsprozessen konnte bisher noch keine OLP-Wirksamkeit gefunden werden (Mathur et al., 2018).
Besonders interessant ist hierbei das Feld der psychischen Störungen und insbesondere das der depressiven Störungen. Da bei Antidepressiva die Differenzen zwischen Placebo und Wirkstoffen auf der einen Seite besonders gering sind und auf der anderen Seite der durch Nebenwirkungen zusätzlich bedingte Leidensdruck für die Patienten sehr hoch ist. In Wirksamkeitsstudien erreichen Placebos bis zu 80% der Wirkung des Antidepressivums (Kelley et al., 2012), während Antidepressiva starke Nebenwirkungen aufweisen können, die insbesondere Kinde und Jugendliche belasten und gefährden (Hegerl, 2007). Das heißt bei Kindern und Jugendlichen mit depressiven Störungen ist der Bedarf an alternativen Therapie-Formen besonders hoch. Hier kann das OLP eine wertvolle Ergänzung sein. In einem Stepped-Care-Plan würde man zuerst ein OLP anwenden und erst bei Nichtansprechen auf die Psychopharmaka zurückgreifen.
2 Depressive Störungen
Depressive Erkrankungen gehören zum Spektrum der affektiven Störungen, das heißt die Betroffenen leiden unter einer pathologischen Beeinträchtigung der Gefühle und des Gemüts. Depressionen können einmalig, rezidivierend (wiederkehrend) oder persistierend (chronisch) auftreten. Im Behandlungskontext wird eine Erkrankungsphase als Episode bezeichnet, die abhängig von der Anzahl beschriebener Symptome als leicht, mittel oder schwer diagnostiziert werden kann. Die Kernmerkmale einer depressiven Episode zeichnen sich durch gedrückte Stimmung, Interessen/Freudlosigkeit und Antriebslosigkeit aus. Oftmals führen schon einfache Tätigkeiten zur Erschöpfung und belasten den Betroffenen bei der Bewältigung seines Alltags.
Treten depressive Episoden allein, das heißt ohne den Wechsel mit Manien oder Hypomanien auf, spricht man von unipolaren Depressionen. Depressive Episoden können zusätzlich auch als Teil von bipolaren Störungen vorkommen. Bipolare Störungen dagegen sind durch das Auftreten von manischen oder hypomanischen Episoden geprägt, in denen Antrieb, Aktivität und Stimmung analog zu depressiven Episoden pathologisch vermehrt beziehungsweise erhöht sind (DIMDI, 2018). In den folgenden Abschnitten wird genauer auf einzelne Schwerpunkte wie Diagnostik, Kriterien der Depression, die Auftretenswahrscheinlichkeit sowie die Therapie eingegangen. Zum besseren Verständnis des Erkrankungsbildes der Depression wird dabei zunächst auf die Diagnose bei Erwachsenen und anschließend im Kinder- und Jugendalter eingegangen.
2.1 Diagnostik
Für die Diagnose von depressiven Störungen existieren mehrere Klassifikationssysteme. Die wichtigsten Systeme sind das International Classification of Diseases Version 10 (ICD-10) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das Diagnostic and Statistial Manual of Mental Disorders Version 5 (DSM-V) der American Psychological Association (APA). Das ICD-10 gilt in Deutschland als Bezugsklassifikationssystem für Erkrankungen in allen medizinischen Bereichen. Die Erkrankungen sind in Fachbereiche unterteilt. Jeder Fachbereich ist einem Buchstaben zugeordnet. Anhand des ICD-10 werden in Kliniken und Praxen Diagnosen vergeben. Die Vergabe von Diagnosen ist zur kassenärztlichen Abrechnung notwendig.
Das DSM-V beschränkt sich im Gegensatz zum ICD-10 auf psychische Störungen. Es dient in Deutschland vorrangig Psychologen und Psychotherapeuten als Ergänzung, da es im Besonderen ätiologische und differenzialdiagnostische Zusatzinformation beinhaltet. Diese unterscheiden sich in der Gliederung und in den Diagnosekriterien für die Störungen. Den Klassifikationssystemen und dessen stetige Weiterentwicklung sind entscheidend für die Behandlung von Krankheiten. Sie entscheiden im psychiatrischen Alltag was eine Störung (und damit behandlungsbedürftig) ist und was nicht. Des Weiteren hat die tiefe der Diskrimination verschiedener Störungsarten Einfluss auf die Behandlung. Das ist deshalb wichtig, da psychische Störungen und damit auch depressive Störungen immer im historisch-gesellschaftlichen Kontext zu betrachten sind. Ab dem 1. Januar 2022 soll das ICD in der 11. Revision gültig werden. Voraussichtlich wird es mit einer fünfjährigen Übergangszeit in Deutschland eingeführt. Bis dahin werden die Diagnosekriterien des ICD-10 ihre Gültigkeit behalten, weshalb sie im Folgenden verwendet werden.
Die Diagnosekriterien des ICD-10 und damit auch die Symptome für depressive Störungen sind unterteilt in drei Hauptkriterien und sieben Nebenkriterien (DIMDI, 2018). Die Hauptkriterien sind depressive, gedrückte Stimmung; Interessenverlust und Freudlosigkeit; sowie Verminderung des Antriebs verbunden mit Aktivitätseinschränkungen. Die Nebenkriterien sind: verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit; vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen; Schuldgefühle und Gefühle der Wertlosigkeit; negative und pessimistische Zukunftsperspektiven; Suizidgedanken, Selbstverletzungs- und Suizidhandlungen; Schlafstörungen; verminderter Appetit. Für das Vorliegen einer depressiven Episode müssen mindestens zwei Hauptkriterien und mindestens zwei erfüllt sein. Die Symptome müssen durchgehend seit mindestens zwei Wochen bestehen. Wie einleitend beschrieben, wird der Schweregrad einer depressiven Episode anhand der Anzahl erfüllter Nebenkriterien bestimmt. Eine leichte depressive Episode wird vergeben, wenn mindestens zwei Nebenkriterien diagnostizierbar sind. Diese Episode wird im ICD-10 mit F32.0 kodiert. Bei drei bis vier erfüllten Nebenkriterien wird von einer mittelgradigen depressiven Episode gesprochen. Die Kodierung ist hier die F32.1. Patienten, die unter einer schweren depressiven Episode leiden, berichten von vier oder mehr Nebenkriterien. Die Kodierung erfolgt über die Angabe F32.2. Im Rahmen einer schweren Episode können auch psychotische Symptome auftreten wie Verarmungswahn, Halluzinationen oder motorische Hemmungen. Sollte diese Symptomatik feststellbar sein, erfolgt die Verschlüsselung über die Kodierung F32.3. Ist die gegenwärtige Episode nicht die erste, so handelt es sich um eine rezidivierende depressive Störung, die analog mit F33.X kodiert wird. Gab es manische Episoden in der Vergangenheit, das heißt Zeiträume, in denen der Patient beispielsweise eine gehobene Stimmung, ein reduziertes Schlafbedürfnis und übermäßigen Antrieb verspürt hat, finden die Diagnosekriterien der oben genannten unipolaren Störungen keine Anwendung. In diesem Fall liegt eine bipolare Störung vor, die mit F31.X kodiert wird. Eine anhaltende depressive Verstimmung, die die Schwere einer Depression nicht erreicht, nennt sich Dysthymie und wird im ICD-10 als F34.1 kodiert.
Grundsätzlich muss immer festgestellt werden, ob die depressiven Symptome durch somatische Erkrankungen oder Substanzmissbrauch entstanden sein könnten. Weiterer Bestandteil der Diagnostik ist dafür eine somatische Differenzialdiagnostik, um organische Ursachen für depressive Symptome auszuschließen. Für die Differenzialdiagnostik werden zusätzlich Verfahren wie das Elektroenzephalogramm (EEG), Elektrokardiogramm (EKG) Blutlabor, Computertomographie (CT) oder Magnetresonanztomographie (MRT) angewandt. Mögliche Ursachen für depressive Symptome können neben der eigentlichen depressiven Episode ein Hirntumor oder eine Demenz-Erkrankung sein. Affektive Störungen, die organisch bedingt sind, zählen nicht zu den depressiven Störungen im Sinne dieser Arbeit und werden mit F06.3 kodiert. Die Kriterien einer depressiven Episode des ICD-10 und die Kriterien für eine Major Depression im DSM-V sind sehr ähnlich (Falkai & Döpfner, 2015). Jedoch wird darauf aus oben genannten Gründen nicht weiter eingegangen.
Die eigentliche Diagnostik, das Erfassen der Symptome, erfolgt über ein ausführliches Anamnesegespräch, sowie der Erhebung von fremdanamnestischen Angaben. Zusätzlich kommen Testverfahren zum Einsatz (standardisiertes Interview oder Fragebögen). Einige psychologische Testverfahren, wie das BDI I-II (Beck Depression Inventory) oder das SKID I-II (Strukturiertes Klinisches Interview zur Diagnostik psychischer Störungen) sind auf die Kriterien des DSM-V ausgerichtet. Allerdings erfassen diese Testverfahren nur das subjektive Empfinden des Patienten und dürfen nur unterstützend eingesetzt werden. Sie eignen sich zusätzlich zur Verlaufsdiagnostik. Durch die starke Ähnlichkeit finden sie vor allem als Screening-Test Verwendung in der klinischen Praxis.
2.2 Epidemiologie
Die 12-Monats-Prävalenz, der Prozentsatz der Bevölkerung, der innerhalb eines Jahres erkrankt, liegt für depressive Störungen in Deutschland bei 7,7%. Frauen erkranken in etwa im Verhältnis 1:2 häufiger (12-Monats-Prävalenz 10,6%) als Männer (12-Monats-Prävalenz 4,8%) (F. Jacobi et al., 2014). Die Lebenszeitprävalenz liegt bei 11,6% , wobei das Risiko bis zum Renteneintrittsalter ansteigt und danach wieder abnimmt (Busch et al., 2013). Diese Prävalenzen beziehen sich auf diagnostizierte Störungen. Demzufolge ist eine höhere Dunkelziffer anzunehmen. Eine Erhebung ergab eine Punktprävalenz von 8,1%, bezogen auf den Anteil der Bevölkerung der derzeit unter klinisch relevanten depressiven Beschwerden leidet (Busch et al., 2013). Diese Werte beziehen sich dabei nur auf Erwachsene, beziehungsweise Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr.
Damit gehören depressive Störungen zu den häufigsten psychischen Störungen nach Angst- und Substanzgebrauchsstörung, weshalb der stetigen Forschung besonderes öffentliches Interesse zukommt. Unter den zehn häufigsten Diagnosen, die zu Arbeitsunfähigkeitstagen führen, haben depressive Störungen einen Anteil von 5,3% der Krankheits-Fälle. Dieser geringe Anteil führt aber zu 34,9% der gesamten Arbeitsunfähigkeitstagen (Knieps & Pfaff, 2020). Ein Patient fällt durch eine depressive Episode im Mittel 56,3 Tage aus. Bei einem depressiven Rezidiv sind es sogar 69,7% (Knieps & Pfaff, 2020). Dadurch ergibt sich auch aus wirtschaftlicher Perspektive ein gesteigertes Interesse neue Behandlungsstrategien zu entwickeln und Patienten mit depressiven Störungen besser zu versorgen.
Patienten mit depressiven Störungen weisen sehr häufig Komorbiditäten zu sowohl psychischen als auch somatischen Erkrankungen auf. Bei den psychischen Störungen liegen komorbid zu der depressiven Störung oftmals Angst- und Panikstörungen, Substanzgebrauchsstörungen und Persönlichkeitsstörungen vor (Frank Jacobi et al., 2014). Somatisch korrelieren depressive Störungen am häufigsten mit kardiovaskulären Erkrankungen, Diabetes, Krebs, Migräne, Multiple Sklerose und vor allem mit dem Fatigue-Syndrom (Scott B Patten et al., 2005). Des Weiteren stehen depressive Störungen im Verdacht einen Einfluss auf das Risiko für die Alzheimer-Krankheit zu haben (Ownby et al., 2006).
Die ätiologischen Modelle zur Pathogenese von depressiven Störungen unterscheiden grob zwischen psychogenen und endogenen Faktoren. Demnach werden psychologische und biologische Variablen zur Erklärung herangezogen. Einheitliche Modelle existieren nicht. Grundsätzlich weisen die Resilienz und Vulnerabilität von Personen gegenüber depressiven Störungen große Varianzen auf, was auf die hervorgehobene Bedeutung von genetischen Prädispositionen zurückgeführt wird (Propping, 1989). Die Verwandtschaft ersten Grades mit einem Patienten erhöht das eigene Risiko um 50% (Hammen, 2012). Annehmbar ist ein Modell, in dem auf Basis der genetischen Disposition psychosoziale Belastungen bei ausriechendem Überforderungserleben zu depressiven Störungen führt. Krankheitsfördernd wirken chronischer Stress, Trennungserleben und Verlustängste (Agid et al., 1999).
2.3 Therapie
Depressive Störungen können psychologisch und medizinisch behandelt werden. Gängig ist die kombinierte Therapie, in der sich beide Ansätze ergänzen. Psychologisch werden depressive Störungen mit Psychotherapie behandelt. Die gängigsten Therapieformen sind dabei die in Deutschland sozialrechtlich anerkannten Verfahren der kognitiven Verhaltenstherapie, die tiefenpsychologisch fundierte Therapie, die Psychoanalyse und die systemische Therapie. Die Behandlung kann ambulant, teilstationär oder stationär erfolgen. Allgemeine Elemente der Psychotherapie sind die systematische Gestaltung einer therapeutischen Beziehung, die durch psychosoziale Unterstützung wirkt, die Aktivierung von psychologischen Ressourcen, die Problemaktualisierung (vorrangig die Identifizierung von zugrundeliegenden Problemen), die Problemlösung und die Klärung von zukünftigen Motivationen (das kann die Lebensgestaltung beinhalten, wie das Auflösen von dysfunktionalen Beziehungen oder die Umgestaltungen des Alltags etc.) (DGPPN, 2015). Zusätzlich sind der psychologischen Therapie Verbesserung durch psychosoziale Unterstützung zuzuordnen.
Auf der medizinischen Ebene werden depressive Störungen vorrangig mit Psychopharmaka behandelt. Hauptsächlich kommen dabei Antidepressiva zum Einsatz. Die häufigsten Antidepressiva sind selektive-Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer (SSRI) und selektive-Serotonin / Noradrenalin-Wiederaufnahme-Hemmer (SSNRI). Die Einnahme erfolgt gewöhnlich in Tablettenform und muss über einen Zeitraum von zwei bis drei Wochen eingenommen werden, bis sich Besserung einstellt (Benkert & Hippius, 2019). Sie wirken durch Beeinflussung der Verfügbarkeit der Neurotransmitter Serotonin und Noradrenalin. Diese Neurotransmitter haben eine vorrangige Rolle für die Stimmungs- und Antriebsmodulation im Gehirn. Bei schwereren Verläufen kommen häufig Stimmungsstabilisierer wie Lithium zum Einsatz. Bei erstmaligem Auftreten von leichten depressiven Verläufen werden gelegentlich Naturheilmittel wie Johanniskraut eingesetzt. Zusätzlich werden weitere Wirkstoffklassen, wie Hypnotika, niederpotente Neuroleptika, Anxiolytika und Sedativa zur sekundären Symptombehandlung eingesetzt.
Bei Patienten mit schweren depressiven Episoden, bei denen Antidepressiva nicht oder nur unzureichend zu Besserung führen, wird die Elektrokonvulsionstherapie (EKT) angewandt. Nach der nationalen Leitlinie für unipolare Depressionen wird die Elektrokonvulsionstherapie dann in Betracht gezogen, wenn die Behandlung mit zwei Antidepressiva unterschiedlicher Wirkstoffklassen nicht den gewünschten Therapie-Erfolg erreicht (DGPPN & ÄZQ, 2015). Dabei wird das Gehirn durch Elektroden mit elektrischem Strom stimuliert. Die Stimulation löst einen generalisierten epileptischen Anfall aus. Die Anwendung erfolgt unter Vollnarkose. Das motorische Krampfgeschehen, das im letzten Jahrhundert regelmäßig schwere Verletzungen zu Folge hatte, wird durch ein Muskelrelaxans unterbunden (Grundmann & Schneider, 2013). In Deutschland wurden 2008 0,4‰ aller ambulanten depressiven Patienten und 1% aller stationären Patienten mit depressiven Störungen mit der Elektrokonvulsionstherapie behandelt (Loh et al., 2013). Die Wirkmechanismen sind noch nicht vollständig geklärt. Man geht von einer Beeinflussung des Neurotransmitter-Haushalts aus (Loh et al., 2013). Des Weiteren soll die Elektrokonvulsionstherapie die Gen-Expression beeinflussen (Singh & Kar, 2017) und die neuronalen Verbindungen einzelner Areale verändern (Perrin et al., 2012).
2.4 Effektivität
Zahlreiche Erhebungen und Meta-Analysen zeichnen ein homogenes Bild: Psychotherapie und Psychopharma-Therapie sind geeignet um depressive Störungen zu behandeln, wobei sich hinsichtlich der Effekt-Stärken beide Ansätze wenig unterscheiden (Kamenov et al., 2017). Dabei ist allerdings alleinige Psychotherapie weniger effektiv bei chronischen Verläufen (Cuijpers et al., 2011). Die Effektivität der verschiedenen Psychotherapie-Schulen unterscheidet sich nur minimal, sie eignen sich ähnlich gut zur Behandlung von depressiven Störungen (Driessen et al., 2016). Grundsätzlich ist immer die Kombination von Psychotherapie mit Psychopharma-Therapie zu bevorzugen, da in der Kombination die Therapie-Erfolge am stärksten sind (Khan et al., 2012).
Über die Wirksamkeit von Antidepressiva liegen viele Studien vor. Sie gelten im Ergebnis bei allen Schweregraden als wirkungsvoll (Furukawa et al., 2018). Meta-Analysen ergeben Responseraten von ca. 50% für Antidepressiva, jedoch auch 29% für Placebo (Walsh et al., 2002). Bei steigendem Schweregrad nimmt die Korrelation von Antidepressivum- und Placebo-Response ab (Thase, 2003). Eine Online-Umfrage von Kampermann, Nestoriuc und Kollegen (Kampermann et al., 2017) offenbarte, dass ein Großteil der Ärzte dem Placebo-Effekt und der Erwartung der Patienten große Anteile an der Wirkung von Antidepressiva zuschreiben. Die niedrigen Unterschiede in der Wirksamkeit finden sich im Groß der Studien und lassen schließen, dass die Wirksamkeit von Antidepressiva in der Praxis überschätzt wird (Pigott et al., 2010). Es gibt zusätzlich Hinweise auf Geschlechterunterschiede. Demnach scheinen Frauen besser auf Antidepressiva anzusprechen als Männer (Kokras et al., 2011).
EKT. Die Elektrokonvulsionstherapie wird wie bereits erwähnt erst eingesetzt, wenn die konventionelle Therapie nicht anschlägt. Da nur ein sehr kleiner Teil der Patienten diese Therapie-Form erhält, ist die Vergleichbarkeit von Wirksamkeitsstudien zu hinterfragen. Die Remissionsquote liegt nach Folkerts (Folkerts, 2000) bei 70% für Depressionen. Als besonders effektiv hat sich die Elektrokonvulsionstherapie allerdings für Akutsituation in Verbindung mit Suizidalität erwiesen, mit einer Remissionsquote von ca. 80% (Geddes, 2003).
2.5 Nebenwirkungen
Um diese Therapie-Möglichkeiten einordnen und um den Einsatz abwägen zu können, müssen die Nebenwirkungen berücksichtigt werden. Die Nebenwirkungen von Psychotherapie wurden in der Vergangenheit in Bezug auf die Studienlage vernachlässigt. Im Vergleich zu Psychopharmaka liegen wenige Untersuchungen vor, die sich den Nebenwirkungen von Psychotherapie widmen. Grundsätzlich führen psychotherapeutische Behandlungen wie jede Form der Behandlung zu erwünschten und zu unerwünschten Effekten. Nach Moritz, Nestoriuc und Kollegen (2019) lassen sich die Nebenwirkungen (bezogen auf die Ursache) in drei Kategorien aufteilen. Erstens die Nebenwirkungen, die bei manual- und richtlinientreuen Therapien auftreten, zweitens diese, die durch Therapeuten-Fehler entstehen und drittens solche, die durch unethisches Verhalten verursacht werden. Das Spektrum der Nebenwirkungen ist sehr breit. Möglich sind unter anderem: Symptomverstärkung, Auftreten von neuen Symptomen, Abhängigkeit zum Therapeuten, Depersonalisation, Destabilisierung, bis hin zu Missbrauch (Lilienfeld, 2007). Letzteres tritt insbesondere bei Abweichungen von Manual oder Richtlinie und beim Grenzüberschritt von Therapeuten auf (Hook & Devereux, 2018). In einer Studie gaben von 135 Personen, während oder nach einer depressiven Episode, 52,6% an Nebenwirkungen gehabt zu haben. 38,5% gaben Nebenwirkungen durch die regelrechte Therapie, 26,7% Nebenwirkungen durch Behandlungsfehler und 8,1% Nebenwirkungen durch unethische Fehlverhalten an (Moritz et al., 2019).
Antidepressiva gehen häufig mit Nebenwirkungen einher und führen oft zum Abbruch von medikamentösen Therapien bei depressiven Störungen. Die genauen Wirkungen hängen von der jeweiligen Wirkstoffklasse und letztendlich vom einzelnen Präparat ab. Zu den allgemein häufigsten Nebenwirkungen gehören Schläfrigkeit, Verdauungsstörungen, Schlafstörungen, Gewichtszunahme, Kopfschmerzen und sexuellen Funktionsstörungen (Crawford et al., 2014). Ferner können Mundtrockenheit, Obstipation, Miktions- und Sehstörungen auftreten.
Die Elektrokonvulsionstherapie gilt als schonend. Als Nebenwirkungen treten Kopfschmerzen, Muskelkater, Übelkeit und kurzzeitige Amnesien auf (Folkerts, 2011). Risiken ergeben sich für Aspirationsereignisse und kardiovaskuläre Komplikationen (Takamiya et al., 2019).
2.6 Depressive Störungen bei Kindern und Jugendlichen
Grundsätzlich gelten die o.g. Inhalte auch für Kinder und Jugendliche. Die Klassifikationssysteme aus dem Gliederungspunkt Diagnostik weisen keine gesonderten Kriterien für Minderjährige auf und auch sie werden mit Antidepressiva und Psychotherapie behandelt. Dennoch gibt es Besonderheiten hinsichtlich der Symptome, der Therapien und deren Nebenwirkungen. Depressive Störungen sind bei Kindern und Jugendlichen stark altersabhängig, treten aber in jeder Altersgruppe auf. Die Lebenszeit-Prävalenz liegt bei ca. 2,5% für Depressionen im Kindesalter und ca. 8% für Depressionen im Jugendalter (Freisleder, 2011). Das Geschlechterverhältnis beträgt analog zu Erwachsenen rund 2:1 für Mädchen gegenüber Jungen. Bei Kindern weichen die Symptome oft von denen von Erwachsenen ab. Mit steigendem Alter gleichen sich die depressive Symptomatik an.
Die Leitsymptome sind wie bei Erwachsenen gedrückte Stimmung, Interessenverlust, Freud- und Antriebslosigkeit. Zu bedenken ist, dass ein Großteil der Diagnostik üblicherweise durch Befragung und Selbstauskunft des Patienten erfolgt. Bei Kindern befindet sich die Introspektions- und Selbstwahrnehmungsfähigkeit noch in der Entwicklung, was das Erkennen von depressiven Störungen erschwert. Kinder nutzen häufig andere Wege zur Stimmungsmodulation und -expression, weshalb bei ihnen eher Symptome wie Angst, motorische Unruhe, häufiges Weinen, Schreien, histrionisches Verhalten, aggressives Verhalten, Substanzmissbrauch und sozialer Rückzug Anzeichen sein können (Mehler-Wex, 2008). Das Schreien bei Kleinkindern und aggressives Verhalten oder Substanzmissbrauch bei Kindern und Jugendlichen ist laut Quelle als Kompensationsversuch bei Frustrationen zu bewerten, ähnlich der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ. Solche Verhaltensweisen finden sich vor allem bei Jungen wieder.
Durch die diffusen Symptome bei Kindern und Jugendlichen besteht höhere Verwechslungsgefahr als bei Erwachsenen. Es kann zu symptomatischen Überschneidungen und Verwechslungen mit Anpassungsstörungen, Störung des Sozialverhaltens, Negativsymptomatik bei Schizophrenie oder Essstörungen kommen. Diese Störungen können auch komorbid bestehen. Im Kinder- und Jugendbereich können Depressionen ätiologisch die Folge von Teilleistungsstörungen oder Autismus sein. Deshalb kommt der Differenzialdiagnostik im Kinder- und Jugendbereich eine hohe Bedeutung zu. Auch bei Minderjährigen besteht die Möglichkeit von somatogenen Depressionen, die durch körperliche Beschwerden verursacht wurden. Die Therapie von depressiven Störungen bei Kindern und Jugendlichen unterscheidet sich nicht grundsätzlich von der bei Erwachsenen. Es ergeben sich aber Unterschiede bei der Wirksamkeit und bei den Nebenwirkungen.
Psychotherapie ist bei Kindern und Jugendlichen wirksam zur Verbesserung der depressiven Symptomatik. Allerdings ist die Wirksamkeit niedriger als bei vergleichbaren Störungen (Weisz et al., 2006). Interpersonelle Psychotherapie und kognitive Verhaltenstherapie sind signifikant wirksamer als andere Psychotherapieformen (X. Zhou et al., 2015).
Antidepressiva sind grundsätzlich zur Behandlung von depressiven Störungen bei Kindern und Jugendlichen geeignet. Jedoch sind die Unterschiede zwischen Wirkstoff und Placebo deutlich geringer als bei Erwachsenen (Tsapakis et al., 2008). Eine kürzlich veröffentlichte Meta-Analyse ergab, dass nur eines von vierzehn gängigen Antidepressiva wirksamer als das Placebo war. Ein Antidepressivum führte, verglichen mit dem Placebo, zu einer gefährlichen Verschlechterung (Boaden et al., 2020).
Zusammenfassend ergibt sich eine inkonsistente Studienlage zu der Wirksamkeit von Antidepressiva bei Kindern und Jugendlichen mit depressiven Störungen. Konsistenz besteht hingegen bei den, im Vergleich zu Wirksamkeitsstudien bei Erwachsenen, geringeren Differenzen zwischen Effektstärken von Wirkstoffen und Placebo. Kritisch anzumerken ist die Zunahme an Suizidalität unter der Einnahme von Antidepressiva bei Kindern und Jugendlichen (Julious, 2013). Insgesamt weisen die Studien daraufhin, dass Antidepressiva des Typs SSRI bei Kindern und Jugendlichen besondere Gefahr der Förderung von selbst- und fremdgefährdeten Verhalten bergen. Im Vergleich zeigen Placebos diesbezüglich deutliche Unterschiede auf. Das Risiko wird bei Placebos in einem deutlich niedrigeren Maße beeinflussten (Holtmann et al., 2006).
Die Studienlage zur Wirksamkeit der Elektrokonvulsionstherapie ist unzureichend. Die EKT wird aufgrund der Nebenwirkungen und Gefahren bei Kindern in Deutschland nicht angewandt. Bei Jugendlichen steht sie in schweren Fällen zur Verfügung. Ihr Einsatz sollte scharf abgewogen werden (DGKJP, 2013).
3 Methode
Diese Übersichtsarbeit wurde angelehnt an das PRISMA-Statement für systematische Übersichtsarbeiten (Liberati et al., 2009) durchgeführt. Hierbei fanden die jüngsten Wirksamkeitsstudien, systematische Übersichtsarbeiten und Meta-Analysen ab 1970 bis zum 15. Dezember 2020 Berücksichtigung. Das Ziel war den aktuellen Stand zum Thema Placebo-Effekte bei Kindern und Jugendlichen einzufangen und mögliche Variablen zu finden, die die Placebo-Effekte erklären könnten. Für die Aufnahme in die Betrachtung mussten die Quellen Kinder und Jugendliche untersuchen, die an depressiven Störungen leiden. Korrespondenzen wie Letter-to-the-Editor wurden ausgeschlossen. Als weiteres Einschlusskriterium durfte das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet sein. Weiterhin mussten die depressiven Störungen nach den Klassifikationssystemen ICD-10 oder DSM-V, bei älteren Quellen dem Vorgänger DSM-IV oder DSM-III, diagnostiziert sein. Eingeschlossen wurden unipolare depressive Episoden, deren Verlauf leicht (F32.0), mittelgradig (F32.1), schwer (F32.2) oder schwer mit psychotischen Symptomen (F32.3) war. Sonstige depressive Episoden (F32.8) und depressive Episoden, nicht näher bezeichnet (F33.9) wurden ebenfalls berücksichtigt. Darüber hinaus fanden rezidivierende depressive Störungen mit gegenwärtig leichten (F33.0), mittelgradigen (F33.1), schweren (F33.2) oder schweren Verlauf mit psychotischen Symptomen (F33.3) Beachtung. Ebenso gültig war die Diagnose Major Depression nach dem DSM. Bipolare Störungen und Dysthymien wurden exkludiert. Es wurden Studien unabhängig der Untersuchungsdauer und ohne den Ausschluss von zusätzlich diagnostizierten Komorbiditäten aufgenommen. Zudem musste der therapeutische Abschnitt Placebo-Interventionen beinhalten.
Recherchiert wurde in den Datenbanken MEDLINE, PsycINFO, Psyndex, Psychology and Behavioural Sciences Collection. Die Suche in den Datenbanken wurde durch die Suche in der Universitätsbibliothek der Helmut-Schmidt-Universität ergänzt. Gesucht wurde anhand der Suchwörter „placebo“ OR „placebo-effect“ AND „children“ OR „adolescents“ OR „juveniles“ AND „depression“ OR „depressive disorders“.
Nach einer Bereinigung der Duplikate wurde die Vorauswahl anhand der Titel getroffen. Die Abstracts der Studien, die die bisher genannte Kriterien in der Überschrift erfüllten, wurden auf den Inhalt geprüft. Anschließend ist der Volltext der übrig gebliebenen Studien begutachtet worden. Nach der Exklusion aller irrelevanter Quellen erfolgte die Sichtung der Literaturverzeichnisse der noch vorhandenen Arbeiten mit dem Ziel weitere, bisher nicht recherchierte Studien ausfindig zu machen und ebenfalls einer Prüfung zu unterziehen. Redundanzen, wie Wirksamkeitsstudien, dessen Ergebnisse in bereits aufgenommenen Meta-Analysen eingegangen sind, wurden entfernt.
Die häufigsten Exklusionsgründe waren unpassende Stichproben (Einbezug oder Betrachtung von Erwachsenen), unpassende Diagnosen, unzureichende oder nebensächliche Betrachtung der Placebo-Bedingung, Redundanzen der Quellen und Korrespondenzen, die in der Vorauswahl nicht als solche erkannt wurden. Anschließend wurden die wichtigsten Merkmale extrahiert. Diese umfassten das Publikationsjahr, die Intervention, mit der das Placebo verglichen wurde, die angewandten Diagnosekriterien, Stichprobengröße (bei Meta-Analysen wurden die Stichprobengrößen der betrachteten Studien kumuliert, um einen Indikator für die Aussagekräftigkeit zu gewinnen), Placebo-Response-Rate versus die Interventions-Response-Rate. Ein weiterer Fokus wurde auf die Kernaussagen hinsichtlich des Placebos, beziehungsweise dessen Wirksamkeit und eventuell angegebene Variablen, die den Placebo-Effekt beeinflusst haben könnten, gelegt.
Das Ziel der ausführlichen Analyse aller gefundenen Studien ist die Abbildung der externen Evidenz, das heißt die aktuelle Bedeutung des Placebo-Effektes innerhalb der Therapie von Kindern und Jugendlichen bei Depressionen, sowie dessen Wirkung auf den Therapieerfolg abzubilden. Zudem wird herausgearbeitet, ob und welche Variablen es gibt, die den Placebo-Effekt beeinflussen. Daraus resultierend wird abgeleitet, welche Implikationen sich aus den jüngsten Ergebnissen für die Diagnostik von depressiven Störungen im Kinder- und Jugendbereich derivieren und wie sich Placebo-Effekte in der Behandlung von Depressionen bei Kindern und Jugendlichen einsetzen lassen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1. Auswahlprozess der Studien in die systematische Übersichtsarbeit, in Anlehnung an das PRISMA-Statement (Liberati et al., 2009).
Tabelle 1 Merkmale der aufgenommenen Studien
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4 Ergebnisse
Die betrachteten Studien in Tabelle 1 ergeben ein überwiegend konsistentes Bild. In den meisten Studien finden sich wenig bis keine Unterschiede zwischen der Wirksamkeit von Placebo und anderen Interventionen wie Antidepressiva oder Psychotherapie. Die Größenordnungen von auftretenden Placebo-Effekten bei Kindern und Jugendlichen führen zur Einstufung, dass die meisten Antidepressiva als ungenügend wirksam bei Kindern und Jugendlichen sind, obwohl diese in der Regel als wirksam bei Erwachsenen gelten. Lediglich als einziges Antidepressivum stellt sich Fluoxetin heraus, dass mehrfach signifikante Ergebnisse gegenüber Placebo bringen konnte. Dem gegenüber steht Venlafaxin, das zum Teil sogar zu symptomatischen Verschlechterungen führte (Boaden et al., 2020). Dennoch führen in der Regel alle Intervention inklusive Placebo zu einer signifikanten Verbesserung der Symptomatik. Nach wie vor unklar sind die Mechanismen hinter dieser Verbesserung. Cohen (2007) und Cohen et al. (2008) erklären die Wirksamkeit von Placebos mit der unwillentlichen Entstehung von therapeutischen Dynamiken. Den bisherigen Studien fehlt es fast gänzlich an einer Warteliste um die Spontanremission und die allgemeine, natürliche Verbesserung der Störung zu erfassen. Das Fehlen einer Warteliste wird mit ethischen Problemen begründet (Meister et al., 2020). Ist eine Warteliste-Kontrollgruppe neben einer Placebo-Kontrollgruppe enthalten, dann ist die Warteliste dem Placebo signifikant unterlegen (X. Zhou et al., 2015). Das würde jedoch grundsätzlich nicht gegen die Verwendung sprechen. Allerdings ergaben mehrere Studien eine zum Teil schlechte Verträglichkeit von Antidepressiva durch Kinder und Jugendliche (Boaden et al., 2020). So weisen Antidepressiva signifikant mehr Nebenwirkungen und Suizid assoziierte Vorkommnisse, als Placebos auf (Dubicka et al., 2006).
Die Differenz der Response-Raten von Placebo und vergleichenden Interventionen liegt mit geringen Unterschieden bei 10 Prozentpunkten, bei gleichzeitig ähnlichen Effekt-Stärken. Die Annahme, dass die Placebo-Response-Raten mit dem Alter der Studie korrelieren (Li et al., 2019), lässt sich anhand der vorliegenden Studienlage nicht bestätigen. Hohe Placebo-Response-Raten treten in allen Jahren auf. Auffällig ist, dass Placebo-Effekt tendenziell stärker bei Kindern auftreten, als bei Jugendlichen (Emslie, 2009). Jüngere Kinder sprechen besser auf Placebos an, als ältere Kinder (Donnelly et al., 2006). Eine mögliche Erklärung dafür könnte die höhere Suggestibilität von jüngeren Kindern sein (Parellada et al., 2012). Abweichend von den grundsätzlich hohen Placebo-Response-Raten fanden Meister et al. (2020) einen Unterschied zwischen der Fremd- und der Selbstbeurteilung. Wurden die Erfolge durch Selbstbeurteilung erfasst, dann fielen die Placebo-Effekte geringer aus, als wenn sie fremd beurteilt wurden.
Es wurden Variablen identifiziert, die Placebo-Effekte bei Kindern und Jugendlichen mit depressiven Störungen potenziell beeinflussen. Die am häufigsten angeführte Variable ist die Anzahl der Studienorte, wonach die Zahl an Untersuchungszentren einer Untersuchung positiv mit den Placebo-Response-Raten in den Ergebnissen korreliert, während die Response-Rate der vergleichenden Intervention nicht davon abhängt (Findling et al., 2020). Dieser Zusammenhang wird von den Autoren unterschiedlich erklärt. Studien werden unübersichtlicher, wenn die Zahl der beteiligten Orte wächst. Das führt zu größerem Personalbedarf. Je mehr Personal beteiligt ist, desto größer ist der individuelle Einfluss der beteiligten Mitarbeiter, wodurch die Rekrutierung heterogener werden kann (Walkup, 2017) und unsystematisch wird (Tsapakis et al., 2008). Gleichzeitig kann der höhere Personalbedarf zur Einbeziehung von unterqualifiziertem Personal zwingen (Parellada et al., 2012). Dadurch könnten Kinder und Jugendliche rekrutiert werden, die die Inklusionskriterien nicht ausreichend erfüllen oder bei der späteren Studie werden Symptome übersehen und als alterstypisches Verhalten fehlinterpretiert (Findling et al., 2020). Da wiederum würde die Stichprobe weniger repräsentativ werden lassen und zu höheren Placebo-Responsen führen (Parellada et al., 2012). Als zweithäufigste Variable wurde der anfängliche Schweregrad der Depression angegeben (Emslie, 2009). Die Schwere der depressiven Symptome korreliert dabei negativ mit dem auftretenden Placebo-Effekt. Das Familieneinkommen, beziehungsweise der soziale Hintergrund wurde zusätzlich als potenziell beeinflussende Variable identifiziert (Hussain et al., 2018). Demnach scheinen diese Variablen Placebo-Effekte zu begünstigen. Des Weiteren fanden Rutherford und Kollegen einen Zusammenhang zwischen der Häufigkeit von therapeutischen Kontakten, bei dem die Anzahl der Kontakte und der Placebo-Effekt positiv korrelieren (2011). Die Häufigkeit der Kontakte beeinflusst die Placebo-Effekte von Jugendlichen stärker als die von Kindern. Findling et al. (2020) konnten die Häufigkeit der Kontakte als beeinflussende Variable in diesem Jahr unterstützen.
Rutherford und Kollegen (2011) postulieren, dass die Erwartung und damit der Erklärungsansatz der Erwartungstheorie bei Kindern und Jugendlichen weniger Einfluss auf auftretende Placebo-Effekte hat, als bei Erwachsenen. Als mögliche Gründe führen sie an, dass zum einen Kinder und Jugendliche mit sinkendem Alter weniger Informationen und Aufklärung über ihre eigene Therapie erhalten und sich somit weniger Therapie-Erwartungen einstellen können. Zum anderen könnte aber der entwicklungsbedingte Mangel an kognitiven Fähigkeiten dafür verantwortlich sein, dass die Patienten die erhaltenen Informationen nicht in der gleichen Tiefe wie Erwachsene verarbeiten und sich so weniger Erwartungshaltung aufbaut.
5 Forschungsperspektiven
Der Einsatz von Antidepressiva in der Behandlung von Kindern und Jugendlichen wurde bisher sehr umfangreich untersucht. Als ein weiterer Behandlungsansatz kann die Psychotherapie dienen. Jedoch scheinen auch bei dieser Behandlungsform Nebenwirkungen weit verbreitet zu sein (Moritz et al., 2019). Allerdings bedarf es hier weiterer Untersuchungen. In Hinblick auf die breite Anwendung von Psychotherapie sind die Ergebnisse über ihre Nebenwirkungen unbefriedigend.
Das Placebo ist Bestandteil unzähliger Wirksamkeitsstudien und obwohl mehrere Meta-Analysen und Übersichtsarbeiten zu Placebo-Effekten bei besagten Wirksamkeitsstudien existieren, war Placebo bisher kaum Gegenstand eigener Forschung zu Placebo-Effekten. Placebo-Effekte und deren Erkenntnisse im Kontext depressiver Störungen bei Kindern und Jugendlichen waren bisher ein Nebenprodukt bei der Untersuchung anderer Interventionen. Forschung zur hauptsächlichen Untersuchung des Placebo-Effekts ist weiterhin nötig. Zudem lässt sich die Übertragung von Erkenntnissen aus dem Erwachsenenbereich auf den Kinder- und Jugendbereich anzweifeln, da die deutlichen Response-Unterschiede zwischen diesen Altersklassen eine herausragende Bedeutung von psychologischen Unterschieden und Entwicklungsunterschieden vermuten lassen (Parellada et al., 2012). Die Erkenntnisse über bisherige, identifizierte Variablen für Placebo-Effekte müssen zukünftig validiert werden.
Des Weiteren muss weitere Forschung zur Erklärung der Wirkmechanismen erfolgen. Grundsätzlich gilt die Erwartungshaltung als wichtigste Bedingung für die Wirksamkeit eines Placebos. Dennoch ist im Kinder- und Jugendbereich von einem großen Einfluss des Placebo-by-proxy auszugehen. Bisher gibt es keine empirischen Befunde zum Placebo-by-proxy bei Kindern und Jugendlichen mit depressiven Störungen. Erkenntnisse über die Unterschiede des Einflusses von Erwartungshaltung und Placebo-by-proxy würden nicht nur zum Verständnis beitragen, sondern die Anwendung von Placebos in einem therapeutischen Setting an die Besonderheiten von Kindern und Jugendlichen anpassen. Zusätzlich sind weitere Untersuchungen der individuellen Variablen zur Entstehung und zur Beeinflussung von Placebo-Effekten bei Kindern und Jugendlichen notwendig. Betrachtet werden sollte hier neben den bereits genannten Gegenständen der Einfluss der Peers, wie Mitpatienten, an der Erwartungshaltung. Ebenso wie der Einfluss von medizinischer Vorerfahrung, Bildungsgrad und sozialem Stand. Insbesondere bei letzterem gibt es bereits Hinweise auf dessen Bedeutung. Unterschiede sind möglich hinsichtlich des Geschlechts und der Nachhaltigkeit. So schreiben Oeltjenbruns und Schäfer (2008) von der Tendenz, dass klassische Konditionierung besser bei Frauen als bei Männern funktioniert. Im Gegensatz scheint Suggestion bei Männern wirksamer zu sein als bei Frauen. Außerdem seien wohl konditionierungsbedingte Placebo-Effekte nachhaltiger. Allerdings muss hier auf die immer noch unzureichende Studienlage hingewiesen werden, weshalb es sich ausdrücklich um mögliche Tendenzen handelt.
Die Erkenntnisse aus dieser Arbeit lassen den Bedarf an schonenderen Therapien für Kinder und Jugendliche mit depressiven Störungen erkennen. Die sehr hohe Wirksamkeit von Placebos in Verbindung mit signifikant weniger Nebenwirkungen lassen eine hohe Wirksamkeit von Open-Label-Placebos bei Kindern und Jugendlichen vermuten. Die Hinweise, dass eine Warteliste einer Placebo-Bedingung signifikant unterlegen ist (X. Zhou et al., 2015), unterstützt die Vermutung, dass Placebos eine eigene therapeutische Bedeutung zuzuschreiben ist. Insbesondere bei Kindern und Jugendlichen mit depressiven Störungen, da hier die Placebo-Wirksamkeit regelmäßig höher ausfällt, als bei anderen Internalisierungsstörungen wie Zwangs- und Angststörungen (Cohen et al., 2008). Insofern könnten Placebos in Zukunft als eigene Therapie nützlicher sein, anstatt diese nur als Kontrollvariable zu nutzen. Wirksamkeitsstudien zu Open-Label-Placebos bei Kindern und Jugendlichen sind daher dringend indiziert. Aktuelle OLP-Studien weisen die Tendenz auf, dass die Wirkung von OLP auf subjektive Störungen limitiert ist (Nestoriuc & Kleine-Borgmann, 2020). Ob sich die Wirksamkeit von OLP für objektive, betont somatische Krankheits- und Störungsbilder grundsätzlich ausschließt, muss Gegenstand zukünftiger Forschung werden.
6 Diskussion
Die vorliegende Übersichtsarbeit knüpft an bereits publizierte Meta-Analysen und Übersichtsarbeiten an. Da relevante Studien bis Dezember 2020 aufgenommen wurden, stellt diese Arbeit den derzeitig aktuellen Stand dar und berücksichtigt die jüngsten Erkenntnisse des Forschungsjahres 2020. Die überwiegenden Ergebnisse basieren auf Wirksamkeitsstudien. Dieser Umstand kann die Generalisierbarkeit der Placebo-Befunde auf andere Settings wie die Open-label Anwendung mindern. Dennoch sind die Ergebnisse relevant für zukünftige Studien.
In den meisten Studien finden sich wenig bis keine Unterschiede zwischen der Wirksamkeit von Placebo und anderen Interventionen wie Antidepressiva oder Psychotherapie. Daraus folgt, dass Placebo-Effekte eine wichtige Rolle bei Kindern und Jugendlichen mit depressiven Störungen in erheblichen Ausmaßen spielen. Es liegt die Vermutung nahe, dass die Wirkung von Antidepressiva und anderen Medikamenten auf den gleichen Mechanismen beruht wie die des Placebo-Effekts. Die Erkenntnisse lassen nicht nur Implikationen für das Placebo schlussfolgern. Gerade die Erkenntnisse über die Wirkmechanismen haben gezeigt, dass die Wirkung eines klassischen Medikaments nicht nur durch die Pharmakodynamik gegeben ist. So konnte zum Beispiel Levine bereits 1981 zeigen, dass ein vor dem Patienten injiziertes Placebo, in dem Fall Kochsalzlösung, genauso stark Schmerzen reduzieren konnte wie 4-8 mg Morphin, welches verdeckt verabreicht wurde (J. D. Levine et al., 1981). Aus solchen und ähnlichen Ergebnissen lässt sich ableiten, wie wichtig die umfangreiche Aufklärung eines Patienten über seine Medikation ist. Das Aufklären über die Wirkung und den Zweck eines Medikaments scheinen demnach erheblich den Therapie-Erfolg zu erhöhen (Benedetti & Colloca, 2005).
Die Wirksamkeitsunterschiede von Placebos und Interventionen zwischen dem Erwachsenbereich und dem Kinder- und Jugendbereich könnten auch auf eine unterschiedliche Biologie zurückgehen (Parellada et al., 2012). Von diesen Erkenntnissen ausgehend setzt der Einsatz von Antidepressiva Kinder und Jugendliche unnötigen Risiken und Gefahren aus. Deshalb sehen die meisten Autoren das Therapie-Potential von Antidepressiva nur als Second-Line-Behandlung, falls alle anderen Möglichkeiten erschöpft sein sollten. Die Perspektive Open-Label-Placebos als Erstversorgung für Kinder und Jugendliche mit depressiven Störungen einzusetzen und erst auf Antidepressiva bei Fehlschlagen aller verfügbaren Interventionen zurückzugreifen, ist vielversprechend. Neben der Open-label Anwendung von Placebo ist es grundsätzlich denkbar eine medikamentöse Therapie mit Placebo zu ergänzen. Bei längerer Einnahme würden nach und nach die Wirkstoffe durch Placebos ersetzt werden. Allerdings sind dafür gegenwärtig die ethischen und praktischen Hürden zu groß. Der Einsatz von Antidepressiva stellt zum Zeitpunkt dieser Arbeit nicht nur ein unnötiges Risiko für Kinder und Jugendliche da, es sei auch verwiesen auf die möglichen Folgen und Komorbiditäten, die durch die Nebenwirkungen entstehen könnten. Sexuelle Funktionsstörungen bei Personen, die sich gerade in der sexuellen Entwicklung befinden oder die deutliche Gewichtszunahme in kritischen Altersspannen könnten selbst zu Internalisierungsstörungen führen. Vor diesem Hintergrund ist die Erforschung schonenderer Therapie-Alternativen notwendig. Dem Open-label-Placebo ist das größte Potenzial zuzuordnen. Die Durchführung von OLP-Wirksamkeitsstudien und die eventuelle Aufnahme in Behandlungsleitlinien von Kinder- und Jugendpsychiatrien sollten die zukünftigen Ziele sein.
Literaturverzeichnis
Agid, O., Shapira, B., Zislin, J., Ritsner, M., Hanin, B., Murad, H., Troudart, T., Bloch, M., Heresco-Levy, U. & Lerer, B. (1999). Environment and vulnerability to major psychiatric illness: a case control study of early parental loss in major depression, bipolar disorder and schizophrenia. Molecular psychiatry, 4 (2), 163–172. https://doi.org/10.1038/sj.mp.4000473
Aigner, C. & Svanum, S. (2014). Motivation and expectancy influences in placebo responding: The mediating role of attention. International Journal of Psychology. Vorab-Onlinepublikation. https://doi.org/10.1002/ijop.12072
Amanzio, M. & Benedetti, F. (1999). Neuropharmacological Dissection of Placebo Analgesia: Expectation-Activated Opioid Systems versus Conditioning-Activated Specific Subsystems. The Journal of Neuroscience, 19 (1), 484–494. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.19-01-00484.1999
Ambrosini, P. J. (2000). A review of pharmacotherapy of major depression in children and adolescents. Psychiatric services (Washington, D.C.), 51 (5), 627–633. https://doi.org/10.1176/appi.ps.51.5.627
Barsky, A. J., Saintfort, R., Rogers, M. P. & Borus, J. F. (2002). Nonspecific medication side effects and the nocebo phenomenon. JAMA, 287 (5), 622–627. https://doi.org/10.1001/jama.287.5.622
Benedetti, F. (2014). Placebo effects (2. ed.). Oxford Univ. Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198705086.001.0001
Benedetti, F. & Colloca, L. (2005). Placebos and painkillers: is mind as real as matter? NATURE REVIEWS (6).
Benedetti, F., Mayberg, H. S., Wager, T. D., Stohler, C. S. & Zubieta, J.‑K. (2005). Neurobiological mechanisms of the placebo effect. The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 25 (45), 10390–10402. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.3458-05.2005
Benkert, O. & Hippius, H. (2019). Kompendium der Psychiatrischen Pharmakotherapie. Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-57334-1
Berk, M., Mohebbi, M., Dean, O. M., Cotton, S. M., Chanen, A. M., Dodd, S., Ratheesh, A., Amminger, G. P., Phelan, M., Weller, A., Mackinnon, A., Giorlando, F., Baird, S., Incerti, L., Brodie, R. E., Ferguson, N. O., Rice, S., Schäfer, M. R., Mullen, E., . . . Davey, C. G. (2020). Youth Depression Alleviation with Anti-inflammatory Agents (YoDA-A): a randomised clinical trial of rosuvastatin and aspirin. BMC medicine, 18 (1), 16. https://doi.org/10.1186/s12916-019-1475-6
Boaden, K., Tomlinson, A., Cortese, S. & Cipriani, A [Andrea] (2020). Antidepressants in Children and Adolescents: Meta-Review of Efficacy, Tolerability and Suicidality in Acute Treatment. Frontiers in psychiatry, 11, 717. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.00717
Bondar, J., Caye, A., Chekroud, A. M. & Kieling, C. (2020). Symptom clusters in adolescent depression and differential response to treatment: a secondary analysis of the Treatment for Adolescents with Depression Study randomised trial. The Lancet Psychiatry, 7 (4), 337–343. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30060-2
Boylan, K., Romero, S. & Birmaher, B. (2007). Psychopharmacologic treatment of pediatric major depressive disorder. Psychopharmacology, 191 (1), 27–38. https://doi.org/10.1007/s00213-006-0442-z
Bridge, J. A., Birmaher, B., Iyengar, S., Barbe, R. P. & Brent, D. A. (2009). Placebo response in randomized controlled trials of antidepressants for pediatric major depressive disorder. The American Journal of Psychiatry, 166 (1), 42–49. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2008.08020247
Busch, M. A [M. A.], Maske, U. E., Ryl, L., Schlack, R. & Hapke, U [U.] (2013). Prävalenz von depressiver Symptomatik und diagnostizierter Depression bei Erwachsenen in Deutschland. Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz, 56 (5-6), 733–739. https://doi.org/10.1007/s00103-013-1688-3
Carandang, C., Jabbal, R., Macbride, A. & Elbe, D. (2011). A review of escitalopram and citalopram in child and adolescent depression. Journal of the Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry = Journal de l'Academie canadienne de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, 20 (4), 315–324.
Carvalho, C., Caetano, J. M., Cunha, L., Rebouta, P., Kaptchuk, T. J. & Kirsch, I. (2016). Open-label placebo treatment in chronic low back pain: a randomized controlled trial. Pain, 157 (12), 2766–2772. https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000000700
Cipriani, A [Andrea], Zhou, X., Del Giovane, C., Hetrick, S. E., Qin, B., Whittington, C., Coghill, D., Zhang, Y., Hazell, P., Leucht, S [Stefan], Cuijpers, P [Pim], Pu, J., Cohen, D., Ravindran, A. V., Liu, Y., Michael, K. D., Yang, L., Liu, L. & Xie, P. (2016). Comparative efficacy and tolerability of antidepressants for major depressive disorder in children and adolescents: a network meta-analysis. The Lancet, 388 (10047), 881–890. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)30385-3
Cohen, D. (2007). Should the use of selective serotonin reuptake inhibitors in child and adolescent depression be banned? Psychotherapy and psychosomatics, 76 (1), 5–14. https://doi.org/10.1159/000096360
Cohen, D., Deniau, E., Maturana, A., Tanguy, M.‑L., Bodeau, N., Labelle, R., Breton, J.‑J. & Guile, J.‑M. (2008). Are child and adolescent responses to placebo higher in major depression than in anxiety disorders? A systematic review of placebo-controlled trials. PloS one, 3 (7), e2632. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0002632
Crawford, A. A., Lewis, S., Nutt, D., Peters, T. J., Cowen, P., O'Donovan, M. C., Wiles, N. & Lewis, G. (2014). Adverse effects from antidepressant treatment: randomised controlled trial of 601 depressed individuals. Psychopharmacology, 231 (15), 2921–2931. https://doi.org/10.1007/s00213-014-3467-8
Cuijpers, P [Pim], Andersson, G., Donker, T. & van Straten, A. (2011). Psychological treatment of depression: results of a series of meta-analyses. Nordic journal of psychiatry, 65 (6), 354–364. https://doi.org/10.3109/08039488.2011.596570
Czerniak, E., Oberlander, T. F., Weimer, K., Kossowsky, J. & Enck, P. (2020). "Placebo by Proxy" and "Nocebo by Proxy" in Children: A Review of Parents' Role in Treatment Outcomes. Frontiers in psychiatry, 11, 169. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.00169
Dardas, L. A. (2019). Family functioning moderates the impact of depression treatment on adolescents' suicidal ideations. Child and adolescent mental health, 24 (3), 251–258. https://doi.org/10.1111/camh.12323
Deutsche Gesellschaft Für Psychiatrie, Psychotherapie Und Nervenheilkunde & Ärztliches Zentrum Für Qualität In Der Medizin. (2015). S3-Leitlinie/Nationale VersorgungsLeitlinie Unipolare Depression - Langfassung, 2. Auflage. Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN); Bundesärztekammer (BÄK); Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV); Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF). https://doi.org/10.6101/AZQ/000364
DIMDI. (2018). ICD-10-GM Systematisches Verzeichnis. Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information.
Donnelly, C. L., Wagner, K. D., Rynn, M., Ambrosini, P., Landau, P., Yang, R. & Wohlberg, C. J. (2006). Sertraline in children and adolescents with major depressive disorder. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 45 (10), 1162–1170. https://doi.org/10.1097/01.chi.0000233204.51050.f0
Driessen, E., Smits, N., Dekker, J. J. M., Peen, J., Don, F. J., Kool, S., Westra, D., Hendriksen, M., Cuijpers, P [P.] & Van, H. L. (2016). Differential efficacy of cognitive behavioral therapy and psychodynamic therapy for major depression: a study of prescriptive factors. Psychological medicine, 46 (4), 731–744. https://doi.org/10.1017/S0033291715001853
Dubicka, B., Hadley, S. & Roberts, C. (2006). Suicidal behaviour in youths with depression treated with new-generation antidepressants: meta-analysis. British Journal of Psychiatry, 189, 393–398. https://doi.org/10.1192/bjp.bp.105.011833
Emanuel, E. J [E. J.] & Miller, F. G [F. G.] (2001). The ethics of placebo-controlled trials--a middle ground. The New England journal of medicine, 345 (12), 915–919. https://doi.org/10.1056/NEJM200109203451211
Emslie, G. J. (2009). Understanding placebo response in pediatric depression trials. The American Journal of Psychiatry, 166 (1), 1–3. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2008.08101541
Falkai, P. & Döpfner, M. (2015). Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen – DSM-5 ®. Hogrefe. http://sub-hh.ciando.com/book/?bok_id=1792418
Fässler, M., Meissner, K., Schneider, A. & Linde, K. (2010). Frequency and circumstances of placebo use in clinical practice--a systematic review of empirical studies. BMC medicine, 8, 15. https://doi.org/10.1186/1741-7015-8-15
Findling, R. L., McCusker, E. & Strawn, J. R. (2020). A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial of Vilazodone in Children and Adolescents with Major Depressive Disorder with Twenty-Six-Week Open-Label Follow-Up. Journal of child and adolescent psychopharmacology, 30 (6), 355–365. https://doi.org/10.1089/cap.2019.0176
Fisk, J., Khalid, S., Reynolds, S. A. & Williams, C. M. (2020). Effect of 4 weeks daily wild blueberry supplementation on symptoms of depression in adolescents. The British journal of nutrition, 1–8. https://doi.org/10.1017/S0007114520000926
Folkerts, H. W. (2000). Elektrokrampftherapie bei depressiven Erkrankungen. Ther Umsch (57), 90–94.
Folkerts, H. W. (2011). Elektrokrampftherapie. Indikation, Durchführung und Behandlungsergebnisse [Electroconvulsive therapy. Indications, procedure and treatment results]. Der Nervenarzt, 82 (1), 93-102, quiz 103. https://doi.org/10.1007/s00115-010-3130-5
Freisleder, F. J. (2011). Sie ist immer so traurig: Depression bei Kindern und Jugendlichen. MMW - Fortschritte der Medizin, 153 (14), 37–40.
Furnham, A. F. (2010). Der Placebo-Effekt. In A. F. Furnham (Hg.), 50 Schlüsselideen Psychologie (S. 8–11). Spektrum Akademischer Verlag.
Furukawa, T. A., Maruo, K., Noma, H., Tanaka, S., Imai, H., Shinohara, K., Ikeda, K., Yamawaki, S., Levine, S. Z., Goldberg, Y., Leucht, S [S.] & Cipriani, A [A.] (2018). Initial severity of major depression and efficacy of new generation antidepressants: individual participant data meta-analysis. Acta Psychiatrica Scandinavica, 137 (6), 450–458. https://doi.org/10.1111/acps.12886
Geddes, J. (2003). Efficacy and safety of electroconvulsive therapy in depressive disorders: a systematic review and meta-analysis. The Lancet, 361 (9360), 799–808. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(03)12705-5
Gelfand, D. M., Gelfand, S. & Rardin, M. W. (1965). Some personality factors associated with placebo responsivity. Psychological Reports. Vorab-Onlinepublikation. https://doi.org/10.2466/pr0.1965.17.2.555
Grelotti, D. J. & Kaptchuk, T. J. (2011). Placebo by proxy. BMJ (Clinical research ed.), 343, d4345. https://doi.org/10.1136/bmj.d4345
Grundmann, U. & Schneider, S. O. (2013). Narkose zur Elektrokrampftherapie [Anesthesia for electroconvulsive therapy]. Der Anaesthesist, 62 (4), 311–322. https://doi.org/10.1007/s00101-013-2152-3
Hammen, C. L. (2012). Depression runs in families: The social context of risk and resilience in children of depressed mothers. Series in psychopathology. Springer-Verlag.
Hegerl, U. (2007). Antidepressiva und Suizidalität. Nutzen-Risiko-Abschätzung [Antidepressants and suicidality. Risk-benefit analysis]. Der Nervenarzt, 78 (1), 7–14. https://doi.org/10.1007/s00115-006-2109-8
Herrnstein, R. J. (1962). Placebo effect in the rat. Science, 138 (3541), 677–678. https://doi.org/10.1126/science.138.3541.677
Holtmann, M., Bölte, S. & Poustka, F. (2006). Suizidalität bei depressiven Kindern und Jugendlichen unter Behandlung mit selektiven Serotoninwiederaufnahmehemmern. Review und Metaanalyse verfügbarer plazebokontrollierter Doppelblindstudien: Suicidality in depressive children and adolescents during treatment with selective serotonin reuptake inhibitors. Review and meta-analysis of the available randomised, placebo controlled trials [Suicidality in depressive children and adolescents during treatment with selective serotonin reuptake inhibitors. Review and meta-analysis of the available randomised, placebo controlled trials]. Der Nervenarzt, 77 (11), 1332–1337. https://doi.org/10.1007/s00115-005-1952-3
Hook, J. & Devereux, D. (2018). Boundary violations in therapy: the patient's experience of harm. BJPsych Advances, 24 (6), 366–373. https://doi.org/10.1192/bja.2018.26
Hrobjartsson, A. (1996). The uncontrollable placebo effect. European Journal of Clinical Pharmacology (50), 345–348.
Hussain, H., Dubicka, B. & Wilkinson, P. (2018). Recent developments in the treatment of major depressive disorder in children and adolescents. Evidence-based mental health, 21 (3), 101–106. https://doi.org/10.1136/eb-2018-102937
Isa, A., Bernstein, I., Trivedi, M., Mayes, T., Kennard, B. & Emslie, G. (2017). Understanding the Impact of Treatment on the Dimensions of Childhood Depression. Journal of child and adolescent psychopharmacology, 27 (2), 160–166. https://doi.org/10.1089/cap.2015.0023
Jacobi, F [F.], Höfler, M [M.], Strehle, J., Mack, S [S.], Gerschler, A [A.], Scholl, L [L.], Busch, M. A [M. A.], Maske, U., Hapke, U [U.], Gaebel, W [W.], Maier, W [W.], Wagner, M [M.], Zielasek, J [J.] & Wittchen, H.‑U [H-U] (2014). Psychische Störungen in der Allgemeinbevölkerung : Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland und ihr Zusatzmodul Psychische Gesundheit (DEGS1-MH) [Mental disorders in the general population : Study on the health of adults in Germany and the additional module mental health (DEGS1-MH)]. Der Nervenarzt, 85 (1), 77–87. https://doi.org/10.1007/s00115-013-3961-y
Jacobi, F [Frank], Höfler, M [Michael], Siegert, J., Mack, S [Simon], Gerschler, A [Anja], Scholl, L [Lucie], Busch, M. A [Markus A.], Hapke, U [Ulfert], Maske, U [Ulrike], Seiffert, I., Gaebel, W [Wolfgang], Maier, W [Wolfgang], Wagner, M [Michael], Zielasek, J [Jürgen] & Wittchen, H.‑U [Hans-Ulrich] (2014). Twelve-month prevalence, comorbidity and correlates of mental disorders in Germany: the Mental Health Module of the German Health Interview and Examination Survey for Adults (DEGS1-MH). International journal of methods in psychiatric research, 23 (3), 304–319. https://doi.org/10.1002/mpr.1439
Jensen, M. P. & Karoly, P. (1991). Motivation and expectancy factors in symptom perception: A laboratory study of the placebo effect. Psychosomatic Medicine. Vorab-Onlinepublikation. https://doi.org/10.1097/00006842-199103000-00004
Julious, S. A. (2013). Efficacy and suicidal risk for antidepressants in paediatric and adolescent patients. Statistical methods in medical research, 22 (2), 190–218. https://doi.org/10.1177/0962280211432210
Kamenov, K., Twomey, C., Cabello, M., Prina, A. M. & Ayuso-Mateos, J. L. (2017). The efficacy of psychotherapy, pharmacotherapy and their combination on functioning and quality of life in depression: a meta-analysis. Psychological medicine, 47 (3), 414–425. https://doi.org/10.1017/S0033291716002774
Kam-Hansen, S., Jakubowski, M., Kelley, J. M., Kirsch, I., Hoaglin, D. C., Kaptchuk, T. J. & Burstein, R. (2014). Altered placebo and drug labeling changes the outcome of episodic migraine attacks. Science translational medicine, 6 (218), 218ra5. https://doi.org/10.1126/scitranslmed.3006175
Kampermann, L., Nestoriuc, Y [Yvonne] & Shedden-Mora, M. C. (2017). Physicians' beliefs about placebo and nocebo effects in antidepressants - an online survey among German practitioners. PloS one, 12 (5). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0178719
Kaptchuk, T. J. (2002). The placebo effect in alternative medicine: can the performance of a healing ritual have clinical significance? Annals of internal medicine, 136 (11), 817–825. https://doi.org/10.7326/0003-4819-136-11-200206040-00011
Kaptchuk, T. J., Friedlander, E., Kelley, J. M., Sanchez, M. N., Kokkotou, E., Singer, J. P., Kowalczykowski, M., Miller, F. G [Franklin G.], Kirsch, I. & Lembo, A. J. (2010). Placebos without deception: a randomized controlled trial in irritable bowel syndrome. PloS one, 5 (12), e15591. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0015591
Kaptchuk, T. J. & Miller, F. G [Franklin G.] (2018). Open label placebo: can honestly prescribed placebos evoke meaningful therapeutic benefits? BMJ (Clinical research ed.), 363, k3889. https://doi.org/10.1136/bmj.k3889
Kelley, J. M., Kaptchuk, T. J., Cusin, C., Lipkin, S. & Fava, M. (2012). Open-label placebo for major depressive disorder: a pilot randomized controlled trial. Psychotherapy and psychosomatics, 81 (5), 312–314. https://doi.org/10.1159/000337053
Khan, A., Faucett, J., Lichtenberg, P., Kirsch, I. & Brown, W. A. (2012). A systematic review of comparative efficacy of treatments and controls for depression. PloS one, 7 (7), e41778. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0041778
Knieps, F. & Pfaff, H. (Hg.). (2020). BKK Gesundheitsreport. Mobilität - Arbeit - Gesundheit: Zahlen, Daten, Fakten - mit Gastbeiträgen aus Wissenschaft, Politik und Praxis. BKK Gesundheitsreport 2020 (1. Aufl.). MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft.
Kokras, N., Dalla, C. & Papadopoulou-Daifoti, Z. (2011). Sex differences in pharmacokinetics of antidepressants. Expert opinion on drug metabolism & toxicology, 7 (2), 213–226. https://doi.org/10.1517/17425255.2011.544250
Leblanc, A. (2015). "Feeling what Happens": Full Correspondence and the Placebo Effect. Journal of Mind & Behavior (35), 167–184.
Lenk, C. (2014). Placebo. In C. Lenk, G. Duttge & H. Fangerau (Hg.), Handbuch Ethik und Recht der Forschung am Menschen (S. 223–228). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-35099-3_37
Levine, J. D., Gordon, N. C., Smith, R. & Fields, H. L. (1981). Analgesic responses to morphine and placebo in individuals with postoperative pain. Pain, 10 (3), 379–389. https://doi.org/10.1016/0304-3959(81)90099-3
Levine, J., Gordon, N. & Fields, H. (1978). The Mechanism of Placebo Analgesia. The Lancet, 312 (8091), 654–657. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(78)92762-9
Li, Y., Huang, J., He, Y., Yang, J., Lv, Y., Liu, H., Liang, L., Li, H., Zheng, Q. & Li, L. (2019). The Impact of Placebo Response Rates on Clinical Trial Outcome: A Systematic Review and Meta-Analysis of Antidepressants in Children and Adolescents with Major Depressive Disorder. Journal of child and adolescent psychopharmacology, 29 (9), 712–720. https://doi.org/10.1089/cap.2019.0022
Liberati, A., Altman, D. G., Tetzlaff, J., Mulrow, C., Gøtzsche, P. C., Ioannidis, J. P. A., Clarke, M., Devereaux, P. J., Kleijnen, J. & Moher, D. (2009). The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate health care interventions: explanation and elaboration. PLoS medicine, 6 (7), e1000100. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000100
Lilienfeld, S. O. (2007). Psychological Treatments That Cause Harm. Perspectives on psychological science : a journal of the Association for Psychological Science, 2 (1), 53–70. https://doi.org/10.1111/j.1745-6916.2007.00029.x
Loh, N., Nickl-Jockschat, T., Sheldrick, A. J. & Grözinger, M. (2013). Accessibility, standards and challenges of electroconvulsive therapy in Western industrialized countries: a German example. The world journal of biological psychiatry : the official journal of the World Federation of Societies of Biological Psychiatry, 14 (6), 432–440. https://doi.org/10.3109/15622975.2012.665176
Mathur, A., Jarrett, P., Broadbent, E. & Petrie, K. J. (2018). Open-label Placebos for Wound Healing: A Randomized Controlled Trial. Annals of behavioral medicine : a publication of the Society of Behavioral Medicine, 52 (10), 902–908. https://doi.org/10.1093/abm/kax057
McClure, S. M., Li, J., Tomlin, D., Cypert, K. S., Montague, L. M. & Montague, P. R. (2004). Neural correlates of behavioral preference for culturally familiar drinks. Neuron, 44 (2), 379–387. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2004.09.019
Mehler-Wex, C. (2008). Depressive Störungen. Manuale psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen. Springer.
Meister, R., Abbas, M., Antel, J., Peters, T., Pan, Y., Bingel, U., Nestoriuc, Y [Yvonne] & Hebebrand, J. (2020). Placebo response rates and potential modifiers in double-blind randomized controlled trials of second and newer generation antidepressants for major depressive disorder in children and adolescents: a systematic review and meta-regression analysis. European Child & Adolescent Psychiatry, 29 (3), 253–273. https://doi.org/10.1007/s00787-018-1244-7
Moritz, S., Nestoriuc, Y [Yvonne], Rief, W., Klein, J. P., Jelinek, L. & Peth, J. (2019). It can't hurt, right? Adverse effects of psychotherapy in patients with depression. European archives of psychiatry and clinical neuroscience, 269 (5), 577–586. https://doi.org/10.1007/s00406-018-0931-1
Myers, D. G. (2014). Psychologie. Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-40782-6
Nestoriuc, Y [Y.] & Kleine-Borgmann, J. (2020). Der Schein trügt nicht – klinische Evidenz und neue Forschungsansätze zum Open-label-Placebo [Appearances are not deceptive: clinical evidence and new research approaches to open-label placebo]. Der Nervenarzt, 91 (8), 708–713. https://doi.org/10.1007/s00115-020-00953-6
Ng, T. W. H., Sorensen, K. L. & Eby, L. T. (2006). Locus of control at work: a meta-analysis. Journal of Organizational Behavior, 27 (8), 1057–1087. https://doi.org/10.1002/job.416
Oeltjenbruns, J. & Schäfer, M. (2008). Klinische Bedeutung des Placeboeffektes [Clinical significance of the placebo effect]. Der Anaesthesist, 57 (5), 447–463. https://doi.org/10.1007/s00101-008-1370-6
Ownby, R. L., Crocco, E., Acevedo, A., John, V. & Loewenstein, D. (2006). Depression and risk for Alzheimer disease: systematic review, meta-analysis, and metaregression analysis. Archives of general psychiatry, 63 (5), 530–538. https://doi.org/10.1001/archpsyc.63.5.530
Parellada, M., Moreno, C., Moreno, M., Espliego, A., Portugal, E. de & Arango, C. (2012). Placebo effect in child and adolescent psychiatric trials. European neuropsychopharmacology : the journal of the European College of Neuropsychopharmacology, 22 (11), 787–799. https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2011.09.007
Pascalis, V. de, Chiaradia, C. & Carotenuto, E. (2002). The contribution of suggestibility and expectation to placebo analgesia phenomenon in an experimental setting. Pain, 96 (3), 393–402. https://doi.org/10.1016/S0304-3959(01)00485-7
Pawlow, I. P. (1927). Conditioned reflexes, an investigation of the physiological activity of the cerebral cortex. Oxford University Press.
Perrin, J. S., Merz, S., Bennett, D. M., Currie, J., Steele, D. J., Reid, I. C. & Schwarzbauer, C. (2012). Electroconvulsive therapy reduces frontal cortical connectivity in severe depressive disorder. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109 (14), 5464–5468. https://doi.org/10.1073/pnas.1117206109
Pigott, H. E., Leventhal, A. M., Alter, G. S. & Boren, J. J. (2010). Efficacy and effectiveness of antidepressants: current status of research. Psychotherapy and psychosomatics, 79 (5), 267–279. https://doi.org/10.1159/000318293
Propping, P. (1989). Psychiatrische Genetik: Befunde und Konzepte. Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-74602-4
Rehn, J. (2019). Gesunde Gestaltung. Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-23555-0
Reynaert, C., Janne, P., Vause, M., Zdanowicz, N. & Lejeune, D. (1995). Clinical trials of antidepressants: the hidden face: where locus of control appears to play a key role in depression outcome. Psychopharmacology, 119 (4), 449–454. https://doi.org/10.1007/BF02245861
Ross, M. & Olson, J. M. (1981). An expectancy-attribution model of the effects of placebos. Psychological review, 88 (5), 408–437.
Rutherford, B. R., Sneed, J. R., Tandler, J. M., Rindskopf, D., Peterson, B. S. & Roose, S. P. (2011). Deconstructing pediatric depression trials: an analysis of the effects of expectancy and therapeutic contact. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 50 (8), 782–795. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2011.04.004
Sandler, A. D. & Bodfish, J. W. (2008). Open-label use of placebos in the treatment of ADHD: a pilot study. Child: care, health and development, 34 (1), 104–110. https://doi.org/10.1111/j.1365-2214.2007.00797.x
Schaefer, M., Harke, R. & Denke, C. (2016). Open-Label Placebos Improve Symptoms in Allergic Rhinitis: A Randomized Controlled Trial. Psychotherapy and psychosomatics, 85 (6), 373–374. https://doi.org/10.1159/000447242
Scott B Patten, MD, FRCPC, PhD, Cynthia A Beck, MASc, Aliya Kassam, MSc, Jeanne VA Williams, BA, Corrado Barbui & and Luanne M Metz (2005). Long-Term Medical Conditions and Major Depression: Strength of Association for Specific Conditions in the General Population. Canadian journal of psychiatry. Revue canadienne de psychiatrie, 50 (4), 195–202.
Singh, A. & Kar, S. K. (2017). How Electroconvulsive Therapy Works? Understanding the Neurobiological Mechanisms. Clinical psychopharmacology and neuroscience : the official scientific journal of the Korean College of Neuropsychopharmacology, 15 (3), 210–221. https://doi.org/10.9758/cpn.2017.15.3.210
Springer, M. (2017). Wie teuer wurden. In M. Springer (Hg.), Unendliche Neugier (S. 186–188). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-54891-2_57
Su, C., Lewis, J. D., Goldberg, B., Brensinger, C. & Lichtenstein, G. R. (2007). A meta-analysis of the placebo rates of remission and response in clinical trials of active ulcerative colitis. Gastroenterology, 132 (2), 516–526. https://doi.org/10.1053/j.gastro.2006.12.037
Takamiya, A., Plitman, E., Chung, J. K., Chakravarty, M., Graff-Guerrero, A., Mimura, M. & Kishimoto, T. (2019). Acute and long-term effects of electroconvulsive therapy on human dentate gyrus. Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 44 (10), 1805–1811. https://doi.org/10.1038/s41386-019-0312-0
Thase, M. E. (2003). Effectiveness of antidepressants: comparative remission rates. The Journal of clinical psychiatry, 64 Suppl 2, 3–7.
Tilburt, J. C., Emanuel, E. J [Ezekiel J.], Kaptchuk, T. J., Curlin, F. A. & Miller, F. G [Franklin G.] (2008). Prescribing "placebo treatments": results of national survey of US internists and rheumatologists. BMJ (Clinical research ed.), 337, a1938. https://doi.org/10.1136/bmj.a1938
Tsapakis, E. M., Soldani, F., Tondo, L. & Baldessarini, R. J. (2008). Efficacy of antidepressants in juvenile depression: meta-analysis. The British journal of psychiatry : the journal of mental science, 193 (1), 10–17. https://doi.org/10.1192/bjp.bp.106.031088
Voudouris NJ, Peck CL, Coleman G (1985). Voudouris NJ, Peck CL, Coleman G (1985) Conditioned placebo responses. Journal of Personality and Social Psychology (48), 47–53.
Voudouris NJ, Peck CL, Coleman G (1989). Conditioned response models of placebo phenomena: further support. Pain (38), 109-116.
Voudouris NJ, Peck CL, Coleman G (1990). The role of conditioning and verbal expectancy in the placebo response. Pain (43), 121–128.
Waber, R. L., Shiv, B., Carmon, Z. & Ariely, D. (2008). Commercial features of placebo and therapeutic efficacy. JAMA, 299 (9), 1016–1017. https://doi.org/10.1001/jama.299.9.1016
Walkup, J. T. (2017). Antidepressant Efficacy for Depression in Children and Adolescents: Industry- and NIMH-Funded Studies. The American Journal of Psychiatry, 174 (5), 430–437. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2017.16091059
Walsh, B. T., Seidman, S. N., Sysko, R. & Gould, M. (2002). Placebo response in studies of major depression: variable, substantial, and growing. JAMA, 287 (14), 1840–1847. https://doi.org/10.1001/jama.287.14.1840
Weimer, K., Gulewitsch, M. D., Schlarb, A. A., Schwille-Kiuntke, J., Klosterhalfen, S. & Enck, P. (2013). Placebo effects in children: a review. Pediatric research, 74 (1), 96–102. https://doi.org/10.1038/pr.2013.66
Weisz, J. R., McCarty, C. A. & Valeri, S. M. (2006). Effects of psychotherapy for depression in children and adolescents: a meta-analysis. Psychological bulletin, 132 (1), 132–149. https://doi.org/10.1037/0033-2909.132.1.132
Whalley, B. & Hyland, M. E. (2013). Placebo by proxy: the effect of parents' beliefs on therapy for children's temper tantrums. Journal of behavioral medicine, 36 (4), 341–346. https://doi.org/10.1007/s10865-012-9429-x
Wild, E. & Möller, J. (2015). Pädagogische Psychologie. Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-41291-2
Zhou, E. S., Hall, K. T., Michaud, A. L., Blackmon, J. E., Partridge, A. H. & Recklitis, C. J. (2019). Open-label placebo reduces fatigue in cancer survivors: a randomized trial. Supportive care in cancer : official journal of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer, 27 (6), 2179–2187. https://doi.org/10.1007/s00520-018-4477-6
Zhou, X., Hetrick, S. E., Cuijpers, P [Pim], Qin, B., Barth, J., Whittington, C. J., Cohen, D., Del Giovane, C., Liu, Y., Michael, K. D., Zhang, Y., Weisz, J. R. & Xie, P. (2015). Comparative efficacy and acceptability of psychotherapies for depression in children and adolescents: A systematic review and network meta-analysis. World psychiatry : official journal of the World Psychiatric Association (WPA), 14 (2), 207–222. https://doi.org/10.1002/wps.20217
Häufig gestellte Fragen zu der Language Preview
Was ist das Hauptthema dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit Placebo-Effekten bei Kindern und Jugendlichen mit depressiven Störungen. Es werden Placebo-Modelle, die Rolle von Placebo-Effekten und beeinflussende Variablen untersucht, um die Frage nach dem Nutzen von Placebos in der Therapie zu beantworten.
Welche Datenbanken wurden für die Recherche verwendet?
Für die Recherche wurden die Datenbanken Psychology and Behavioral Sciences, PsycINFO, Psyndex, MEDLINE und die Universitätsbibliothek der Helmut-Schmidt-Universität genutzt.
Welche Placebo-Modelle werden in der Arbeit betrachtet?
Zur Erklärung von Placebo-Effekten werden die Modelle der klassischen Konditionierung, der Erwartungstheorie und des Placebo-by-Proxy herangezogen.
Wie hoch ist die Differenz der Placebo- und Interventions-Response bei Kindern und Jugendlichen mit Depressionen?
Die Differenz der Placebo- und Interventions-Response liegt in etwa bei 10 Prozentpunkte.
Was ist ein Open-Label-Placebo (OLP)?
Ein OLP ist ein Placebo, das offen als solches verabreicht wird, also ohne Täuschung des Patienten.
Welche Variablen beeinflussen Placebo-Effekte bei Kindern und Jugendlichen mit Depressionen?
Der Effekt wird beeinflusst durch die Anzahl der Orte, an denen eine Studie durchgeführt wird, den sozialen Status und die Häufigkeit der therapeutischen Kontakte zwischen Patienten und Personal. Auch der Schweregrad der Depression und das Alter des Kindes/Jugendlichen spielen eine Rolle.
Was ist Placebo-by-Proxy?
Placebo-by-proxy beschreibt die Wirkung des Placebos auf Nahestehende, meistens die Eltern oder Betreuer eines Kindes, welches mit Placebo behandelt wird.
Welche Rolle spielen Antidepressiva bei Kindern und Jugendlichen mit Depressionen laut dieser Arbeit?
Medikamente (Antidepressiva) sind in der Regel nicht signifikant wirksamer als Placebos, haben aber gleichzeitig signifikante Nebenwirkungen. Die Arbeit deutet an, dass Antidepressiva bei Kindern und Jugendlichen möglicherweise überschätzt werden.
Was ist die 12-Monats-Prävalenz von depressiven Störungen in Deutschland?
Die 12-Monats-Prävalenz für depressive Störungen in Deutschland liegt bei 7,7%.
Welche Klassifikationssysteme werden für die Diagnose von depressiven Störungen verwendet?
Die wichtigsten Klassifikationssysteme sind das International Classification of Diseases Version 10 (ICD-10) und das Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Version 5 (DSM-V).
Welche Hauptkriterien und Nebenkriterien werden zur Diagnose einer depressiven Episode herangezogen?
Die Hauptkriterien sind depressive, gedrückte Stimmung, Interessenverlust und Freudlosigkeit, sowie Verminderung des Antriebs verbunden mit Aktivitätseinschränkungen. Die Nebenkriterien umfassen verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit, vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen, Schuldgefühle und Gefühle der Wertlosigkeit, negative Zukunftsperspektiven, Suizidgedanken, Schlafstörungen und verminderter Appetit.
Was ist die Elektrokonvulsionstherapie (EKT) und wann wird sie eingesetzt?
Die Elektrokonvulsionstherapie (EKT) wird bei Patienten mit schweren depressiven Episoden eingesetzt, bei denen Antidepressiva nicht oder nur unzureichend zu Besserung führen. Dabei wird das Gehirn durch Elektroden mit elektrischem Strom stimuliert, um einen generalisierten epileptischen Anfall auszulösen.
- Quote paper
- Robert Kießling (Author), 2021, Placebo-Effekte bei Kindern und Jugendlichen mit depressiven Störungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1161000