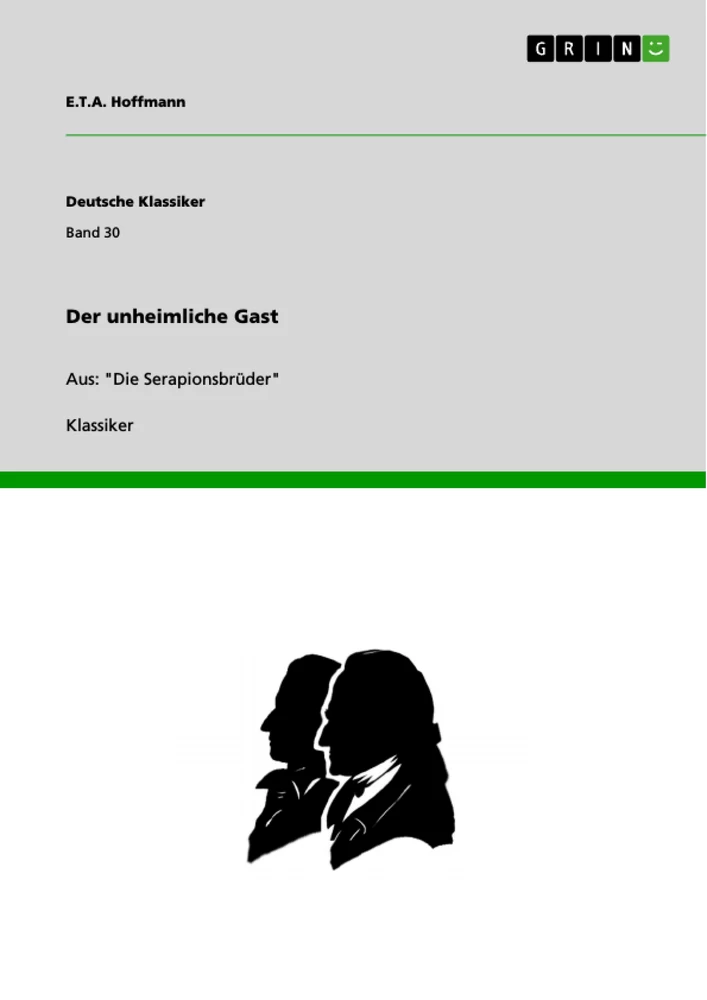Der Sturm brauste durch die Lüfte, den heranziehenden Winter verkündigend, und trieb die schwarzen Wolken vor sich her, die zischende, prasselnde Ströme von Regen und Hagel hinabschleuderten.
»Wir werden,« sprach, als die Wanduhr sieben schlug, die Obristin von G. zu ihrer Tochter, Angelika geheißen, »wir werden heute allein bleiben, das böse Wetter verscheucht die Freunde. Ich wollte nur, daß
mein Mann heimkehrte.« In dem Augenblick trat der Rittmeister Moritz von R. hinein. Ihm folgte der junge Rechtsgelehrte, der durch seinen geistreichen, unerschöpflichen Humor den Zirkel belebte, der sich jeden Donnerstag im Hause des Obristen zu versammeln pflegte,
und so war, wie Angelika bemerkte, ein einheimischer Kreis beisammen, der die größere Gesellschaft gern vermissen ließ. – Es war kalt im Saal, die Obristin ließ Feuer im Kamin anschüren und den
Teetisch hinanrücken. »Euch beiden Männern,« sprach sie nun, »euch beiden Männern, die ihr mit wahrhaft ritterlichem Heroismus durch Sturm und Braus zu uns gekommen, kann ich wohl gar nicht zumuten, daß ihr vorliebnehmen sollt mit unserm nüchternen, weichlichen Tee, darum soll euch Mademoiselle Marguerite das gute nordische Getränk bereiten, das allem bösen Wetter widersteht.«
Inhaltsverzeichnis
- Der unheimliche Gast
- Der Sturm und die Gesellschaft
- Grauen und Gespensterfurcht
- Die Naturlaute des Entsetzens
- Der Jammerlaut aus der Ferne
- Die Teemaschine und der Grauen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Erzählung „Der unheimliche Gast“ von E.T.A. Hoffmann beschäftigt sich mit dem menschlichen Verhältnis zur Geisterwelt und dem Wesen des Grauens. Die Geschichte erkundet die unheimliche Faszination des Unerklärlichen und die Frage, ob die menschliche Natur dem Grauen gegenüber empfänglich ist.
- Das Unheimliche und die Geisterwelt
- Die Natur des Grauens und die menschliche Psyche
- Die Rolle von Phantasie und Einbildungskraft
- Die Verbindung von Naturphänomenen und dem Übernatürlichen
- Der Einfluss von Ammenmärchen und Spukgeschichten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Erzählung beginnt mit einer Gruppe von Menschen, die sich bei einem Sturm im Hause des Obristen versammeln. Der junge Rechtsgelehrte Dagobert behauptet, dass Herbst, Sturm und Kaminfeuer eine gewisse Unheimlichkeit erzeugen, die sich als das Gefühl des Grauens manifestiert. Die Obristin widerspricht, indem sie das Grauen als ein Produkt von Ammenmärchen abtut. Dagobert argumentiert jedoch, dass die menschliche Natur eine tiefe Verbindung zur Geisterwelt hat und dass das Grauen aus der Sehnsucht des Geistes nach dem Unverstandenen resultiert.
Moritz, ein Rittmeister, berichtet von einer persönlichen Erfahrung, die er während des Krieges in Spanien gemacht hat. Er schildert, wie er einen unheimlichen Jammerlaut hörte, der ihn mit tiefem Grauen erfüllte. Die anderen Soldaten erlebten das gleiche Phänomen und interpretierten es als ein Zeichen des bevorstehenden Krieges.
Dagobert argumentiert, dass das Grauen nicht nur durch entfernte Naturlaute, sondern auch durch alltägliche Geräusche wie das Zischen im Kamin oder das Lied der Teemaschine hervorgerufen werden kann.
Marguerite, die Gesellschafterin von Angelika, wird plötzlich von Angst erfasst und flüchtet in ihr Zimmer. Die Geschichte endet an dieser Stelle, ohne eine Auflösung des Rätsels um Marguerites Angst.
Schlüsselwörter
Die Erzählung „Der unheimliche Gast“ von E.T.A. Hoffmann verwendet eine Reihe von Schlüsselbegriffen, um die zentralen Themen zu verdeutlichen. Dazu gehören: Grauen, Gespensterfurcht, Geisterwelt, Naturlaute, Phantasie, Einbildungskraft, Ammenmärchen, Spukgeschichten, Unheimlichkeit, Angst, und das menschliche Verhältnis zum Unerklärlichen. Die Geschichte erkundet die komplexen Wechselwirkungen zwischen dem Realen und dem Imaginären, sowie die Grenzen zwischen dem Verstand und dem Unbewussten.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in E.T.A. Hoffmanns „Der unheimliche Gast“?
Die Erzählung thematisiert das menschliche Verhältnis zum Übernatürlichen und die Entstehung von Grauen und Angst in alltäglichen Situationen.
Was löst laut Dagobert das Gefühl des Grauens aus?
Dagobert argumentiert, dass das Grauen aus der Sehnsucht des Geistes nach dem Unverstandenen und der Verbindung zur Geisterwelt resultiert.
Welche Rolle spielt die Natur in der Geschichte?
Stürme, Herbstwetter und unheimliche Naturlaute werden als Verstärker für die menschliche Einbildungskraft und die Gespensterfurcht dargestellt.
Was berichtet der Rittmeister Moritz?
Er schildert ein traumatisches Erlebnis aus dem Krieg in Spanien, bei dem ein unerklärlicher Jammerlaut tiefe Angst bei allen Soldaten auslöste.
Sind Ammenmärchen die einzige Quelle für Angst?
Nein, die Erzählung legt nahe, dass Angst tief in der menschlichen Psyche verwurzelt ist und auch durch ganz alltägliche Geräusche getriggert werden kann.
- Quote paper
- E.T.A. Hoffmann (Author), 2008, Der unheimliche Gast, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/116133