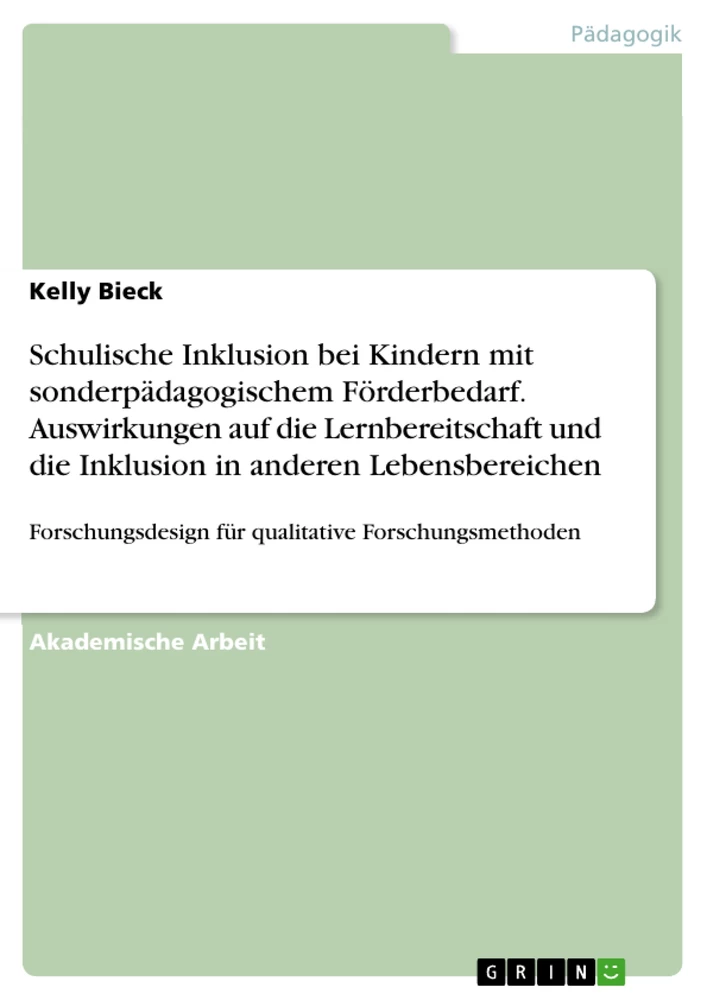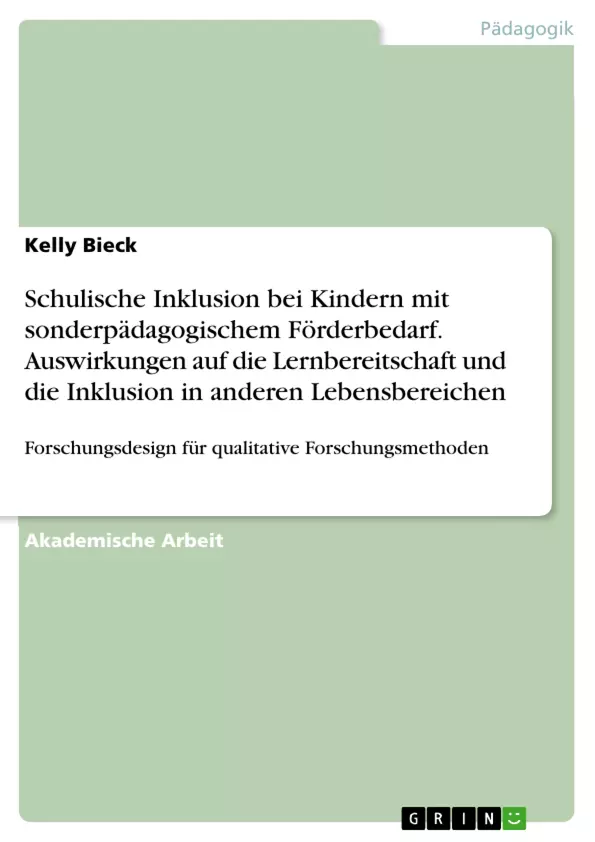In dieser Fallstudie soll das Forschungsdesign zu folgender Forschungsfrage konstruiert werden: „Wie reflektieren Eltern von Kindern mit Förderbedarf nach Ende der Schullaufbahn ihre Entscheidung, sich gegen inklusive Beschulung entschieden zu haben?" Dabei soll herausgearbeitet werden, warum die Entscheidung für ein Förderzentrum getroffen wurde und wie die Entscheidung sich auf die Lernbereitschaft und die Inklusion in anderen Lebensbereichen ausgewirkt hat.
Im Fallbeispiel „Schulische Inklusion in Beispielshausen“ wird ein heterogenes Bild der Wahrnehmung und Akzeptanz der schulischen Inklusion in Deutschland dargestellt. Auch die Verteilung der Beschulung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Deutschland, sowie die Auffassungen der Eltern, scheint ungleich verteilt. In manchen Bundesländern (Bayern oder Hessen) werden trotz der 2009 in Kraft getretenen UN-Behindertenrechtskonvention noch rund drei Viertel der betroffenen Schüler in Förderschulen beschult. Im Vergleich dazu sind es nur rund ein Drittel in anderen Bundesländern (Schleswig-Holstein oder Bremen).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Methodologische Positionierung
- 2.1 Quantitative Forschungsmethoden
- 2.2 Qualitative Forschungsmethoden
- 2.3 Gütekriterien
- 3. Exkurs
- 4. Grundlagentheoretische Einbettung
- 5. Forschungsfeld
- 6. Sampling
- 7. Erhebungsverfahren
- 8. Transkription
- 9. Auswertungsverfahren
- 9.1 Qualitative Inhaltsanalyse
- 9.2 Strukturierende qualitative Inhaltsanalyse
- 10. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Forschungsarbeit zielt darauf ab, die Entscheidung von Eltern, die sich für eine Förderschule anstatt einer inklusiven Beschulung für ihre Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf entschieden haben, zu erforschen. Die Untersuchung analysiert die Gründe für diese Entscheidung und untersucht deren Auswirkungen auf die Lernbereitschaft und Inklusion in anderen Lebensbereichen.
- Die unterschiedliche Wahrnehmung und Akzeptanz von schulischer Inklusion in Deutschland
- Die Ungleichverteilung der Beschulung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in verschiedenen Bundesländern
- Die Gründe, die Eltern für eine Entscheidung für ein Förderzentrum treffen
- Die Auswirkungen der Entscheidung auf die Lernbereitschaft und die Inklusion in anderen Lebensbereichen
- Die Reflexion der Eltern über ihre getroffene Entscheidung nach Ende der Schullaufbahn
Zusammenfassung der Kapitel
- 1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema der schulischen Inklusion ein und stellt die Forschungsfrage vor. Es beleuchtet die ungleiche Verteilung der Beschulung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Deutschland.
- 2. Methodologische Positionierung: Dieses Kapitel beschreibt die methodologische Positionierung der Forschungsarbeit. Es wird erläutert, warum eine qualitative Forschungsmethode für die Untersuchung der Forschungsfrage am geeignetsten ist.
- 2.1 Quantitative Forschungsmethoden: Dieser Abschnitt diskutiert die Möglichkeiten und Grenzen quantitativer Forschungsmethoden im Kontext der Forschungsfrage.
- 2.2 Qualitative Forschungsmethoden: Dieser Abschnitt argumentiert für die Verwendung qualitativer Methoden und betont ihre Eignung für die Untersuchung von subjektiven Erfahrungen und Reflexionen.
- 2.3 Gütekriterien: Dieser Abschnitt beschreibt die Gütekriterien, die in der Forschungsarbeit angewendet werden, um die Qualität der Untersuchung zu gewährleisten.
- 3. Exkurs: Dieses Kapitel thematisiert die persönlichen Erfahrungen der Forschenden als Pflegemutter von 3 Jungen mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Es reflektiert die gesellschaftliche Wahrnehmung und die rechtlichen Vorgaben im Zusammenhang mit der Entscheidung für eine Förderschule.
Schlüsselwörter
Schulische Inklusion, sonderpädagogischer Förderbedarf, Eltern, Entscheidung, Förderzentrum, inklusive Beschulung, Lernbereitschaft, Inklusion, Lebensbereiche, qualitative Forschungsmethoden, Erfahrungswerte, Reflexion, subjektives Erleben, Fallstudie, Gütekriterien.
Häufig gestellte Fragen
Warum entscheiden sich Eltern gegen eine inklusive Beschulung?
Die Fallstudie untersucht die Gründe, warum Eltern trotz Inklusionsanspruch ein Förderzentrum bevorzugen, oft aus Sorge um die individuelle Förderung.
Welche Auswirkungen hat die Wahl der Förderschule auf die Lernbereitschaft?
Die Arbeit analysiert, ob die geschützte Umgebung eines Förderzentrums die Lernmotivation positiv oder negativ beeinflusst.
Wie unterscheidet sich die Inklusionsrate in deutschen Bundesländern?
Es gibt große Unterschiede: In Bayern oder Hessen werden ca. 75% der betroffenen Schüler in Förderschulen unterrichtet, in Bremen oder Schleswig-Holstein nur ca. 33%.
Welche methodische Vorgehensweise nutzt diese Studie?
Es wird eine qualitative Forschungsmethode (strukturierende qualitative Inhaltsanalyse) verwendet, um subjektive Elternreflexionen auszuwerten.
Welche Rolle spielt die UN-Behindertenrechtskonvention seit 2009?
Sie bildet die rechtliche Grundlage für den Anspruch auf inklusive Beschulung, wird aber in der Praxis je nach Bundesland sehr unterschiedlich umgesetzt.
- Quote paper
- Kelly Bieck (Author), 2021, Schulische Inklusion bei Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Auswirkungen auf die Lernbereitschaft und die Inklusion in anderen Lebensbereichen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1161408