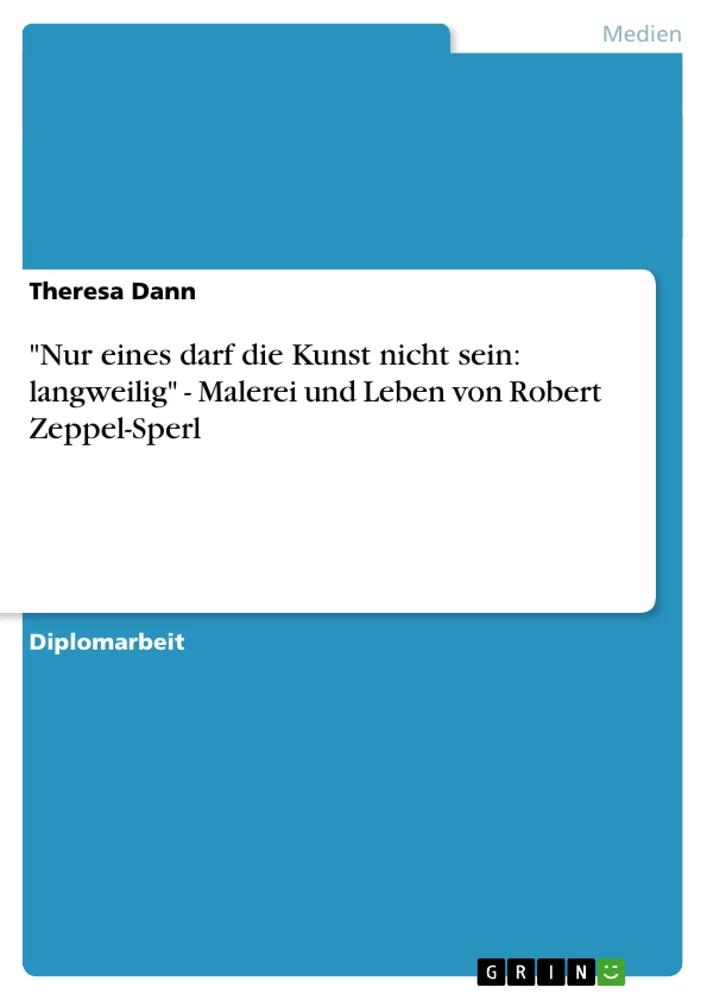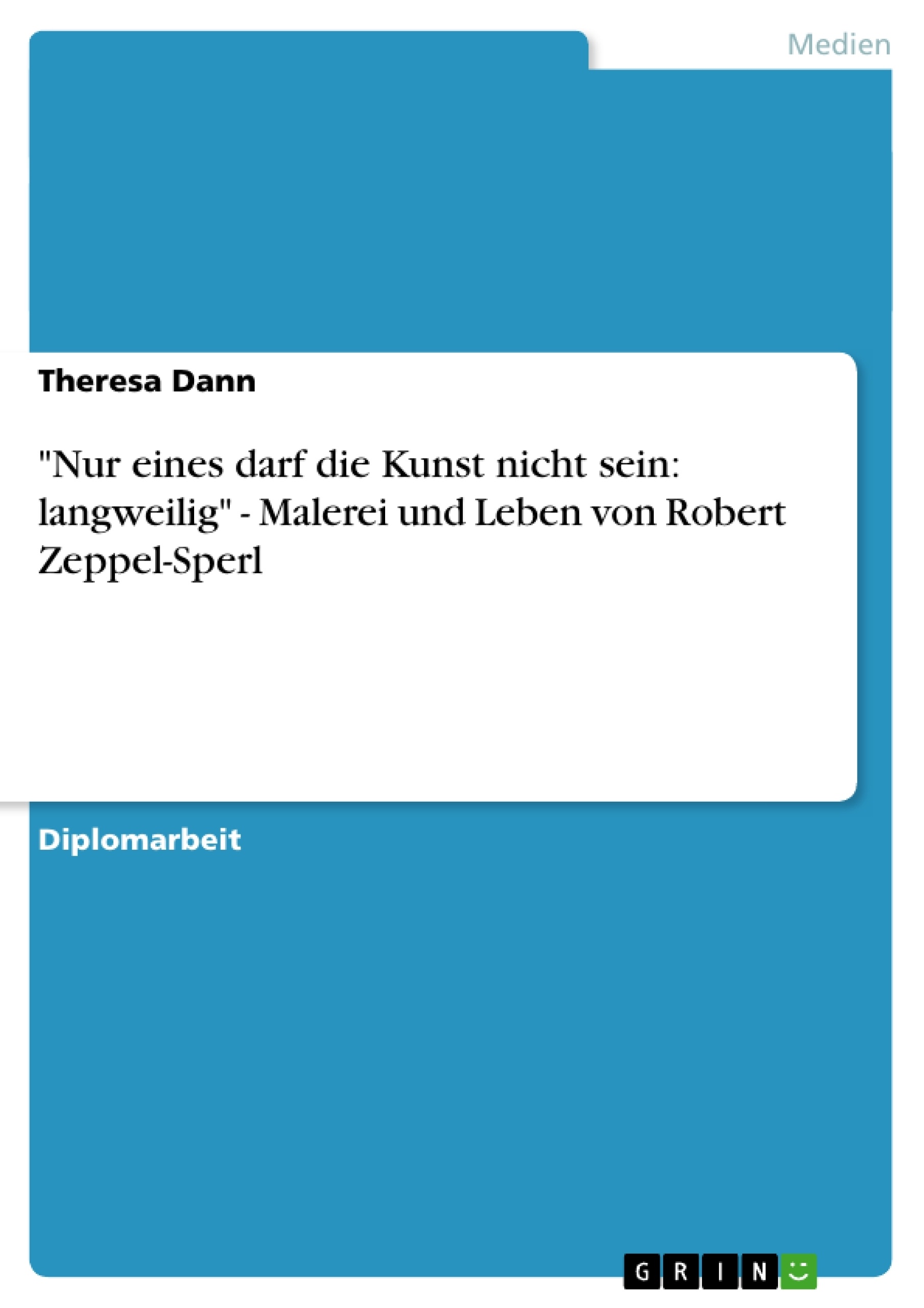Die Arbeiten Robert Zeppel-Sperls1 erweckten erstmals Aufmerksamkeit, als Otto Breicha diese gemeinsam mit denen von Wolfgang Herzig2, Martha Jungwirth3, Kurt Kocherscheidt4, Peter Pongratz5 und Franz Ringel6 unter dem Titel „Wirklichkeiten“ 1968 in der Wiener Secession der Öffentlichkeit zugänglich machte. Von Robert Zeppel-Sperls Schaffen vor besagtem Jahr gibt es so gut wie keine Informationen. Bekannt ist nur, dass er mit 17 Jahren beschloss Maler zu werden und laut Literatur zwischen 1962 und 1968 in Wien an der Akademie der Künste bei Prof. Christian Martin, Prof. Max Melcher und Prof. Max Weiler studierte.7 Otto Breicha, der Verfasser der einzigen beiden erschienen Publikationen über Robert Zeppel-Sperl, beschrieb das Werk des Künstlers als eine Mischung aus Pop, Phantasmagorie, Naivität und Realistik. Er nannte als typische Gestaltungsmerkmale seiner Bilder den Bild-im-Bild Stil, übereinandergestapelte Bildbühnen, systematische Unordnung sowie Erotik und interpretierte die „vollgestopften“ Bilder als Zeugnis eines ausgeprägten Ideenreichtums, als Novum, das den Ausweg aus der bisherigen Malerei garantieren sollte.8 Robert Zeppel-Sperl sprach in einem Interview, in der ihm typischen, durchaus direkten Art und Weise, von seinen Vorbildern: „Angefangen habe ich in der Art der Wiener Schule, da war am leichtesten anzuschließen. Dann habe ich mich immer mehr mit dem eigentlichen Surrealismus auseinandergesetzt, aber auch mit den eher expressionistischen Sachen. Die ‚Erleuchtung‘ kam mir aber vom Maler Antes. Er hat damals auf der Biennale in Venedig einen großen Preis gekriegt. Und ich bekam einen Katalog in die Hand und dachte mir: In diese Richtung kann es auch weitergehen. … Ich habe mich dann ziemlich mit Beckmann und Nolde auseinandergesetzt.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- Forschungsfrage, Herangehensweise und Zielsetzung
- DAS SCHAFFENSUMFELD VON ROBERT ZEPPEL-SPERL
- Die 1960er Jahre
- Die Kunst der 1960er Jahre in Österreich
- Die Wiener Schule des Phantastischen Realismus
- Die Abstrakten
- Der Wiener Aktionismus
- Art brut
- DIE WERKE ROBERT ZEPPEL-SPERLS
- Die Zeit an der Akademie
- Die Werke von 1962 bis 1965
- Beeinflussung
- Beeinflussung durch Herbert Boeckl
- Beeinflussung durch die Professoren Maximilian Melcher und Max Weiler
- Beeinflussung durch die Wiener Schule des Phantastischen Realismus
- Die Werke von 1966 bis 1968
- Beeinflussung
- Beeinflussung durch die Expressionisten und ihr Umfeld
- Beeinflussung durch den Surrealismus
- Beeinflussung durch Georges Braque und Heinrich Campendonk
- Beeinflussung durch Horst Antes
- Beeinflussung durch die Romantiker
- Beeinflussung durch die Mitglieder der Wirklichkeiten
- Die Zeit an der Akademie: Die Eigenständigkeit des Werkes
- Motive aus der Akademiezeit
- Die menschliche Figur
- Das Motiv der Frau
- Das Motiv der mystischen Wesen
- Selbstbildnisse
- Tiermotive
- Stil in der akademischen Phase
- Flächigkeit und Bild-im-Bild
- Die Kolorierung
- Die Zeit in Venedig von 1969 bis 1976
- Die Werke von 1969 bis 1976
- Die stilistischen Veränderungen in Venedig
- Die Motive in Venedig
- Die Frau
- Tiermotiv
- Selbstbildnis
- Die Zeit ab dem ersten Amerikabesuch von 1977 bis 1988
- Die Werke von 1977 bis 1988
- Die stilistischen Veränderungen in der Zeit von 1977 bis 1988
- Die motivischen Veränderungen in der Zeit von 1977 bis 1988
- Die Frau
- Selbstdarstellung
- Der Mann
- Die Bilderwand
- Die Zeit ab der ersten Balireise von 1989 bis 2005
- Das Werk von 1989 bis 2005
- Die stilistischen Veränderungen in der Zeit von 1989 bis 2005
- Die Kolorierung
- Der Einsatz der Décalcomanie
- Die motivischen Veränderungen von 1989 bis 2005
- NAIVE TENDENZEN IM WERK ROBERT ZEPPEL-SPERLS
- RESÜMEE
- BIOGRAFIE
- INTERVIEWS
- Interview mit Helga Hauser, 29.01.2007
- Interview mit Marianne Zeppel-Sperl, 26.04.2007
- Interview mit Elfriede Jelinek, 22.06.2007
- BIBLIOGRAFIE
- ABBILDUNGSNACHWEIS
- ABBILDUNGEN
- Die Auseinandersetzung mit der Kunst des Phantastischen Realismus und der Abstrakten sowie die Abgrenzung von Robert Zeppel-Sperls Werk zu diesen Strömungen.
- Die Analyse des Einflusses verschiedener Künstler auf Zeppel-Sperls Werk, darunter Herbert Boeckl, Maximilian Melcher, Max Weiler, Paul Klee, Emil Nolde, Max Ernst, René Magritte, Horst Antes, Caspar David Friedrich, Philipp Otto Runge, James Ensor und Arnold Schönberg.
- Die Betrachtung von Zeppel-Sperls Auseinandersetzung mit zeitgenössischen Phänomenen wie der Popkultur und der sexuellen Revolution in den 1960er Jahren.
- Die Erörterung der stilistischen und motivischen Entwicklung von Zeppel-Sperls Werk über verschiedene Phasen hinweg: die „Akademiezeit“, die „venezianische Phase“, die „amerikanische Phase“ und die „balinesische Phase“.
- Die Untersuchung des Vorwurfs der Naivität in Zeppel-Sperls Werk im Vergleich zu anderen Naiven Künstlern wie Gyorgy Stefula und Jan Balet.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit dem malerischen Schaffen Robert Zeppel-Sperls von 1964 bis 2005, wobei ein Schwerpunkt auf die frühen Arbeiten liegt, die bis zum Jahr 1968 entstanden. Ziel ist es, einen Einblick in die künstlerische Entwicklung Zeppel-Sperls zu geben und mögliche Einflüsse auf seine Werke zu analysieren, von seinen Lehrern an der Akademie bis hin zu spezifischen Künstlerpersönlichkeiten und dem Massenprodukt des Comics.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit beleuchtet die frühen Werke Robert Zeppel-Sperls während seiner Studienzeit an der Akademie der bildenden Künste in Wien, insbesondere die Jahre 1962 bis 1968. Die Analyse seiner ersten Bilder und die Erörterung der Einflüsse von Herbert Boeckl, Maximilian Melcher und Max Weiler ermöglichen ein tieferes Verständnis der frühen Entwicklung von Zeppel-Sperls Stil und seiner künstlerischen Prägung. Im Anschluss werden die Werke von 1966 bis 1968 in den Kontext der Kunst der 1960er Jahre gesetzt und weitere Einflüsse, wie die Expressionisten, Surrealisten und die Mitglieder der Gruppe „Wirklichkeiten“, untersucht.
Kapitel 2 widmet sich der Betrachtung der „venezianischen Phase“ von 1969 bis 1976, in der sich Zeppel-Sperls Kunst durch stilistische und motivische Veränderungen auszeichnet. Diese Veränderungen werden im Kontext seiner Auseinandersetzung mit der Renaissancemalerei erörtert und in Verbindung mit der „Schlacht“ (1972) und seinen neuen Interessen an der Frauendarstellung, der Tierdarstellung und der Selbstdarstellung analysiert.
Kapitel 3 behandelt die „amerikanische Phase“ von 1977 bis 1988. Robert Zeppel-Sperls Werk in dieser Zeit wird in Bezug zu seinen Amerikareisen gesetzt. Die Analyse von Gemälden wie „Die Hecke“ (1977) und „Kazike mit Frau“ (1977) zeigt seinen neuen Umgang mit dem Motiv des Indianers. Außerdem werden die stilistischen und motivischen Veränderungen, die die Bilderwand, die Frau, der Mann und die Selbstdarstellung betreffen, untersucht.
Kapitel 4 fokussiert sich auf die „balinesische Phase“ von 1989 bis 2005, in der Robert Zeppel-Sperls Werk durch seine Reisen nach Bali geprägt ist. Die Analyse von Gemälden wie „Regenbogenherde“ (1990) und „Shiva“ (1990) verdeutlicht die Einflüsse des balinesischen Hinduismus und die Erweiterung seines Bildrepertoires. Schließlich werden die stilistischen Veränderungen, die sich in der Kolorierung, dem Einsatz der Décalcomanie und den neuen Bildformaten manifestieren, sowie die motivischen Neuerungen, die aus der Begegnung mit der balinesischen Kultur resultieren, erörtert.
Das fünfte Kapitel der Arbeit widmet sich der Frage nach naiven Tendenzen im Werk Robert Zeppel-Sperls. Durch den Vergleich mit anderen naiven Künstlern und den Vergleich mit der Kunst von Kindern und Geisteskranken wird deutlich, dass sich Zeppel-Sperls Werk zwar durch naive Elemente auszeichnet, es aber nicht zur „naiven Kunst“ im engeren Sinn zu zählen ist.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Werk Robert Zeppel-Sperls und den Einflüssen von Kunstströmungen wie dem Phantastischen Realismus, der Abstraktion, dem Expressionismus, dem Surrealismus, der Renaissancemalerei und der naiven Kunst. Darüber hinaus werden wichtige Themen der 1960er Jahre, wie die Popkultur, die sexuelle Revolution, die Hippiebewegung, der Vietnamkrieg und der Einfluss der Beatles, analysiert.
- Quote paper
- Mag. (Phil) Theresa Dann (Author), 2008, "Nur eines darf die Kunst nicht sein: langweilig" - Malerei und Leben von Robert Zeppel-Sperl, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/116141