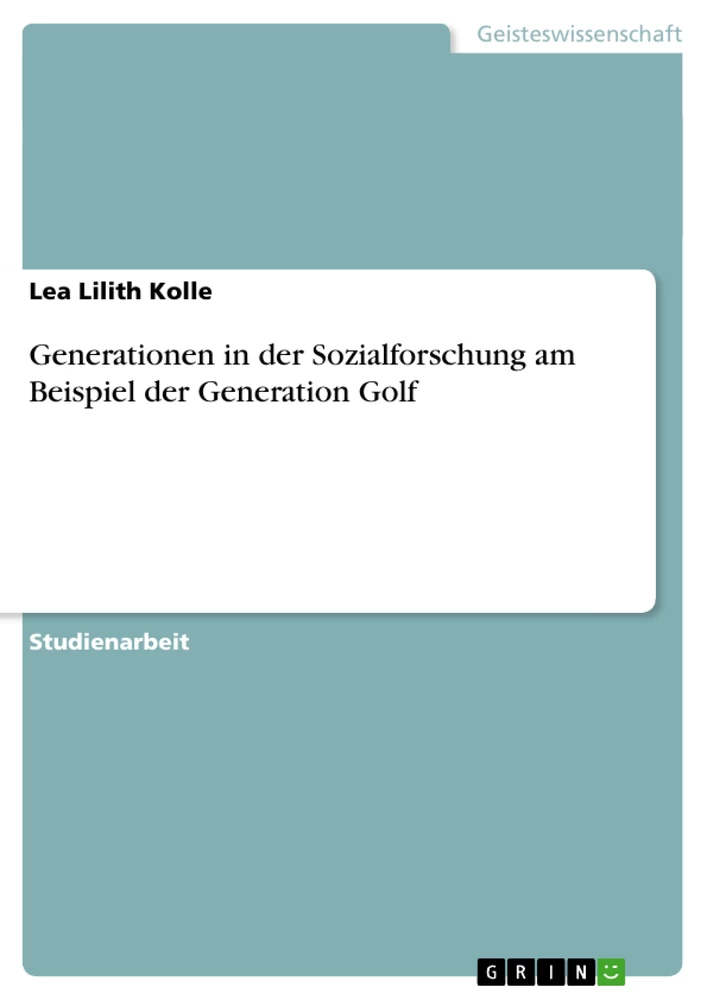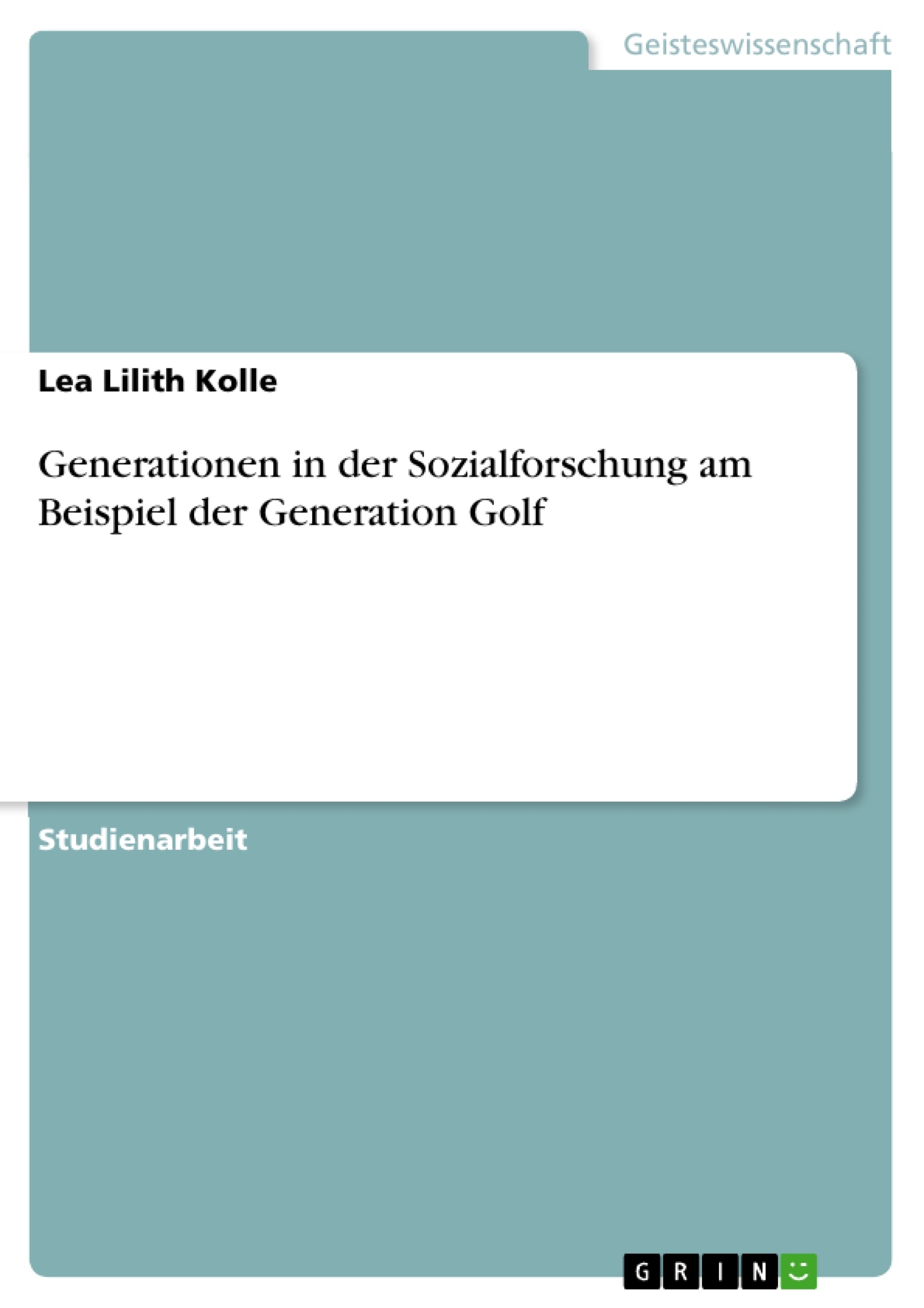Ziel dieser Hausarbeit ist es , das „Knäuel“ um die Generationendiskussion zu entzerren, indem die Möglichkeiten und Grenzen des gegenwärtigen Modewortes „Generation“ unter die Lupe genommen werden. Beinhaltet das Generationenkonzept auch heute noch eine brauchbare Methode, um vor allem soziale Entwicklungen zu beschreiben oder birgt der Generationenbegriff trotz der öffentlichen Popularität nur noch gähnende Leere?
Der Fokus wird bei der Untersuchung besonders auf eine relativ junge Generation gelenkt, die so genannte Generation Golf. Hat sich diese Generation durch eine Werbeidee aus einer Gesellschaft der Individuen gebildet, in der wir uns zwar immer besser als Tourist, Internetsurfer oder Börsenbeobachter im Optionsraum der Weltgesellschaft bewegen können, die aber keinen Identifikationsraum für die persönliche Lebenspraxis darstellt und ist es auf Grund dessen überhaupt legitim, von einer Generation an sich zu sprechen?
Anhand dieser Fragestellung soll der heutige Generationenbegriff am Beispiel der Generation Golf nun erläutert werden. Hierzu ist zunächst ein Rückblick auf die historische Bedeutung des Generationenbegriffs sinnvoll.
Inhaltsverzeichnis:
1. Allgemeine Einführung in den Generationenbegriff
1.1 Der Generationenbegriff in der Öffentlichkeit
1.2 Geburt einer Generation – Definition des Generationenbegriffs
2. Das geisteswissenschaftlich-soziologische Generationenmodell nach Mannheim (1928)
2.1 Vita
2.2 „Das Problem der Generationen“ oder der Generationenbegriff nach Mannheim
2.2.1 Generationenlagerung, Generationenzusammenhang und Generationeneinheit
2.2.2 Gesellschaftliche Dynamik im Zusammenspiel mit Generationen
2.2.3 Jugend als Entwicklungsbegriff im „Geist der Zeit“
2.3 Zwischenfazit zum Mannheimschen Generationenverständnis
3. Generationenbilder der Moderne
3.1 Das Kohortenkonzept nach Ryder (1964)
3.1.1 Geburtskohorten und sozialer Wandel
3.1.2 Sozialisationsprozesse
3.2 Ryder vs. Mannheim, ein Vergleich
4. Das Generationenkonzept an einem aktuellen Beispiel – das postheroische Generationenverständnis der „Generation Golf”
4.1 Der Ursprung der Generation Golf. Eine Generation ohne Generationenkonflikt?
4.1.1 Erwachsenwerden in der Generation Golf
4.1.2 Der Golf als Generationenobjekt
4.2 „Die Generation Golf im Licht der Wissenschaft“ oder eine empirische Untersuchung
4.3 Gibt es die Generation Golf? Eine kritische Stellungnahme zu der Generationenanalyse von Klein
5. Schlussbemerkung zur Ironie der Generation Golf
Literaturverzeichnis:
Lexika:
Tageszeitungen:
1. Allgemeine Einführung in den Generationenbegriff
1.1 Der Generationenbegriff in der Öffentlichkeit
Die zahlreichen aktuellen Thematisierungen der Generationenproblematik in der Öffentlichkeit geben Anlass, das Thema einmal genauer zu betrachten. In den klassischen Arbeiten von Dilthey, Pinder und Mannheim beruht der wissenschaftliche Gebrauchswert der Kategorie Generation auf der Annahme, „dass frühe prägende Erfahrungen für das gesamte Leben eine spezifische Art des Erlebens und Denkens, eine spezifische Art des Eingreifens in den historischen Prozess nahe legen.“[1] Dennoch ist der Generationenbegriff keineswegs veraltet, schließlich greifen „mittlerweile akademische Studien ebenso gern zur griffig-kurzlebigen Generationsformel wie populärwissenschaftliche und populärkulturelle Sachbücher“.[2] Zu klären bleibt nun allerdings, ob allein diese gemeinsame Prägung zur Entstehung einer Generation genügt und was dann hierbei der zu Grunde gelegte Generationenbegriff ist.
1.2 Geburt einer Generation – Definition des Generationenbegriffs
„Das Auftauchen des Wortes Generation im Deutschen ist ein Übersetzungsphänomen. Es begegnet einerseits in der Kette von gr. genesis – lat. generatio am Übergang von der lateinischen zur deutschen Wissenschaftssprache zunächst in der Bedeutung von Zeugung. Andererseits wird es verwendet, um jene Funktion oder Position zu bezeichnen, die die genealogische Konstitution des Gattungsbegriffs beschreibt – so beispielsweise in Übersetzungen der griechischen Philosophie.“[3]
Eine Generation bezieht sich also begriffsgeschichtlich indirekt auf die ursprüngliche Entstehung, im Vordergrund steht jedoch der Aspekt der Überlieferung und Erbschaft. „Im Kontinuum von Ursprung und Aneinanderreihung betrifft die Generation also den Bestand der Gattung in der Dimension der Zeit.“[4] In dem ursprünglichen Zugang funktioniert die Generationen quasi als zeitlicher Ordnungsbegriff mit einer bewahrenden Komponente.
Um nun festzustellen, ob dieses Verständnis dem aktuell herrschenden Generationsbedürfnis noch entspricht, ziehe ich eine weitere Definition der Generation zu Rate.
„1. Bevölkerungsstatistisch ist eine Generation die durchschnittliche Differenz zwischen den Geburtsjahren der Eltern und der Kinder.
2. Soziologisch ist eine Generation die Population der etwa Gleichaltrigen (mit Schwankungsbreiten, die durch die bevölkerungsstatistische Definition einer Generation begrenzt sind), die in sich homogen sind hinsichtlich ihrer Einstellungen, Orientierungen und Verhaltensweisen und sich von anderen Generationen unterscheiden lassen.“[5]
Zwar scheint diese Definition in sich schlüssig, jedoch „sind in den letzten Jahren Feuilleton und Zeitgeistpublikationen zu einem reichen Betätigungsfeld für die Erfinder neuer Generationen und Generationsnamen geworden. Für einige Zeit schien es so, als sei der Begriff eher in die Bereiche von Technik und Werbung hinübergewechselt […]. In jüngster Zeit aber ist der Begriff in den Diskurs über Haltungen, Stile und Mentalitäten zurückgekehrt, in dem ständig neue Generationen auftreten.“[6]
Somit ist das Konzept der Generation alles andere als eindeutig und der Begriff an sich beinhaltet schon eine gewisse Dehnbarkeit. Trotz dieser mangelnden Verständlichkeit kann man dem Phänomen der Generation im alltäglichen Leben kaum entkommen. Woher kommt diese plötzliche Hochkonjunktur des Generationenbegriffs?
Ein Grund für den schon fast inflationären Begriffsgebrauch liegt sicher in der lebensweltlichen Gewissheit, wonach die Grundform des menschlichen Verstehens in der biographischen Erfahrung selbst zu suchen ist. Man glaubt also, unter dem Begriff der Generation dasselbe zu verstehen, weil er den Anschein einer natürlichen und daher universalen Lebenserfahrung erweckt. Jeder vermeint ganz eindeutig zu wissen, welcher Generation er auf jeden Fall oder doch gerade nicht angehört. Schließlich besitzt die Generation neben der Gemeinschaftsfunktion gleichzeitig die eines Differenzbegriffs.
Ist hier bereits ein Wandel im Generationenverständnis zu erkennen, der sich durch die Verschiebung vom Zeitmaß zum kollektiven Vergemeinschaftungsprozess äußert?
„Im Falle von Generationen ist damit gemeint, dass sich Menschen etwa gleichen Alters ein spezifisches Denken, Fühlen und Handeln zuschreiben und sich durch diese Gleichheitsvermutung miteinander verbunden fühlen.“[7] Wichtig ist, dass es sich bloß um ein empfundenes Beziehungsmuster handelt, da die Generation an sich keine feste Größe darstellt. „Insofern verbirgt sich im Begriff der Generation immer schon ein komplexes Zusammenspiel von Natur und Kultur, markiert die Generation doch die Schwelle zwischen Entstehung und Fortgang, zwischen Abstammung und Erbschaft, zwischen Prokreation und Tradition, zwischen Herkunft und Gedächtnis.“[8]
Ziel dieser Hausarbeit ist es nun, das „Knäuel“ um die Generationendiskussion zu entzerren, indem die Möglichkeiten und Grenzen des gegenwärtigen Modewortes „Generation“ unter die Lupe genommen werden. Beinhaltet das Generationenkonzept auch heute noch eine brauchbare Methode, um vor allem soziale Entwicklungen zu beschreiben oder birgt der Generationenbegriff trotz der öffentlichen Popularität nur noch gähnende Leere?
Der Fokus wird bei der Untersuchung besonders auf eine relativ junge Generation gelenkt, die so genannte Generation Golf. Hat sich diese Generation durch eine Werbeidee aus einer Gesellschaft der Individuen gebildet, in der wir uns zwar immer besser als Tourist, Internetsurfer oder Börsenbeobachter im Optionsraum der Weltgesellschaft bewegen können, die aber keinen Identifikationsraum für die persönliche Lebenspraxis darstellt[9] und ist es auf Grund dessen überhaupt legitim, von einer Generation an sich zu sprechen?
Anhand dieser Fragestellung soll der heutige Generationenbegriff am Beispiel der Generation Golf nun erläutert werden. Hierzu ist zunächst ein Rückblick auf die historische Bedeutung des Generationenbegriffs sinnvoll.
2. Das geisteswissenschaftlich-soziologische Generationenmodell nach Mannheim (1928)
„Das heute herrschende Verständnis der Generation als Mentalitäts- oder Bewusstseinseinheit geht überwiegend auf eine soziologische Perspektive zurück, für deren wissenschaftliche Begründung Karl Mannheims Aufsatz „Zum Problem der Generation“ aus dem Jahre 1928 steht.“[10]
2.1 Vita
Karl Mannheim, deutscher Soziologe, wurde am 27. März 1893 in Budapest geboren und verstarb am 9. Januar 1947 in London, wohin er 1933 emigrierte. Bis 1947 lehrte er an der London School of Economics. Er wurde insbesondere beeinflusst von Hegel, Marx, Dilthey und Weber. Mannheim gilt als Repräsentant einer radikalen Wissenssoziologie, sein Hauptinteresse widmete er dem Bild einer geplanten („streitbaren“) Demokratie.[11]
Bezogen auf das „Problem der Generationen“ war Mannheim ein Vertreter der romantisch-historischen Herangehensweise. Gegen den Positivismus sprach der für ihn zu geradlinige, quantitative Zugriff auf das Problem, der die Schwierigkeit der Erkennung eines Anfangs- und Endpunktes von Generationen beinhaltete. Er kritisierte das positivistische Bestreben, „ein generelles Gesetz der historischen Rhythmik zu finden, und zwar auf Grund des biologischen Gesetzes der begrenzten Lebensdauer des Menschen und der Gegebenheit der Altersstufen.“[12] Dem entgegen stellte er qualitative Forschungsansätze, in denen die Generationenfrage eher als Problem des Vorhandenseins einer nicht messbaren, ausschließlich qualitativ erfassbaren Zeit betitelt wurde. Diese Überlegungen nahm er im Diskurs mit dem Philosophen Wilhelm Dilthey und dem Kunsthistoriker Wilhelm Pinder in Augenschein.
In Anlehnung an Pinders berühmte Formulierung der „Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen“ mit der er das Phänomen des Lebens verschiedener Generationen in derselben chronologischen Zeit meinte, schaffte Mannheim den Spagat zwischen der quantitativen und der qualitativen Ebene. Denn die erlebte Zeit ist eine qualitative Größe, die Zahl der Gleichaltrigen wird wiederum quantitativ gemessen. „Das Zeitdenken muss also – um ein musikalisches Gleichnis Pinders anzuwenden – polyphon organisiert sein, in jedem „Zeitpunkt“ muss man die einzelnen Stimmen der einzelnen Generationen heraushören, die stets von sich aus jenen Punkt erreichen.“[13]
Zudem berief sich Mannheim ansatzweise auf Wilhelm Pinders „Entelechien“ (Ausdruck der Einheit des „inneren Ziels“ einer Generation / eingeborenen Lebens- und Weltgefühls) als entscheidendes Generationenmerkmal. Jede Generation bildet aus sich heraus eine eigene Entelechie, „wodurch allein sie eigentlich erst zu einer qualitativen Einheit wird.“[14] Mannheim kritisierte dabei, dass gesellschaftliche Faktoren von Pinder unberücksichtigt blieben. „Entweder ist man hier völlig spiritualistisch und lässt alles aus Entelechien hervorgehen (die es sicher gibt), oder aber man hat das Gefühl, man müsste doch auch etwas Realismus in die Sache bringen, und dann hält das unmittelbar Vitale, Rasse, Generation (die es sicher auch gibt) her und bringt in „geheimnisvollem Naturvorgange“ die geistigen Potenzen hervor.“[15]
2.2 „Das Problem der Generationen“ oder der Generationenbegriff nach Mannheim
Wie bereits kurz erwähnt unternahm Mannheim den Versuch, „in bewusster Abgrenzung zu biologistischen Gesellschaftstheorien, eine zwar nicht in erster Linie quantifizierbare, aber dennoch messbare Rhythmik gesellschaftlicher Veränderung herauszuarbeiten.“[16] Sein Forschungsinteresse galt besonders der Gleichzeitigkeit gesellschaftlicher Einflüsse im Sozialisationsprozess, wobei er in der Generation ein theoretisches Beziehungsgefüge sah, das noch keine konkrete Gemeinschaft bildete. Im Mannheimschen generationellen Ordnungsmodell lassen sich drei unterschiedliche Elemente des Generationenbegriffs unterscheiden – die Generationenlagerung, der Generationenzusammenhang und die Generationeneinheit, welche wiederum miteinander verknüpft sind.
2.2.1 Generationenlagerung, Generationenzusammenhang und Generationeneinheit
Bei der Generationenlagerung gilt nach Mannheim die Zugehörigkeit zur selben „historischen Lebensgemeinschaft“[17] als Hauptmerkmal. „Jeder Mensch befinde sich in einer bestimmten Generationenlagerung, die er nicht einfach wie einen Verein verlassen könne und die dem Einzelnen sowohl spezifische Möglichkeiten eröffne wie auch Beschränkungen auferlege.“[18] In der Lagerung ist folglich ein gewisses Potenzial aller Einzelindividuen vorhanden, die im sozialen Raum verwandt gelagert sind und denselben Wandel erleben. „So ist die Generationslagerung ihrerseits durch Momente bestimmbar, die aus den Naturgegebenheiten des Generationswandels heraus bestimmte Arten des Erlebens und Denkens den durch sie betroffenen Individuen nahe legen.“[19]
Der Generationenzusammenhang befindet sich dann bildlich gesprochen auf der nächsten Ebene. Während die Lagerung lediglich die bereits beschriebenen potenziellen Möglichkeiten enthält, „die zur Geltung kommen, verdrängt werden oder aber in andere sozial wirkende Kräfte eingebettet, modifiziert zur Auswirkung kommen können“[20], bedarf es einer konkreten Verbindung, um von einem Generationenzusammenhang sprechen zu können. Hier entsteht durch die „Partizipation der derselben Generationslagerung angehörenden Individuen am gemeinsamen Schicksal und an den dazugehörenden, irgendwie zusammenhängenden Gehalten“[21] eine reale Verbundenheit. Wichtig hierbei ist aber, dass sich im generationellen Zusammenhang auch Menschen vergemeinschaften können, die zwar nicht im direkten Kontakt stehen, wo sich dennoch durch die indirekte Verbindung der gemeinsamen Beteiligung Schnittpunkte bilden, die ein Gemeinschaftsgefühl hervorrufen. Durch Sozialisation entsteht hier somit eine gemeinsame Orientierung, ein Miteinander von Individuen.
Innerhalb dieser „Kommunikationsgemeinschaft“[22] können dann Generationeneinheiten entstehen. Diese sind nach Mannheim dadurch charakterisiert, „dass sie nicht nur eine lose Partizipation verschiedener Individuen am gemeinsam erlebten, aber verschieden sich gebenden Ereigniszusammenhang bedeuten, sondern dass sie ein einheitliches Reagieren, ein im verwandten Sinne geformtes Mitschwingen und Gestalten der gerade insofern verbundenen Individuen einer bestimmten Generationslagerung bedeuten.“[23] Generation bedeutet hier eine meist verbindende, prägende Einheit, eine kollektive Identität, die durch eine ähnliche Erlebnisverarbeitung zustande kommt. Was aber nicht der Tatsache widerspricht, dass die „konkrete Ausdrucksform durchaus unterschiedlich, sogar gegensätzlich sein könne, die aber auf einer gemeinsamen Grundstimmung basiere.“[24]
Den Beweis für diese Aussage liefert Mannheim mit Beispiel des romantischen Konservatismus und des liberalen Rationalismus zu Beginn des 19. Jahrhunderts. „Dieselbe Jugend, die an derselben historisch-aktuellen Problematik orientiert ist, lebt in einem „Generationszusammenhang“, diejenigen Gruppen, die innerhalb desselben Generationszusammenhanges in jeweils verschiedener Weise diese Erlebnisse verarbeiten, bilden jeweils verschiedene „Generationseinheiten“ im Rahmen desselben Generationszusammenhanges.“[25] Somit können auch zwei Gegenpole in einem Generationenzusammenhang leben und darin dann wieder durch verschiedene Generationeneinheiten verbunden sein, dadurch, dass sie Informationen und Ereignisse auf unterschiedliche Art und Weise aufnehmen, ihre Einstellungen danach formen und sich dementsprechend verhalten.
Um dieses bislang noch recht statische System nun aber zum Leben zu erwecken, bedarf es der genauen Klärung der Frage, was denn Generationen stiftend wirkt. Das war nach Mannheim z.B. die „weitgehende Verwandtschaft der Gehalte, die das Bewusstsein der einzelnen erfüllen“[26], wobei allein die Inhalte nicht ausreichten zum tatsächlichen Vergemeinschaftungsprozess. „Noch mehr verbinden jene formenden Kräfte, durch die gestaltet, diese Inhalte erst wirklich ein Gepräge und eine Richtungsbestimmtheit erhalten.“[27] Was also für Mannheim als tatsächliche Basis einer Generation galt, waren Grundintentionen und Gestaltungsprinzipien, die von den Individuen einer Generationeneinheit geteilt wurden. Verfolgen wir diesen roten Faden einmal weiter, stellen wir fest, dass Grundintentionen eher in konkreten Gruppen entstehen, in denen eine ähnliche Wahrnehmung und von daher auch eine mehr oder weniger identische Deutung vorherrscht. „Solche Grundintentionen, Formierungstendenzen, in konkreter Verbindung einzelner Menschen einmal entstanden, sind später von dieser konkreten Gruppe auch abhebbar, haben eine in der Ferne wirkende, werbende und verbindende Kraft.“[28] Das liegt daran, dass diese Impulse ein Ausdruck der betreffenden Generationenlagerung sind und sich deshalb auch Individuen außerhalb der konkreten Gruppe in verwandter Lagerung damit identifizieren können.
[...]
[1] Mannheim, Karl (1964 [1928] ): Das Problem der Generationen. In: Ders. (Hg.): Wissenssoziologie – Auswahl aus dem Werk, Berlin: Luchterhand, 509-565, hier S. 528.
[2] Maase, Kaspar: Selbstbeschreibung statt Aufbruch. Anmerkungen zur postheroischen Generationsbildung. In: Mittelweg 36 12 (2003), 69-78, hier S 70.
[3] Weigel, Sigrid: Generation, Genealogie, Geschlecht. Zur Geschichte des Generationskonzepts und seiner wissenschaftlichen Konzeptualisierung seit Ende des 18. Jahrhunderts. In: Musner, Lutz/ Wunberg, Gotthart (Hg.): Kulturwissenschaften. Forschung – Praxis – Positionen, Wien (2002), 161-190, hier S. 172.
[4] Weigel, S. 173.
[5] Reinhold, Gerd (2000). Soziologielexikon. München; Wien: Oldenbourg Verlag, S. 205.
[6] Weigel, S. 161.
[7] Jureit, Ulrike (2006): Generationenforschung. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, S. 12.
[8] Weigel, S. 163.
[9] Vgl. Bude, Heinz: Die „Wir-Schicht“ der Generation. In: Berliner Journal für Soziologie 7 (1997), 197-204, hier S. 202.
[10] Weigel, S. 164.
[11] Vgl. dtv Lexikon Nr. 14 (2006), München: Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, S. 72f.
[12] Mannheim, S. 511.
[13] Ebenda, S. 518.
[14] Ebd., S. 518.
[15] Mannheim, S. 520.
[16] Jureit, S. 20.
[17] Mannheim, S. 542.
[18] Jureit, S. 21.
[19] Mannheim, S. 529.
[20] Ebd., S. 542.
[21] Mannheim, S. 547.
[22] Giesen, Bernhard: Generation und Trauma. In: Reulecke, Jürgen (Hg.): Generationalität und Lebensgeschichte im 20. Jahrhundert. München 2003, 59-69, hier S. 60.
[23] Mannheim, S. 547.
[24] Jureit, S. 22.
[25] Mannheim, S. 544.
[26] Mannheim, S. 544.
[27] Ebd., S. 545.
Häufig gestellte Fragen zum Generationenbegriff
Was ist der Generationenbegriff im Allgemeinen?
Der Generationenbegriff bezieht sich auf eine Gruppe von Menschen, die zur gleichen Zeit geboren wurden und ähnliche Erfahrungen und soziale Einflüsse teilen, die ihr Denken, Fühlen und Handeln prägen. Der Begriff wird sowohl in der Bevölkerungsstatistik als auch in der Soziologie verwendet, wobei die soziologische Definition sich auf die Homogenität von Einstellungen und Verhaltensweisen innerhalb einer Generation konzentriert.
Wie definiert Karl Mannheim den Generationenbegriff?
Karl Mannheim betrachtet Generationen als ein Beziehungsgefüge und unterscheidet drei Elemente: Generationenlagerung (Zugehörigkeit zur selben historischen Lebensgemeinschaft), Generationenzusammenhang (Partizipation am gemeinsamen Schicksal) und Generationeneinheit (einheitliches Reagieren und Gestalten im verwandten Sinne). Er betont die Bedeutung gemeinsamer Grundintentionen und Gestaltungsprinzipien für die Bildung einer Generation.
Was ist der Unterschied zwischen Generationenlagerung, Generationenzusammenhang und Generationeneinheit nach Mannheim?
Generationenlagerung beschreibt die Zugehörigkeit zur selben historischen Lebensgemeinschaft und die damit verbundenen potenziellen Möglichkeiten und Beschränkungen. Generationenzusammenhang entsteht durch die Partizipation der Individuen am gemeinsamen Schicksal, was zu einer realen Verbundenheit führt. Generationeneinheiten sind durch ein einheitliches Reagieren und Gestalten der Individuen innerhalb eines Generationszusammenhanges gekennzeichnet.
Was kritisiert der Text am aktuellen Gebrauch des Generationenbegriffs?
Der Text kritisiert, dass der Begriff der Generation in den letzten Jahren inflationär und oft unreflektiert verwendet wird, insbesondere in Feuilletons und Zeitgeistpublikationen. Es wird bemängelt, dass der Begriff oft für kurzlebige Trends und Marketingzwecke instrumentalisiert wird und somit seine wissenschaftliche Aussagekraft verliert.
Was ist die "Generation Golf" und welche Rolle spielt sie in der Diskussion um den Generationenbegriff?
Die "Generation Golf" wird als Beispiel für eine relativ junge Generation angeführt, deren Existenz und Charakteristika umstritten sind. Der Text untersucht, ob diese Generation tatsächlich eine kohärente Gruppe darstellt oder ob sie lediglich das Ergebnis einer Werbeidee ist. Die Analyse der "Generation Golf" dient dazu, die Möglichkeiten und Grenzen des gegenwärtigen Generationenbegriffs zu beleuchten.
Welche Rolle spielt der Begriff der "Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen" im Zusammenhang mit Generationen?
Der Begriff, geprägt von Wilhelm Pinder, beschreibt das Phänomen, dass verschiedene Generationen in derselben chronologischen Zeit leben, jedoch unterschiedliche Erfahrungen und Prägungen haben, was zu unterschiedlichen Perspektiven und Handlungsweisen führt. Mannheim griff diesen Gedanken auf, um zu zeigen, dass die erlebte Zeit eine qualitative Größe ist und die Betrachtung von Generationen eine polyphone Perspektive erfordert.
Welchen Einfluss hatten Dilthey und Pinder auf Mannheim?
Mannheim diskutierte mit dem Philosophen Wilhelm Dilthey und dem Kunsthistoriker Wilhelm Pinder. Mannheim nahm deren Überlegungen zum Problem der Erkennung eines Anfangs- und Endpunktes von Generationen auf.
- Quote paper
- Lea Lilith Kolle (Author), 2008, Generationen in der Sozialforschung am Beispiel der Generation Golf, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/116146